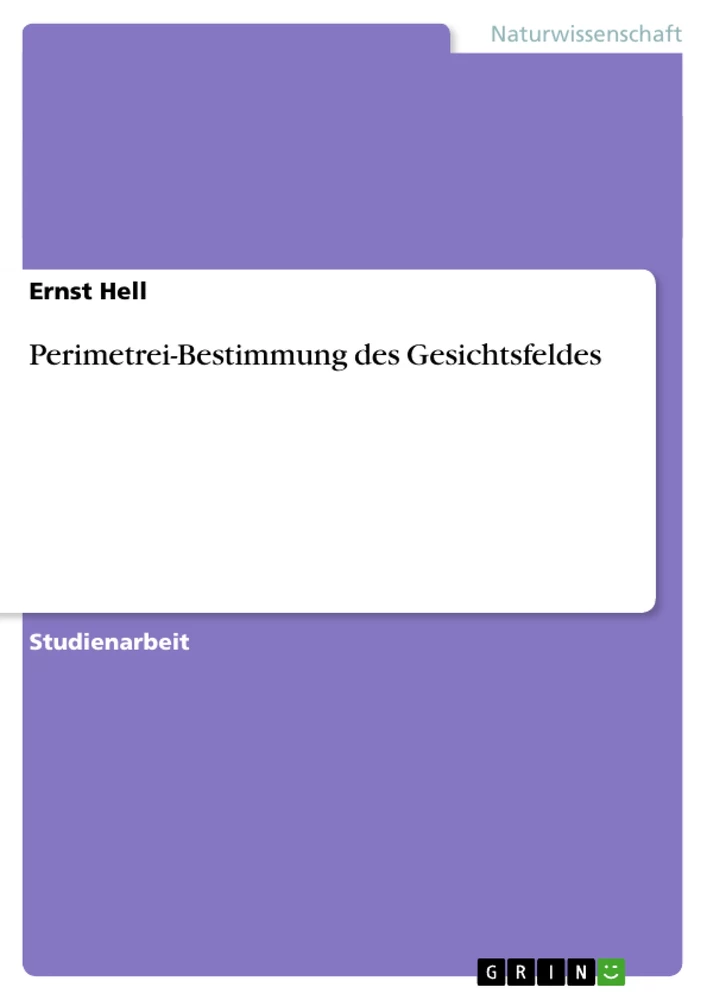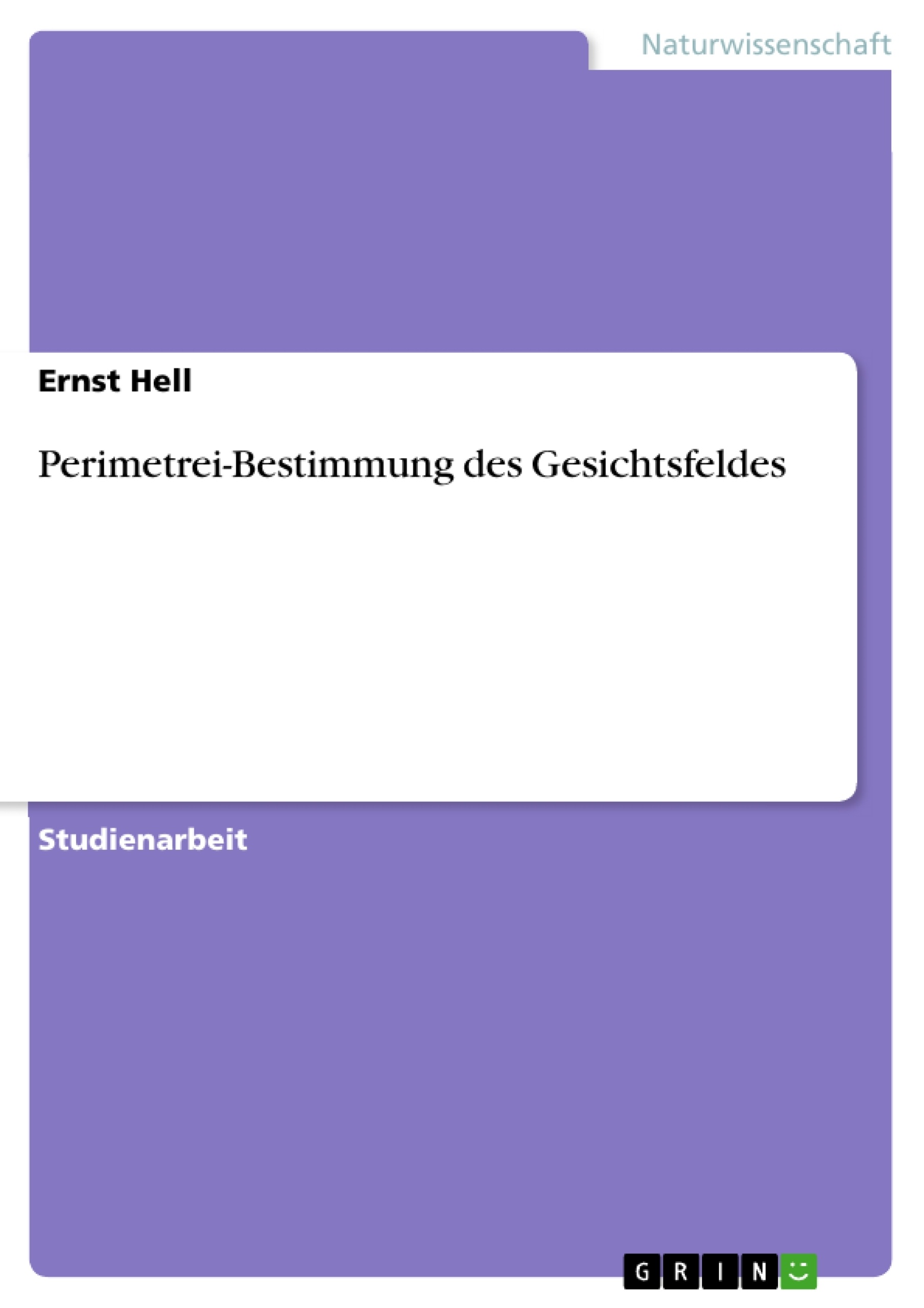Stellen Sie sich vor, Ihre Wahrnehmung der Welt schrumpft, die Ränder Ihres Sichtfelds verschwimmen. Die Perimetrie, die präzise Bestimmung des Gesichtsfeldes, ist der Schlüssel zur Aufdeckung subtiler Veränderungen und zur Früherkennung von Augenerkrankungen. Diese tiefgreifende Arbeit entführt Sie in die faszinierende Geschichte der Perimetrie, von den ersten rudimentären Ansätzen im Altertum, als Hippokrates bereits Hemianopsien diagnostizierte, bis hin zu den hochmodernen computergestützten Systemen von heute. Entdecken Sie die bahnbrechenden Erkenntnisse von Pionieren wie Mariotte, Boerhouve und von Graefe, deren Arbeit die Grundlage für unser heutiges Verständnis von Gesichtsfelddefekten bildete. Tauchen Sie ein in die Welt der kinetischen und statischen Perimetrie, lernen Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Untersuchungsmethoden kennen, vom klassischen Goldmann-Perimeter bis zum flexiblen Bjerrum-Schirm. Erfahren Sie, wie standardisierte Testbedingungen und internationale Standards (IPS) die Genauigkeit und Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten. Diese Arbeit beleuchtet nicht nur die theoretischen Grundlagen, sondern auch die praktische Anwendung der Perimetrie. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Selbstbau eines Perimeters, wobei die Herausforderungen und kreativen Lösungsansätze bei der Entwicklung eines eigenen Testgeräts detailliert beschrieben werden. Die Ergebnisse einer Versuchsreihe mit 40 Probanden werden präsentiert und analysiert, wodurch ein Einblick in die Vielfalt individueller Gesichtsfelder und mögliche Abweichungen vom Idealbild ermöglicht wird. Ob Medizinstudent, Augenarzt oder einfach nur interessiert an der Funktionsweise des menschlichen Sehens – diese Arbeit bietet eine umfassende und verständliche Einführung in die Welt der Perimetrie, die sowohl informativ als auch inspirierend ist und die Bedeutung der frühzeitigen Erkennung von Gesichtsfelddefekten für die Erhaltung der Sehfähigkeit hervorhebt. Tauchen Sie ein in die Details von Skotomen, Isopteren und Refraktionsskotomen, und lernen Sie die Kunst der Interpretation von Gesichtsfeldschemata. Lassen Sie sich von der Präzision und der Bedeutung dieser diagnostischen Methode faszinieren, die einen unverzichtbaren Beitrag zur Augenheilkunde leistet. Die Reise durch die Geschichte und Praxis der Perimetrie wird Ihr Verständnis für die Komplexität des Sehens und die Bedeutung einer sorgfältigen Diagnose nachhaltig verändern.
Perimetrie - Bestimmung des Gesichtsfeldes
Theoretischer Teil der Facharbeit
1. Geschichte des Perimeters
Die Geschichte des Perimeters läßt sich grob in zwei Abschnitte unterteilen:
1. Entwicklungen bis 1944 ( z.B.: Lauber 1944 )
2. Spätere Entwicklungen ab 1976 ( Francois und Verriest )
Die wichtigsten Beziehungen der Entwicklungen liegen in der Struktur und den einzelnen Funktionen der Augenuntersuchung. Damit ist die Notwendigkeit spezieller Methoden und einheitliche Richtlinien gemeint.
Als Fakt ist hierbei das Wesentliche der Abhängigkeit zwischen Morphologie und Ausfallsmustern zum Beispiel bei Glaukomen1 oder Ausfällen der Sehbahn zu betrachten. Dieses Faktum ist schon seit über 100 Jahre durch Bjerrum und Roenne bzw. Henschen, Wilbrand und Holmes bekannt.
Ein negativer Aspekt dieser doch unterschiedlichen Forschungen einzelner Wissenschaftlern ist dieser, dass die Untersuchungsraster und Strategien der Perimetrie nicht den bereits bekannten Kenntnissen angeglichen wurde.
Die Entwicklungen der heutigen Perimeter lässt sich bis in das Altertum zurückverfolgen. Im Altertum waren Euklid, Ptolemäus, Demianos oder auch Heliodoros von Larissa und Galen führende Wissenschaftler im heutigen Sinne.
Hippokrates ( 430 - 380 v. Chr. ) diagnostizierte damals schon einen groben Gesichtsfeldausfall als Hemianopsie.2
Nun ein großer Schritt voraus in die neuzeitlich Perimetrie.
Bereits 1606 entdeckte Mariotte den Blinden Fleck.
1708 folgte Boerhouve mit der Definition des Skotomes3 (skotos - Dunkelheit). 1801 wurden die Außengrenzen des Gesichtsfeldes durch Young deutlich gemacht; Purkinje folgte 1825 mit der gleichen Entdeckung.
Allerdings besaßen beide einen unterschiedlichen Ansatz um zu dieser Entdeckung zu gelangen.
Young entdeckte die rasche Abnahmen der Sehschärfe vom Zentrum zur Peripherie hin, wohingegen Purkinje die unterschiedlichen Außengrenzen des Gesichtsfeldes je nach Farbe und Pupillenweite deutete.
Beide Wissenschaftler waren Vorreiter der klinischen Perimetrie, welche aber erst 31 Jahre, 1856 durch von Graefe neu definiert wurde.
Von Graefe erkannte damals schon die wichtigsten Typen der Gesichtsfeldstörungen wie zum Beispiel:
- konzentrische Gesichtsfeldeinschränkungen
- Vergrößerung des Blinden Fleckes
- Zentralskotom5
- Bitemporale, binasale Ausfälle
Ausserdem ordnete er die Orte der Ausfälle gemäß anatom. Aspekte richtig zu. (Läsionen)6 Ursprünglich wurde der Begriff Campimetrie als Oberbegriff der Perimetrie und Skotomie eingesetzt.
Perimetrie beinhaltet das Ausmessen der Aussengrenzen des Gesichtsfeldes, wohingegen die Skotomie die Abgrenzung blinder Gebiete und Gebiete mit herabgesetzter Empfindlichkeit beschreibt.
Heute aber schließt der Begriff Perimetrie alle verfügbaren Untersuchungsmethoden mit ein. Bei der Perimetrie und der Campimetrie gibt es nicht nur Unterschiede in der Durchführung der Untersuchung, sondern auch im Aufbau der Apparaturen.
Bei der Campimetrie werden die Testobjekte auf einer flachen Ebene, bei der Perimetrie auf einem Kreisbogen bzw. einer Halbkugel dargestellt.
Somit bedeutet Perimetrie heute die ,,Bestimmung der Lichtunempfindlichkeit (LUE) in demjenigen Raum, der bei der monokularen Fixation geradeaus gleichzeitig gesehen wird."
1.1 IPS - International Perimetric Standards
Aus dieser Definition gingen 1978 die ,,IPS" International Perimetric Standards hervor. ( Concilium Ophtalmologicum 1979 )
Zitat:4
,,Definitions of Perimetry and of Visual Field"
,,Perimetry is the measurment of visual functions of the eye at topographically located loci in the visual field. The visual field is that portion of the external environment of the observer wherein the steadily fixing eye(s) can detect visual stimuli"
1.2 Tabelle zur Entwicklung der heutigen Perimetrie.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten7 8
2. Allgemeine Informationen
Das Gesichtsfeld
Das Gesichtsfeld ist der Bezirk der Außenwelt, den man bei ruhiggestelltem Auge wahrnimmt. Dieses ist mit 130 Grad im vertikalen Bereich weniger ausgedehnt als in horizontaler Richtung mit rund 150 Grad. Es ist außerdem für das Farbensehen viel kleiner, als für die Hell - Dunkel - Empfindungen. Das Blickfeld dagegen ist das Gebiet, das man bei ruhiggehaltenem Kopf, aber maximalen Blickbewegungen des Auges mit den Sehachsen umfaßt. Die Untersuchung des Blickfeldes ist bei Augenmuskellähmungen sehr wichtig. Das Gesichtsfeld wird mit Hilfe eines Perimeters untersucht. Hierbei müssen konstante Bedingungen eingehalten werden.
Perimetrie
Unabdingbar bezüglich der Untersuchungsmethoden ist die Gesichtsfeldbestimmung, die Perimetrie. Es gibt zwei Varianten, die kinetische und die statische Perimetrie.
Bei der kinetischen Perimetrie (Isopterenperimetrie) wird ein Punkt in einer Hohlhalbkugel fixiert. Für diese Untersuchung wird meist das Goldmann-Perimeter verwendet. Eine Lichtmarke wird von Hand durch eine hinter der Halbkugel sitzende Person immer näher ins Zentrum der Halbkugel gerückt. Sobald die untersuchte Person diese Lichtmarke sieht, wobei sie den Mittelpunkt im Auge behalten muß, gibt diese ein akustisches Signal, das an dieser Stelle auf einem Vordruck notiert wird.
Die Lichtmarke nähert sich systematisch von allen Punkten aus der Peripherie, so daß nach Verbindung dieser Punkte ein Ring entsteht, der als Isoptere9 bezeichnet wird. Die Untersuchung wird mit immer schwächeren Lichtmarken wiederholt, wobei sich die Ringe immer enger um die Fovea10 ziehen. Man erhält eine Struktur ähnlich den "Höhenlinien eines Berges auf einer Landkarte".
Der Abstand dieser Ringe, die als Isopteren bezeichnet werden, ist das Empfindlichkeitsgefälle der Netzhaut. Alle Punkte, die auf derselben Isoptere liegen, haben dieselbe Netzhautempfindlichkeit. Die nächstschwächere Lichtmarke wird von diesen Punkten auf der Netzhaut dann somit nicht mehr, sondern nur noch weiter innen zur Fovea hin wahrgenommen.
Die Lichtmarken werden nach ihrer Größe und Helligkeit unterteilt. Eine römische Zahl von I
- V gibt die Breite des Winkels an, auf dem die Lichtmarke auf die Halbkugel projeziert wird, was somit ihrer Größe entspricht. Jede dieser römischen Zahlen wird noch einmal mit Hilfe arabischer Zahlen von 1-4 unterteilt (z.B. I1, I2, I3, I4).
Ein Buchstabe von a-e gibt die Leuchtdichte (cd/m<=) an. Eine Lichtmarke wird standardisiert zum Beispiel als IV4e angegeben.
Die kinetische Perimetrie hat folgenden Nachteil, ein Ringskotom kann nicht festgestellt werden kann, ebensowenig wie inselartige Sehausfälle, da das Signal ja bereits in der Peripherie gegeben wurde.
Derartige Sehausfälle werden genauer mit der statischen Perimetrie (Profilperimetrie) erfaßt. Die Lichtmarken leuchten an bestimmten Punkten des Gesichtsfeldes auf, wobei sie jedesmal heller werden, um die Reizschwelle des jeweiligen Punktes auf der Netzhaut zu ermitteln. Dadurch wird ein Profilschnitt durch das Gesichtsfeld gelegt. Das Raster, in dem die Punkte getestet werden, kann sehr fein angelegt werden. Diese Untersuchung ist sehr zeitaufwendig. Deshalb gibt es mittlerweile die programmgesteuerte statische Rasterperimetrie (automatisierte Perimetrie, Computerperimetrie), die mit rechnergestützten Systemen arbeitet. Wenn das Signal gegeben wurde, wird nach einer gewissen Zeit zur Überprüfung eine schwächere Lichtmarke gesetzt.
Wenn das Signal nicht gegeben wird, erscheint etwas später an dieser Stelle eine stärkere Lichtmarke. Der Vorteil dieser Methode besteht darin, daß sie unabhängig von einer untersuchenden Person durchgeführt werden kann, und daß sie genauere Ergebnisse liefert. Jedoch erfordert sie eine hohe Konzentration der Probanden, da nach einiger Zeit die Fixationsfähigkeit nachläßt.
Das Tübinger Perimeter wird ebenfalls von Hand bedient und kann sowohl zur statischen als auch zur kinetischen Perimetrie eingesetzt werden. Zur Erkennung des Ausfalles von Sehzellen wird die Zwei-Farben-Schwellenperimetrie bei Dunkeladaptation durchgeführt. Bei dieser Stäbchen- und Zapfenselektiven statischen Perimetrie werden rote und blaue Lichtmarken verwendet, wobei Zapfen die roten Lichtmarken (650nm) und Stäbchen blaue und grüne Lichtmarken (500nm) wahrnehmen.
2.1 Das Goldmann - Perimeter
Goldmann realisierte schnell, dass der Hintergrund und die Größe der Halbkugel sowie die Größe und Helligkeit des Lichtpunktes standardisiert werden mußte.
Er wählte die Halbkugel ( Halbkugelperimeter ) da diese nach dem Lambertschen Gesetz11 nur eine Lichtquelle zur Ausleuchtung benötigt. Goldmann stellte besondere Anforderungen an ein Perimeter um eine exakte Perimetrie durchzuführen.
1. Konstante Ausleuchtung des Perimeterhintergrundes
2. Konstant Haltung der Verhältnisse bezüglich der Helligkeit der Testmarke zur Helligkeit des Hintergrundes
3. Entfernung des Auges zur Perimeterfläche mußte konstant sein
4. Die Bewegung der Textmarke, senkrecht auf die Grenze des Skotoms, mußte möglich sein
5. Selbstregistrierendes Perimeter mit großem Schema
6. Möglichkeit der Fixationskontrolle ( Kamera o.ä. )
7. Korrektion der Refraktion
8. Der Untersuchte muß an die Hintergrundhelligkeit adaptiert sein
Mit dem Goldmann - Perimeter besteht die Möglichkeit sowohl eine Statische wie auch eine Kinetische Perimetrie durchzuführen.
Zur Adaptation ist zu sagen, daß je heller oder dunkler die Umfeldleuchtdichte für eine Standarduntersuchung gewählt wird, um so länger muß, oder um so kürzer kann die Adaptationszeit12 sein. Bei einem relativ hellem Umfeld des Goldmann - Perimeters beträgt diese ca. 5 Minuten.
Bei der Korrektur der Refraktion13 muß Erhebungen und Ektasien14 des Fundus15 besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden ( sog. Refraktionsskotome ). Myopien16 über 5 sph gibt man die volle Nahkorrektur für den Bereich innerhalb 35°. Man untersucht in der Regel, vor allem bei einer ersten Untersuchung, zuerst das bessere Auge ( außer bei Simulationsverdacht ), um dem Probanden die Angst vor der Perimetrie zu nehmen.
Erklärung des Schemas
Die Kästchen in der rechten unteren Ecke des Schemas stellen die Einstellmöglichkeiten mit den Einstellgriffen des Perimeters dar.
Auf der Y-Achse liegt die Größe der Testmarken, auf der X-Achse die Testmarkenhelligkeit. Einheit 4 ist am am hellsten, 3 um 0,5 log Einheiten abgeschwächt. Weiter unterteilt werden können die Testmarkenhelligkeiten mit den Filtern d-a und mit vorschalten der Filter 0.001 und 0.01. Daraus ergibt sich in der dritten Linie die dB-Skala für die Helligkeit, wie wir sie von den automatischen Perimetern gewohnt sind. Angekreuzt sind vier verschieden Testmarkengrößen mit jeweils 0.315 geringerer Leuchtdichte, mit welchen man in etwa dieselbe Isoptere erhalten wird.
Die Spalte am linken unteren Rand des Schemas zeigt die Größe der Testmarken bzw. deren Fläche, die Kleinste1 /16 mm2, jede weitere 4mal größer, d.h. ¼, 1, 4, 16 und 64mm2 betragend. Die Testmarken sind leicht oval und der mittlere Durchmesser beträgt in 30cm für Testmarke 0 0.05°, Testmarke I 0.11°, Testmarke II 0.22°, Testmarke III 0.43°, Testmarke IV 0,86° und Testmarke V 1,75°.
Die anguläre Größe der größten Marke beträgt 2°/1° 30" und entspricht aufgrund ihrer Geschwindigkeit, mit welcher die Marke geführt wird, und der Reaktionszeit von Proband und Arzt dem kleinsten kinetisch auflösbaren Skotom. ( nach Fankhauser 1969 ). Die linke Spalte der Tabelle zeigt die Leuchtdichten, welche mit den zwei voreinander schaltbaren Filtern erreicht werden, wobei Filter ,,e" eine 100%ige Durchlässigkeit hat.
2.2 Untersuchungen am Bjerrum - Schirm ( Tangent Screen)
Zu den Vorteilen der Perimetrie am Bjerrum - Schirm zählen vor allem die große Flexibilität dieser Methode und die Möglichkeit einer direkten Untersuchung des Auges ( Probanden ) durch den Arzt.
Sie eignet sich sehr gut bei Patienten mit reduzierter Konzentration, bei der Suche nach kleinen Parazentralen Skotomen und bei Verdacht auf funktionelle Störungen.
Innerhalb von wenigen Minuten kann der Arzt mit dieser Methode ein brauchbares Gesichtsfeld erhalten, welches ihm über die zentralen 30° des Gesichtsfeldes Auskunft gibt.
2.2.1 Aufbau eines Bjerrum - Schirms:
Auf einer quadratischen, mit schwarzem Filzstoff bezogenen Tafel sind konzentrische Ringe, die Meridiane und die blinden Flecke für zwei verschiedene Distanzen (1-2m) unauffällig aufgestickt.
Die Tafel sollte 2x2m groß sein. Der Arzt hält einen langen Stab in der Hand an dessen Ende Testmarken von mm bis 10 cm Durchmesser befestigt werden.
Durch drehen des Stabes wird die Testmarke für den Probanden ,,unsichtbar" gemacht.
2.2.2 Durchführung der Untersuchung
Der Patient sitzt auf einem Stuhl, das Gesicht dem Schirm zugewandt, ohne den Kopf aufzustützen. Man beginnt die Untersuchung aus einer Distanz von einem Meter. Der Fixationspunkt muß in Augenhöhe angebracht sein. Das nicht zu Untersuchende Auge wird mit einer Augenklappe abgedeckt. Der Proband fixiert nun das Zentrum der Tafel, welches mit einem weißen Punkt markiert ist. Bei reduzierter Sehschärfe kann eine bedeutend größere weiße Fläche als Fixationspunkt gewählt werden.
Um einem Fixationsverlust vorzubeugen wird die Fixation regelmäßig durch den Arzt kontrolliert.
Vorhandene Refraktionsfehler werden mit Hilfe der Brille des Patienten behoben.
Es ist vorteilhaft, zu Beginn der Untersuchung eine Testmarke zu wählen, die mit Leichtigkeit bis zum Rand des Schirms sichtbar ist, um mit dieser das Verschwinden derselben innerhalb des Blinden Flecks zu demonstrieren.
Auf diese Weise begreift der Proband die Funktionsweise der Kinetischen Perimetrie.
Als nächstes werden in üblicher Weise die Isopteren mit immer kleiner werdenden Testmarken bestimmt und mit Hilfe von Stecknadeln auf dem Schirm festgehalten.
Am Ende der Untersuchung werden die Ergebnisse auf ein vorgedrucktes Schema übertragen und ausgewertet.
Skotome können aus zwei oder sogar vier Metern Distanz genau charakterisiert werden. Bei Verdacht auf funktionelle Störungen soll das Gesichtsfeld aus zwei Distanzen geprüft werden. Kommt es bei der Untersuchung aus einer größeren Distanz nicht zur Veränderung der Isopteren, sondern bleibt das Gesichtsfeld ,,tubulär" unverändert, so ist die Diagnose einer funktioneller Störung gesichert.
Die ermittelten Isopteren werden auf ein vorgedrucktes Schema eingetragen. Dabei notiert man neben dem Isopter jeweils die Größe und die Farbe der Testmarke sowie die Untersuchungsdistanz.
Die Untersuchung am Bjerrum - Schirm muß vom Arzt selbst durchgeführt werden oder zumindest muß ein Arzt bei der Untersuchung anwesend sein. Das in ein Schema übertragene Gesichtsfeld dient nur als ,,Gedächtnisstütze"; die eigentliche Interpretation des Gesichtsfeldes erfolgt kontinuierlich während der Untersuchung und nicht nachträglich anhand des Schemas.
Häufig ist es von Vorteil, die Perimetrie am Bjerrum --Schirm als schnelle Orientierung durchzuführen und je nach Ergebnis die für den Fall am Besten geeignete weitere perimetrische Methode zu bestimmen.
Praktischer Teil der Facharbeit
3. Versuchsaufbau des Perimeters:
Den Projektionsschirm baute ich mir aus einem mit Japanpapier beklebten Riesenluftballon. Nach aushärten des Leimes öffnete ich den Luftballon wieder und löste die papierne Halbkugel von dem Luftballon. So erhielt ich nach etwa zwei Tagen einen nahezu perfekten Projektionsschirm. Nun stellte sich mir die Frage nach einer Lösung des Problems bezüglich der Beweglichkeit des zu projizierenden Punktes. Ich bestellte mir bei einem Elektronikfachhandel einen Laserpointer, den ich auf eine Achse montierte und diese wiederum auf eine drehbar gelagerten Halterung befestigte. So konnte ich den Laserpointer in der X- und Y-Achse bewegen.
Ich probierte mehrere Möglichkeiten der Ansteuerung der Achsen aus bis ich auf die Idee kam, Modellbau - Servos zu benutzen. Diese haben den großen Vorteil, dass sie sich relativ einfach und präzise ansteuern lassen. Ich befestigte diese so an den Achsen, daß ich diese nun über eine Funkfernsteuerung bewegen konnte.
Dieses Laserpointer"modul" wurde an einem Rahmen befestigte, an dem schon der Schirm befestigt ist.
Nachdem das Modul fertig verkabelt und mit Spannung versorgt war, begann ich die Einteilung in Grad, von dem Schema auf den Schirm, zu übertragen.
Insgesamt umfaßte mein Perimeter ein Gesichtsfeld von Horizontal und Vertikal von 90° also insgesamt 180° in jeder Ebene. Um den Kopf des Probanden ruhig zu halten zimmerte ich mir ein Kinnstütze, auf die der Proband sein Kopf während der Untersuchung aufstützte, um einem Fixationsverlust vorzubeugen. Es gelang mir, genaue Ergebnisse und Unterschiede herauszuarbeiten.
3.1. Probleme bei dem Aufbau:
Die ersten Probleme traten bei der Gestaltung der Ansteuerung der Achsen auf. Ich mußte erst einige andere Möglichkeiten ausprobieren um dann zu erfahren, daß sie praktisch ins Nichts führten.
Ich begann die Achsen zuerst mit sogenannten Synchronmotoren anzusteuern. Da diese aber den notwendigen Drehwechsel der Achse, also somit die Flexibilität des Lasers nicht durch die Änderung der Pole erreichen, sondern durch mechanische Einwirkung in die Drehung selbst, waren sie für die Ansteuerung ungeeignet.
Als nächstes versuchte ich es mit Schrittmotoren. Dazu bestellte ich mir zwei Schrittmotoren, die sich pro Takt 2.5° drehten. Dazu wird jedoch eine spezielle Ansteuerkarte, die den Schrittmotor mit dem gewünschten Takt versorgt, benötigt.
Da diese Ansteuerkarte nur im Bausatz verfügbar ist, und ich beim zusammenlöten wohl einen Widerstand oder IC falsch eingelötet habe, fiel diese Möglichkeit auch weg. Als allerletzte Möglichkeit blieb mir der Versuch mit Hilfe von Modellbau - Servos, um die Achsen anzusteuern. Diese Modifizierung funktionierte auf Anhieb.
Empfänger, Stromversorgung und Servos baute ich danach in mein Perimeter ein.
Als Sender benutzte ich eine Funkfernsteuerung, die mir einen größeren Bewegungsfreiraum ermöglicht.
Nachdem diese in mein Perimeter eingebaut und justiert waren, konnte ich die ersten Ergebnisse in das Schema übertragen.
3.2 Versuchsbeschreibung:
Der Proband legt sein Kopf auf die Kinnstütze und fixiert mit dem zu untersuchenden Auge das Mittelkreuz, welches durch zwei Metallstäbchen gebildet wird.
Meine Versuchsreihe bezieht sich ausschließlich auf das rechte Auge.
Ich erklärte dem Probanden die Vorgehensweise des Versuches und bat ihn strikt das Mittelkreuz zu fixieren, da sonst bei dem Probanden ein Fixationsverlust eintritt und ich keine brauchbaren Ergebnisse erhalten würde.
Die gesamte Untersuchung ( Testen von mindestens 10 Stellen ) dauerte im Durchschnitt ca. 4-5 Minuten. Dies hört sich relativ wenig für eine Untersuchung an, es ist jedoch zu beachten, dass noch weitere Untersuchungen an 39 Probanden folgten.
3.3. Durchführung der Perimetrie
Materialliste:
- Probanden ( 40 )
- Perimeter
- Schema
- Funkfernsteuerung
- Stift
- Schema Vordrucke
- Tabelle
Versuchsbeschreibung:
Aufbau:
Das Perimeter wird in einem abgedunkelten Raum aufgebaut. Die Abdunklung ist notwendig um die Adaptation der Probanden zu beschleunigen. Sowohl die Funkfernsteuerung als auch das Lasermodul wird mit Spannung versorgt.
Beschreibung der Durchführung:
Der Proband wird über die bevorstehende Untersuchung unterrichtet. Als allererstes wird der Blinde Fleck ,,abgetastet" um dem Probanden die folgende Durchführung näher zu bringen. Nach und nach werden einzelne Punkte auf dem Schirm abgetastet und der Proband muß deutlich machen ob er/sie den Lichtpunkt sieht oder nicht. Wenn der Proband den Lichtpunkt noch nicht erkennt, fahre ich mit dem Lichtpunkt die Gradeinteilung in Richtung des Zentrums entlang.
Je nachdem an welcher Gradeinteilung der Proband den Leuchtpunkt erkennt wird das Ergebnis in das vorhanden Schema eingetragen.
Nach Abtasten aller Gradpunkte verbindet man diese auf dem Schema, und erhält das Gesichtsfeld des Probanden.
3.3.1 Probleme bei der Durchführung:
Folgendes Problem trat während den Untersuchungen am häufigsten auf:
- der Fixationsverlust der Probanden.
Dieser Fixationsverlust ist auf Ermüdungserscheinungen des Auges zurückzuführen.
Da das linke Auge während der Untersuchung abgedeckt war, bewegte sich dieses automatisch. Dadurch verloren einige Probanden die Fixation des Mittelkreuzes.
Außerdem wurde von mir die Adaptationszeit, wegen Zeitdruck, oft unterschritten.
Ich konnte einen Großteil der Untersuchungen nur in der Schule während meiner Biologie - Stunden durchführen. Nachdem ich das Perimeter wieder Zuhause aufgebaut und neu justiert hatte, führte ich weitere 20 Untersuchungen durch.
Insgesamt untersuchte ich 40 Probanden.
3.4 Ergebnisse der Perimetrie.
Um die Perimetrie in der Durchführung zu beschleunigen wählte ich 8 Punkte, plus 2 Punkte um den Blinden Fleck zu lokalisieren, aus.
Die Punkte lagen bei: 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315°.
Um den Blinden Fleck zu lokalisieren, fuhr ich von 0° in Richtung Zentrum entlang, so lang bis der Proband den Punkt nicht mehr erkannte.
Die meisten Blinden Flecken erstreckten sich von 22° bis 17/18°.
Nachdem der Blinde Fleck lokalisiert war, begann ich die anderen 8 Punkte nacheinander zu lokalisieren.
Folgende Höchst- und Tiefstwerte ergaben sich auf den einzelnen Achsen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Gradangaben der einzelnen Achsen des Idealgesichtsfeldes liegen bei: ( rechtes Auge eines 20 Jährigen, gesunden Menschen )
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.Auswertung der Ergebnisse:
Ich habe mich zu einer Unterteilung der Ergebnisse nach der Größe des Gesichtsfeldes entschieden, da ich als Schüler nicht in der Lage bin, eine genaue Diagnose der Einschränkungen zu stellen.
Als erstes unterteile ich die Schemata in vier Kategorien:
1. Dem Idealgesichtsfeld am Ähnlichsten
2. Mittelschwere Abweichungen
3. Grobe, auffallende Abweichungen.
Zur Kategorie 1. zählen insgesamt 12, Kategorie 2 insgesamt 18 und zur letzten Kategorie ( Kategorie 3) 10 Schemata.
Kategorie 1.: ( Dem Idealgesichtsfeld am Ähnlichsten )
Die Abweichungen dieser Kategorie sind sogar besser als das Idealgesichtsfeld.
Diese treten vorzugsweise nasal und im Bereich zwischen der 135°-Achse und der 45°-Achse auf.
In diesen 90°, in denen die Abweichungen auftraten, lagen die Werte bei durchschnittlich 77.5°. Damit liegen diese Werte ( Idealwerte bei ca. 55° ) 22.5° darüber.
Kategorie 2.:( Leichte Abweichungen )
Zur Kategorie 2. ist zu sagen dass die Abweichungen gegenüber dem Idealgesichtsfeld nur minimal sind. In einigen wenigen Fällen sind die Ergebnisse sogar besser als bei dem Idealgesichtsfeld.
Wenn überhaupt Einschränkungen auftreten, treten diese im Bereich der Nase also nasal auf. Dies kann durch eine veränderte Lage des Augapfels in der Augenhöhle oder durch Adaptationsfehler zurückzuführen sein.
Der Durchschnittswert im Bereich der 45°-Achse und 135°-Achse liegt bei 42°. Dieser Wert von 42° kommt dem Idealgesichtsfeld am Nächsten.
Kategorie 3.: (Grobe, auffallende Abweichungen )
Wie auch bei den anderen beiden Kategorien treten die Abweichungen nasal und vor allem im Bereich der 45°-Achse und 135°-Achse auf.
Der Durchnittswert liegt hier bei 30°. Der Idealwert liegt bei 45° - 50°.
Diese Ergebnisse sind wohl auf eine verminderte Empfindlichkeit der Netzhautrezeptoren zurückzuführen.
5. Schlußbetrachtung:
Ich bin mit den Ergebnissen der Perimetrie - Untersuchung sehr zufrieden. Mit Hilfe der Literatur konnte ich natürlich keine Diagnose stellen, konnte aber aufzeigen, inwieweit einzelne Faktoren auf die Ergebnisse Einfluß nahmen.
Mit mehr Fachwissen in Elektronik und einem größerem Budget hätte ich das Perimeter technisch raffinierter bauen können. Dazu hätte ich eine digitale Ansteuerkarte für Schrittmotoren gebraucht. Mit dieser, an einen PC angeschlossen, kann man die einzelnen Takte aufzeichnen und danach mit einem Grafikprogramm auswerten.
6. Nachwort:
Die größte Herausforderung an dieser Facharbeit war der Bau des Perimeters. Dies und das Erlangen von brauchbaren Ergebnissen waren meine Ziele.
Ich glaube sagen zu können, dass ich meine diese erreicht habe.
Der praktische Teil mit dem Bau des Perimeter bereitete mir die größten Sorgen, da ich lange für die volle Funktionstüchtigkeit benötigte.
Ein weiteres Problem war die Beschaffung von Quellen, sogar das Internet gab zu diesem Thema nicht viel preis.
In der Universitäts - Bibliothek fand ich dann doch noch einige Bücher, auch wenn sie ein wenig veraltet waren.
7. Begriffserklärungen:
Quellenverzeichnis:
1 . Augenheilkunde, Grehn-Leydecker, 26. Auflage aus dem Springer Verlag
2 . Allgemeine Psychologie - Experimentalpsychologische Grundlagen, 2. Auflage, Giselher Guttmann, WUV Universitätsverlag
3 . Einführung in die Psycholgie der Wahrnehmung, Werner Wittling, Hoffmann und Campe Verlag
4 . Wahrnehmung, Jörg - Peter Ewert und Sabine Beate Ewert, Quelle&Meyer Verlag
5 . Schüler - Duden ,,Die Biologie", 3. Auflage
6 . Pschyrembel - Klinisches Wörterbuch, 257. Auflage, de Gruyter Verlag
7 . Pathophysiology - Concepts of alterd health systems, fourth edition, Carol Mattson Porth, J.B. Lippincott Company
8 . http://iva.uniulm.de/MEDIZIN/Physiologie/PHYSIOLSEMINAR/GESICHTSSINN/Sehbahn/ SEHBAHN.html#gesichtsfeld
[...]
1 Glaukom (gr. Grau-blau) sog. Grüner Star. Sammelbezeichnung für verschiedene Erkrankungen des Auges, die zu einer vergrößerten Excaviato papillae nervi optici mit entsprechendem Gesichtsfeldausfall führen. Häufigste Erblindungsursache in Industrieländern.
2 Hemianopsie Halbseitenblindheit mit Ausfall einer Hälfte des Gesichtsfeldes
3 Skotom (gr. Skotos - Dunkelheit ) umschriebener Gesichtsfeldausfall; Empfindlichkeitsherabsetzung an einer Stelle innerhalb des Gesichtsfeldes
4 deutsche Übersetzung des Zitates: ,,Definition von Perimetrie und des Gesichtsfeldes" Die Perimetrie ist als Messung der visuellen Funktionen des Auges an topographisch ausgerichteten Orten des Gesichtsfeldes zu verstehen. Das Gesichtsfeld ist der Äußere Bereich in dem der Beobachter, mit fixiertem Blick, eine visuelle Stimulation entdecken kann.
5 Zentralskotom Gesichtsfeldausfall bei Neuritis nervi optici
6 Läsionen Schädigungen, Verletzungen, Störung
7 OCTOPUS Bezeichnung eines Computerperimeters
8 Fieldmaster,siehe7
9 Isoptere Abstand der Ringe die sich um die Fovea ziehen
10 Fovea Augenhintergrund
11 Lambertsches Gesetz
12 Adaptationszeit Anpassung an verschiedene Leuchtdichten ( Leuchtstärke )
13 Refraktion Lichtbrechung, beim menschlichen Auge die Beziehung des Gesamtbrechungszustandes aller opt. Medien zur Achsenlänge des Auges
14 Ektasien Erweiterungen von Hohlorganen, hier das Auge
15 Fundus, occuli Augenhintergrund
Häufig gestellte Fragen
Was ist Perimetrie und welche Geschichte hat sie?
Die Perimetrie ist die Bestimmung des Gesichtsfeldes. Die Geschichte lässt sich in Entwicklungen bis 1944 und spätere Entwicklungen ab 1976 unterteilen, wobei die Struktur und Funktionen der Augenuntersuchung von Bedeutung sind. Wichtige frühe Erkenntnisse stammen von Bjerrum, Roenne, Henschen, Wilbrand und Holmes.
Wer waren wichtige Wissenschaftler in der frühen Entwicklung der Perimetrie?
Im Altertum waren Euklid, Ptolemäus, Demianos, Heliodoros von Larissa und Galen führend. Hippokrates diagnostizierte bereits Hemianopsie. Später entdeckte Mariotte den Blinden Fleck, Boerhouve definierte das Skotom, und Young sowie Purkinje erkannten die Außengrenzen des Gesichtsfeldes.
Welche Gesichtsfeldstörungen erkannte von Graefe?
Von Graefe erkannte konzentrische Gesichtsfeldeinschränkungen, Vergrößerung des Blinden Fleckes, Zentralskotom sowie bitemporale und binasale Ausfälle.
Was ist der Unterschied zwischen Campimetrie und Perimetrie?
Ursprünglich war Campimetrie der Oberbegriff. Perimetrie umfasste das Ausmessen der Aussengrenzen, während Skotomie die Abgrenzung blinder Gebiete beschrieb. Heute schließt Perimetrie alle Untersuchungsmethoden ein. Campimetrie verwendet eine flache Ebene, Perimetrie einen Kreisbogen oder eine Halbkugel.
Was sind die "IPS" International Perimetric Standards?
Die IPS wurden 1978 definiert und beschreiben Perimetrie als Messung der visuellen Funktionen an topographisch ausgerichteten Orten im Gesichtsfeld. Das Gesichtsfeld ist der Bereich, in dem das fixierende Auge visuelle Reize erkennen kann.
Was ist das Gesichtsfeld und wie wird es untersucht?
Das Gesichtsfeld ist der Bereich der Außenwelt, den man bei ruhiggestelltem Auge wahrnimmt. Es ist horizontal ausgedehnter (150 Grad) als vertikal (130 Grad). Es wird mit einem Perimeter untersucht, wobei konstante Bedingungen eingehalten werden müssen.
Was sind die Unterschiede zwischen kinetischer und statischer Perimetrie?
Bei der kinetischen Perimetrie (Isopterenperimetrie) wird eine Lichtmarke von der Peripherie ins Zentrum bewegt, während die untersuchte Person einen Punkt fixiert. Die statische Perimetrie (Profilperimetrie) verwendet Lichtmarken, die an bestimmten Punkten aufleuchten und heller werden, um die Reizschwelle zu ermitteln.
Was ist das Goldmann-Perimeter und welche Anforderungen stellte Goldmann an ein Perimeter?
Das Goldmann-Perimeter ist ein Gerät zur Durchführung der Perimetrie. Goldmann forderte u.a. konstante Ausleuchtung des Perimeterhintergrundes, konstante Verhältnisse bezüglich der Helligkeit der Testmarke zum Hintergrund, konstante Entfernung des Auges zur Perimeterfläche und die Möglichkeit zur Fixationskontrolle.
Was sind Refraktionsskotome?
Refraktionsskotome sind Gesichtsfeldausfälle, die durch Erhebungen und Ektasien des Fundus verursacht werden.
Was ist der Bjerrum - Schirm ( Tangent Screen) und welche Vorteile bietet er?
Der Bjerrum - Schirm ( Tangent Screen) ist eine Methode zur Gesichtsfelduntersuchung, die sich besonders für Patienten mit reduzierter Konzentration und zur Suche nach kleinen parazentralen Skotomen eignet. Sie bietet eine hohe Flexibilität und die Möglichkeit einer direkten Untersuchung durch den Arzt.
Wie wurde das Perimeter im praktischen Teil der Facharbeit aufgebaut?
Der Projektionsschirm wurde aus einem mit Japanpapier beklebten Luftballon gefertigt. Ein Laserpointer wurde auf einer drehbar gelagerten Halterung befestigt und über Modellbau-Servos und eine Funkfernsteuerung gesteuert.
Welche Probleme traten beim Aufbau des Perimeters auf?
Probleme gab es bei der Ansteuerung der Achsen. Zuerst wurden Synchronmotoren und Schrittmotoren ausprobiert, bevor Modellbau-Servos erfolgreich eingesetzt wurden.
Wie wurde die Perimetrie durchgeführt?
Der Proband fixierte mit dem zu untersuchenden Auge das Mittelkreuz, und einzelne Punkte auf dem Schirm wurden abgetastet. Der Proband musste angeben, ob er den Lichtpunkt sah oder nicht. Die Ergebnisse wurden in ein Schema eingetragen.
Welches Problem trat bei der Durchführung der Perimetrie am häufigsten auf?
Der häufigste auftretende Problem war der Fixationsverlust der Probanden, der auf Ermüdungserscheinungen des Auges zurückzuführen ist.
Wie wurden die Ergebnisse der Perimetrie ausgewertet?
Die Schemata wurden in drei Kategorien unterteilt: Dem Idealgesichtsfeld am ähnlichsten, mittelschwere Abweichungen und grobe, auffallende Abweichungen. Die Abweichungen wurden nach ihrer Größe und Lage analysiert.
- Quote paper
- Ernst Hell (Author), 1999, Perimetrei-Bestimmung des Gesichtsfeldes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97366