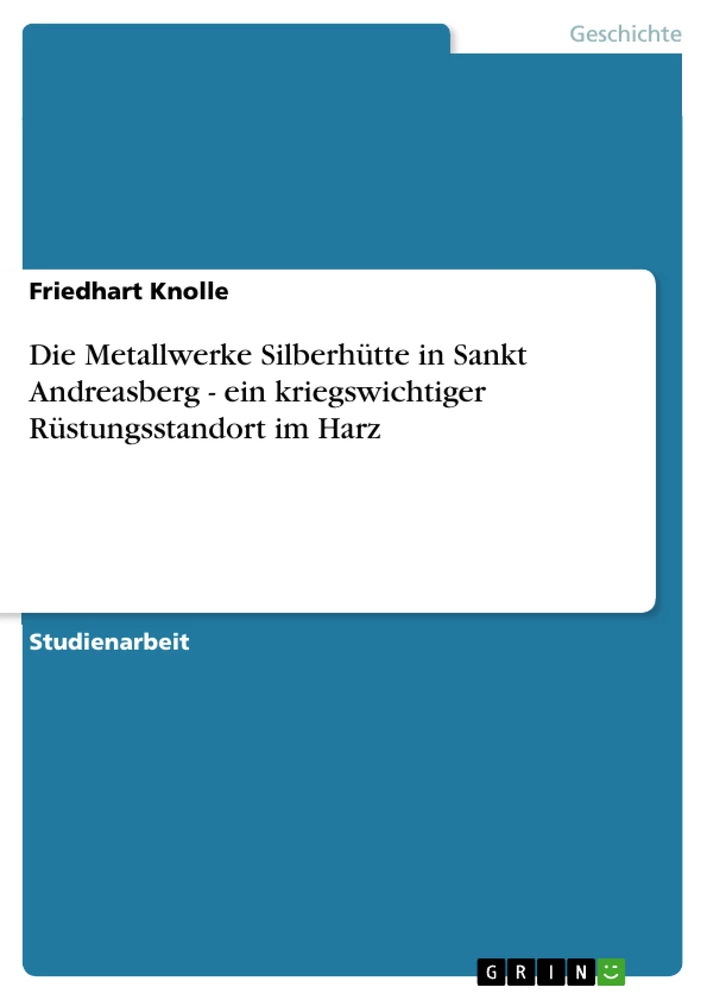Der verzweigte Zwangsarbeiter-Lagerkomplex im Umfeld des Werkes Tanne in Clausthal-Zellerfeld ist mit über 2000 Zwangsarbeitern der größte im Westharz. Diese Tatsache ist aufgrund der Kriegsrelevanz des dortigen Sprengstoffwerkes, das eines der größten des Dritten Reiches war, nicht verwunderlich.
An zweiter Stelle der Liste der größten Zwangsarbeiterlager im Westharz folgen die Lager der Metallwerke im Sankt Andreasberger Ortsteil Silberhütte.
Inhaltsverzeichnis
- Sankt Andreasberg als Rüstungsstandort
- Zur Entstehungsgeschichte des Werkes
- Das Werk I
- Das Werk II
- Das Werk III
- Kriegsende
- Umwelteinflüsse der Werke
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte der Metallwerke Silberhütte in Sankt Andreasberg während des Zweiten Weltkriegs (1934-1945) mit Fokus auf deren Rolle als Rüstungsstandort und die damit verbundenen Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich des Einsatzes von Zwangsarbeitern und der Umweltbelastung.
- Die Metallwerke Silberhütte als Rüstungsbetrieb im Dritten Reich
- Der Einsatz von Zwangsarbeitern in den Werken
- Die Produktion von Munition und Rüstungsgütern
- Die Nachkriegszeit: Demontage und Umweltschäden
- Die soziale und ökologische Folgen der Rüstungsproduktion
Zusammenfassung der Kapitel
Sankt Andreasberg als Rüstungsstandort: Dieser Abschnitt beschreibt die Bedeutung von Sankt Andreasberg als Rüstungsstandort im Zweiten Weltkrieg, wobei insbesondere die Größe der Zwangsarbeiterlager im Vergleich zu anderen Standorten im Westharz hervorgehoben wird. Die Anzahl der Zwangsarbeiter in den Metallwerken Silberhütte wird detailliert aufgeführt, und es wird auf die kriegswichtige Produktion von Munition und anderen Rüstungsgütern hingewiesen. Der Abschnitt stellt die drei kriegswichtigen Metallwerke in Sankt Andreasberg vor und legt den Grundstein für die detailliertere Betrachtung der einzelnen Werke in den folgenden Kapiteln. Die Erwähnung der Firma E. Leibolds Nachf. und ihrer Produktion von Steuerungsinstrumenten für U-Boote verdeutlicht die breite Palette der Rüstungsproduktion im Ort.
Zur Entstehungsgeschichte des Werkes: Dieses Kapitel beleuchtet die Gründung und den Aufbau der Metallwerke Silberhütte AG. Es beschreibt die Verlagerung der Firma Harkort-Eicken-Stahl GmbH von Hagen nach Sankt Andreasberg und die Namensänderung in "Metallwerke Silberhütte GmbH". Die Akquisition von Grundstücken und Gebäuden von verschiedenen Eigentümern wird detailliert dargestellt, ebenso wie die anfängliche Tarnung der eigentlichen Rüstungsproduktion durch die Behauptung der Herstellung von Jagdpatronen und Stahlbooten. Die Verpachtung des Werkes III an die Schmiedag AG wird ebenfalls erläutert, und die Belegschaftszahlen zum 1. April 1945 verdeutlichen den Umfang des Unternehmens. Die Beschreibung der Täuschungsmanöver im Jahresabschluss 1936 unterstreicht die Bemühungen um Geheimhaltung der tatsächlichen Produktion.
Das Werk I: Das Kapitel konzentriert sich auf Werk I, die Produktionsstätte für Infanteriemunition. Es beschreibt den Standort, den Produktionsprozess (Hülsenfertigung, Verfüllung mit Treibsätzen, Geschossaufziehen und Zünder einpressen) und die Wahrscheinlichkeit der Verwendung von Nitrozellulose. Obwohl die Produktionszahlen unvollständig sind, wird die stetig steigende Nachfrage der Obersten Heeresleitung und somit eine wesentlich höhere Produktionsmenge als die bekannten 16.562.000 "gezogenen Erzeugnisse" aus dem Jahr 1938 deutlich gemacht. Die Beschreibung des Produktionsprozesses gibt Einblick in die Arbeitsabläufe und Technologien im Werk.
Das Werk II: Dieses Kapitel behandelt Werk II, zunächst Produktionsstätte für Ladestreifen für Gewehrmunition, später hauptsächlich Unterkunft für russische Zwangsarbeiter. Der frühere Betrieb als Bauholz- und Kistenfabrik wird erwähnt, ebenso der Brand vor 1920 und die Verlagerung der Ladestreifenproduktion nach Werk I nach Beginn des Russlandfeldzuges. Der Fokus liegt auf dem Wandel der Funktion des Werkes und dessen Nutzung zur Unterbringung von Zwangsarbeitern. Der heutige Eigentümer des Geländes wird genannt, was einen Bezug zur Gegenwart herstellt.
Das Werk III: Dieses Kapitel widmet sich Werk III im Sperrluttertal, welches sich auf die Herstellung von 7,5 und 10,5 cm-Geschosshülsen (Kartuschen) spezialisierte. Die Beschreibung der Rohmaterialanlieferung (Stahl von Hoesch in Dortmund), der Verarbeitungsschritte (Anwärmen, Schmieden, Sägen, Ziehen, Gewindeschneiden) und der Verwendung von Teeröl zum Erwärmen des Stahls liefert detaillierte Einblicke in die Produktionsabläufe. Die Umweltbelastung durch die Einleitung von Zyankali in die Sperrlutter wird ebenfalls thematisiert und durch die erwähnte Korrespondenz mit den Wasserbehörden belegt. Die Lieferung der fertigen Hülsen an die Heeresmunitionsanstalt nach Kummersdorf wird als Hinweis auf die weitreichende Bedeutung der Produktion hervorgehoben.
Kriegsende: Der Abschnitt skizziert die Ereignisse nach Kriegsende: Räumung und Plünderung der Werke, Demontage durch die Alliierten und die Delaborierung der Treibmittel. Die Sanierung der Altlast im Nationalpark Harz wird erwähnt, und die Liquidation der Hoesch AG und die Gründung der Industriewerke AG werden im Kontext der Entflechtung der deutschen Schwerindustrie dargestellt. Der Kauf der Werke I und III durch Walter Eckold wird als ein wichtiger Schritt in der Nachkriegsgeschichte der Werke erwähnt, ebenso wie die Lagerung von Dynamit und die Nutzung eines Werksbunkers durch die Britische Rheinarmee. Der Gemeindefriedhof mit Gräbern von Opfern des Krieges dient als Mahnung an die Opfer des Systems.
Umwelteinflüsse der Werke: Das Kapitel fasst die Ergebnisse der Umweltgefährdungsuntersuchungen der Firma Fichtner zusammen. Die Ergebnisse der Bodenproben und der Nachweis von Nitrozellulose als rüstungsspezifische Kontamination verdeutlichen die langfristigen Umweltauswirkungen der Rüstungsproduktion. Die Untersuchung wurde vom Niedersächsischen Umweltministerium in Auftrag gegeben, was die Bedeutung der Problematik aufzeigt.
Schlüsselwörter
Metallwerke Silberhütte, Sankt Andreasberg, Rüstungsproduktion, Zweiter Weltkrieg, Zwangsarbeit, Munition, Umweltbelastung, Hoesch AG, Schmiedag AG, Nachkriegszeit, Altlasten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Geschichte der Metallwerke Silberhütte in Sankt Andreasberg (1934-1945)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Geschichte der Metallwerke Silberhütte in Sankt Andreasberg während des Zweiten Weltkriegs (1934-1945), mit besonderem Fokus auf deren Rolle als Rüstungsstandort und den damit verbundenen Folgen, wie Zwangsarbeit und Umweltbelastung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Metallwerke Silberhütte als Rüstungsbetrieb im Dritten Reich, den Einsatz von Zwangsarbeitern, die Produktion von Munition und Rüstungsgütern, die Nachkriegszeit mit Demontage und Umweltschäden sowie die sozialen und ökologischen Folgen der Rüstungsproduktion. Die einzelnen Werke (I, II und III) werden detailliert beschrieben, inklusive ihrer jeweiligen Produktionsprozesse und der Umweltbelastung durch diese.
Welche Werke werden untersucht?
Die Arbeit untersucht drei Werke: Werk I (Infanteriemunition), Werk II (ursprünglich Ladestreifen, später Unterkunft für Zwangsarbeiter) und Werk III (Herstellung von Geschosshülsen). Jedes Werk wird in einem separaten Kapitel detailliert beschrieben, inklusive seiner Produktionsabläufe und seiner Bedeutung im Kontext des Zweiten Weltkriegs.
Welche Rolle spielte Zwangsarbeit?
Die Arbeit beleuchtet den Einsatz von Zwangsarbeitern in den Metallwerken Silberhütte. Die Anzahl der Zwangsarbeiter wird detailliert dargestellt, insbesondere im Zusammenhang mit Werk II, das später hauptsächlich als Unterkunft für russische Zwangsarbeiter diente. Die Arbeit hebt die Bedeutung der Zwangsarbeiter für die Rüstungsproduktion hervor und stellt diese in den Kontext der Gesamtzahl der Zwangsarbeiter im Westharz.
Welche Art von Rüstungsgütern wurden produziert?
In den Metallwerken Silberhütte wurden verschiedene Rüstungsgüter produziert, darunter Infanteriemunition (Werk I), Ladestreifen für Gewehrmunition (Werk II, anfänglich) und 7,5 und 10,5 cm-Geschosshülsen (Werk III). Zusätzlich wird die Produktion von Steuerungsinstrumenten für U-Boote durch die Firma E. Leibolds Nachf. in Sankt Andreasberg erwähnt.
Welche Umweltauswirkungen hatte die Rüstungsproduktion?
Die Rüstungsproduktion hatte erhebliche Umweltauswirkungen, insbesondere durch die Einleitung von Zyankali in die Sperrlutter (Werk III) und die Kontamination des Bodens mit Nitrozellulose. Die Arbeit beschreibt die Ergebnisse von Umweltgefährdungsuntersuchungen und die damit verbundenen Sanierungsmaßnahmen im Nationalpark Harz.
Was geschah nach dem Zweiten Weltkrieg?
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Werke geräumt, geplündert und von den Alliierten demontiert. Die Arbeit beschreibt die Delaborierung der Treibmittel, die Sanierung der Altlasten, die Liquidation der Hoesch AG und die Gründung der Industriewerke AG. Der Kauf der Werke I und III durch Walter Eckold wird ebenfalls erwähnt. Der Gemeindefriedhof mit Gräbern von Kriegsopfern dient als Mahnung.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Quelle der Informationen ist nicht explizit in dem gegebenen Text genannt. Es wird jedoch auf die Firma Fichtner im Kontext von Umweltgefährdungsuntersuchungen und auf die Korrespondenz mit den Wasserbehörden im Kontext der Umweltbelastung durch Werk III Bezug genommen. Die Zahlen zu Produktionsmengen und Belegschaftsstärke deuten auf eine Nutzung von Archiven und Produktionsunterlagen hin.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen könnten in lokalen Archiven in Sankt Andreasberg, im Niedersächsischen Landesarchiv und möglicherweise in den Archiven der beteiligten Firmen (z.B. Hoesch AG, Schmiedag AG) zu finden sein.
- Citar trabajo
- Friedhart Knolle (Autor), 2000, Die Metallwerke Silberhütte in Sankt Andreasberg - ein kriegswichtiger Rüstungsstandort im Harz, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97375