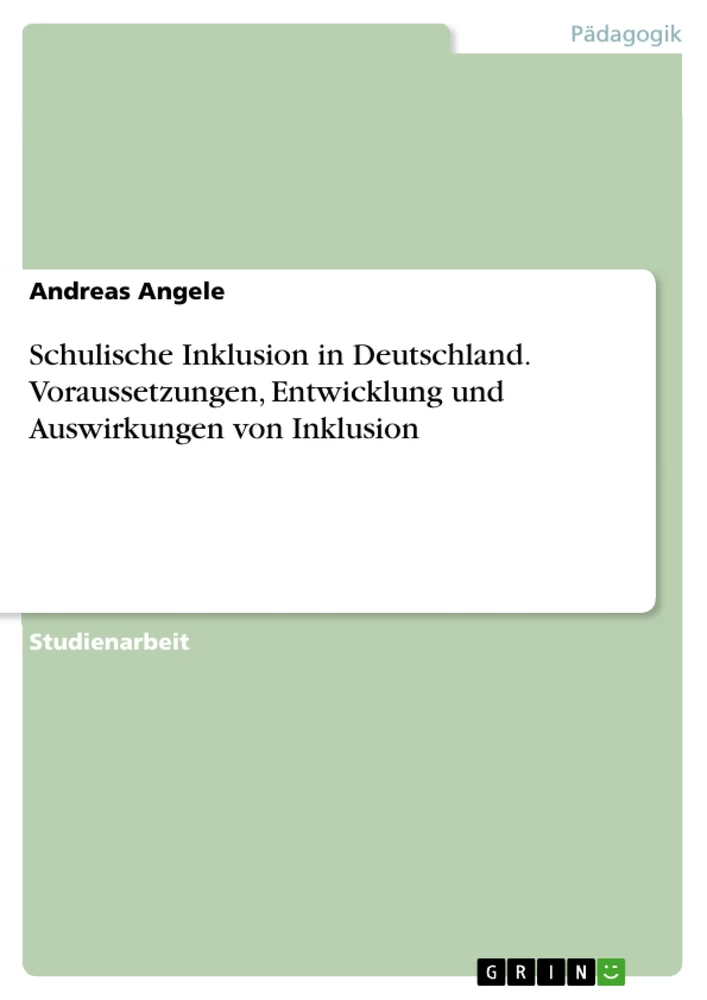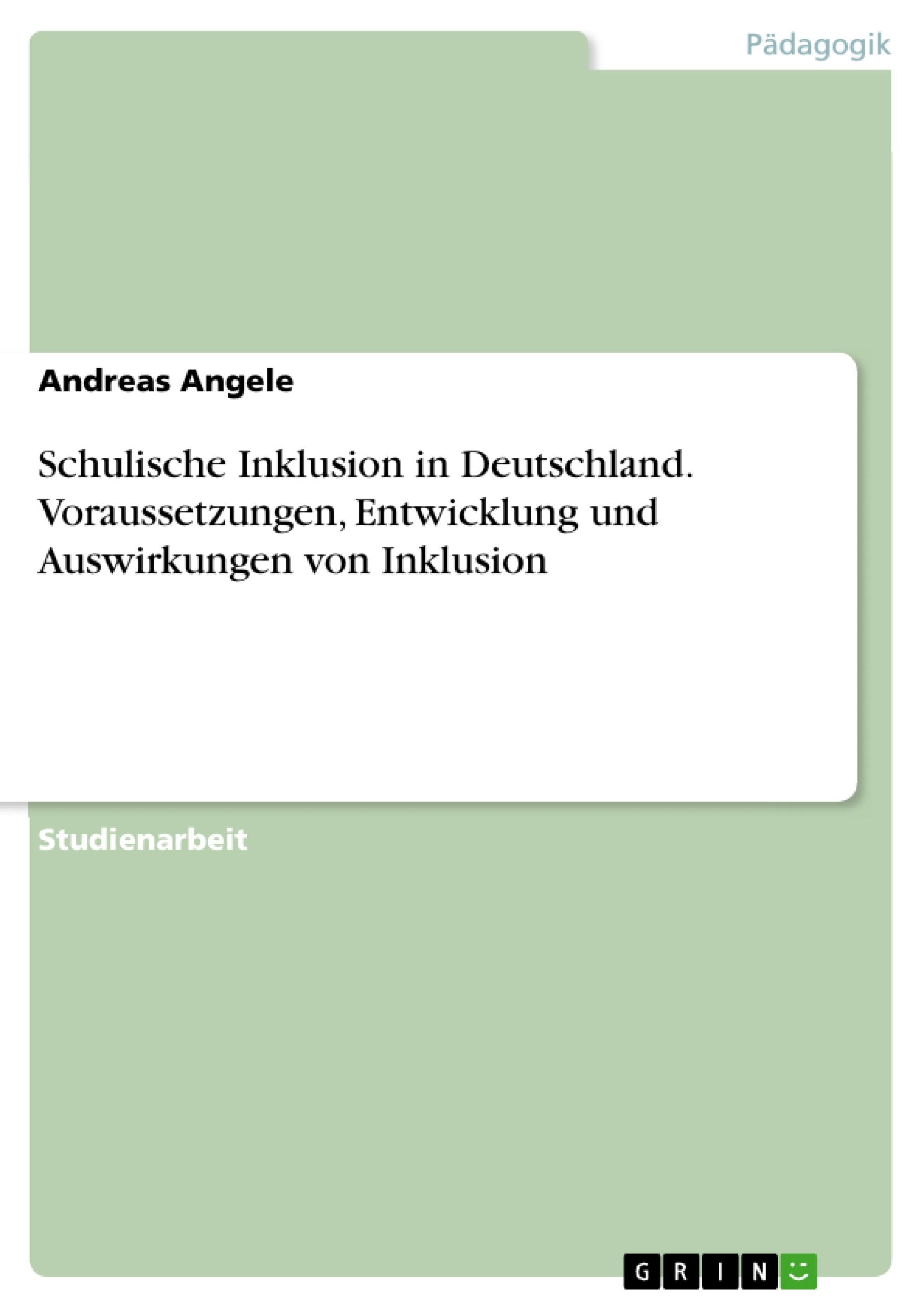Diese Arbeit wurde nach der Methode des Recherchierens angefertigt und befasst sich mit der Inklusion von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Schule. Inklusion ist zurzeit deshalb so interessant, da sich Deutschland aktuell in einem Wandel des Schulsystems befindet. Ziel der Arbeit ist es, die aktuelle Situation der schulischen Inklusion in Deutschland aufzuzeigen. Diese Studienarbeit befasst sich hier insbesondere mit der Situation in Baden-Württemberg.
Hierfür wird zunächst auf den Begriff der Inklusion eingegangen und dessen rechtliche Bedeutung erklärt. Anschließend folgen Informationen über die rechtliche Lage in Baden-Württemberg. Im Anschluss daran wird auf die verschiedenen Voraussetzungen, Entwicklungen und Auswirkungen bezüglich der Inklusion eingegangen. Hiermit wird ein Bezug zur Praxis hergestellt.
Es ist normal, verschieden zu sein. Es gibt keine Norm für das Menschsein. Mit diesen Worten eröffnete der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker 1993 die Tagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte e.V. in Bonn. Schon vor über 35 Jahren sprach Weizsäcker von Inklusion und dem Verständnis, nicht zwischen Menschen mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf zu unterscheiden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inklusion
- Ziele und Aufgaben der Inklusion
- Rechtliche Grundlagen
- Grundgesetz
- UN-Behindertenrechtskonvention
- Inklusion in der Praxis
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Voraussetzungen für Inklusion
- Entwicklungen der Inklusion
- Auswirkungen der Inklusion
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit beschäftigt sich mit der Inklusion von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Schule. Sie beleuchtet die aktuelle Situation der schulischen Inklusion in Deutschland, insbesondere in Baden-Württemberg, und zeigt die rechtlichen Grundlagen, Voraussetzungen und Auswirkungen der Inklusion auf.
- Der Begriff Inklusion und dessen Bedeutung
- Rechtliche Rahmenbedingungen für Inklusion
- Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung von Inklusion
- Entwicklungen und Auswirkungen der Inklusion in der Praxis
- Zukünftige Perspektiven für die Entwicklung der Inklusion
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Inklusion ein und erläutert den Fokus der Studienarbeit. Sie beleuchtet die Bedeutung von Inklusion in der Gesellschaft und die aktuelle Situation im deutschen Schulsystem.
Inklusion
Dieses Kapitel behandelt den Begriff Inklusion und seine Abgrenzung zum Begriff Integration. Es beleuchtet die Ziele und Aufgaben der Inklusion sowie die rechtlichen Grundlagen im Grundgesetz und der UN-Behindertenrechtskonvention.
Inklusion in der Praxis
Dieser Abschnitt widmet sich der konkreten Umsetzung von Inklusion in Baden-Württemberg. Er beleuchtet das Schulgesetz des Landes, die Voraussetzungen für Inklusion und die Entwicklungen in der Praxis. Außerdem werden die Auswirkungen der Inklusion auf die Schule und die Gesellschaft diskutiert.
Fazit und Ausblick
Das Kapitel „Fazit und Ausblick“ fasst die Erkenntnisse der Studienarbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Inklusion.
Schlüsselwörter
Inklusion, sonderpädagogischer Förderbedarf, Integration, Schulgesetz Baden-Württemberg, UN-Behindertenrechtskonvention, Grundgesetz, Gleichbehandlung, Selbstbestimmung, Chancengleichheit, Teilhabe, Bildung, Schule, Gesellschaft, Entwicklung, Auswirkungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Inklusion und Integration?
Bei der Inklusion wird das System an die Vielfalt der Individuen angepasst, während Integration oft bedeutet, dass das Individuum in ein bestehendes System eingegliedert wird.
Welche rechtliche Grundlage verpflichtet Deutschland zur Inklusion?
Die wichtigste Grundlage ist die UN-Behindertenrechtskonvention, die ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen fordert.
Wie ist die Lage der Inklusion in Baden-Württemberg?
Die Arbeit beleuchtet das spezifische Schulgesetz von Baden-Württemberg und wie dieses die Voraussetzungen für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf regelt.
Was sind die Voraussetzungen für gelingende schulische Inklusion?
Dazu gehören barrierefreie Infrastruktur, qualifiziertes Personal, kleinere Klassengrößen und eine positive Einstellung zur Vielfalt.
Was bedeutet der Satz "Es ist normal, verschieden zu sein"?
Dieses Zitat von Richard von Weizsäcker unterstreicht das Verständnis, dass Vielfalt keine Ausnahme, sondern der Regelfall der menschlichen Existenz ist.
- Quote paper
- Andreas Angele (Author), 2019, Schulische Inklusion in Deutschland. Voraussetzungen, Entwicklung und Auswirkungen von Inklusion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/973932