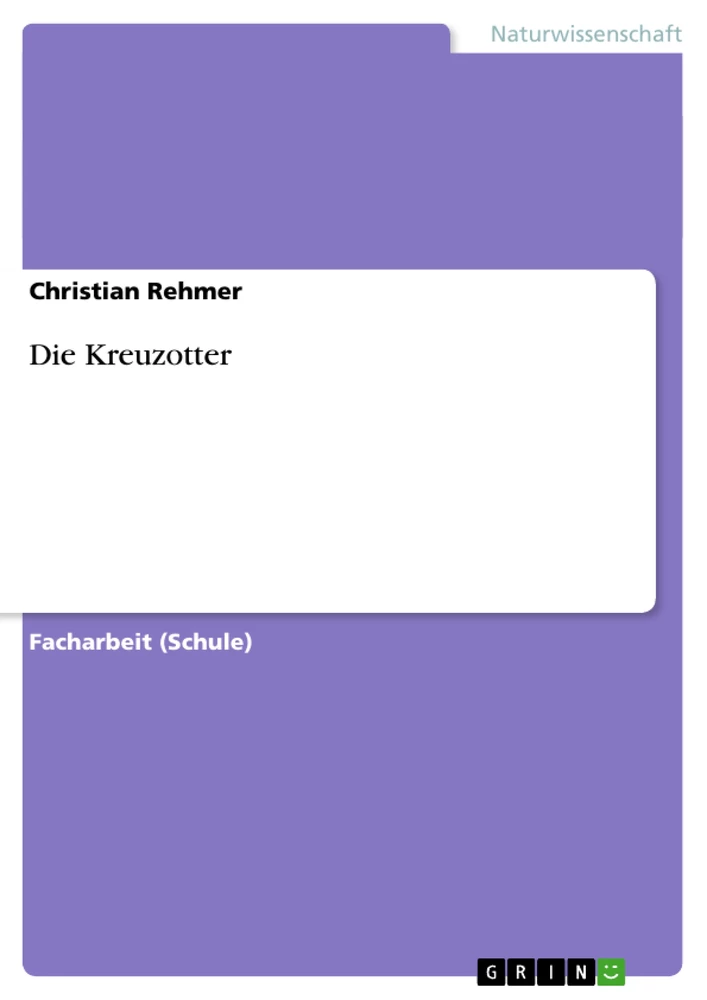Stellen Sie sich vor, Sie wandern durch ein stilles, unberührtes Stück Natur, wo das Rascheln der Blätter und das Zwitschern der Vögel die einzigen Geräusche sind, die die Luft erfüllen – doch unter Ihren Füßen, verborgen im Unterholz, lauert ein Meister der Tarnung: die Kreuzotter. Diese faszinierende Monographie entführt Sie in die verborgene Welt einer der am meisten missverstandenen Schlangen Europas, der <em>Vipera berus</em>. Von ihrer systematischen Einordnung und den subtilen Unterschieden zwischen den Unterarten, wie der Eurasischen, Balkan- und Sachalin-Kreuzotter, bis hin zu detaillierten Körpermerkmalen, die selbst den erfahrensten Naturforschern oft verborgen bleiben, enthüllt dieses Buch ein umfassendes Portrait. Tauchen Sie ein in die Biologie der Kreuzotter, ihren Jahresrhythmus, ihre Lebensweise und ihre ausgeklügelten Jagdtechniken, mit denen sie ihre Beute erlegt. Erfahren Sie alles über das Paarungsverhalten der Kreuzottern, von den Kommentkämpfen der Männchen bis hin zur Geburt der Jungtiere. Entdecken Sie die ökologische Bedeutung dieser Schlange, ihren Lebensraum, ihre Anpassungsfähigkeit und ihre Rolle in der Nahrungskette, während wir gleichzeitig die Bedrohungen beleuchten, denen sie ausgesetzt ist, und die Schutzmaßnahmen, die ergriffen werden müssen, um ihr Überleben zu sichern. Diese Abhandlung ist ein Muss für jeden Naturliebhaber, Biologen, Herpetologen und alle, die mehr über die faszinierende und oft übersehene Welt der Reptilien erfahren möchten. Es werden die ökologischen Aspekte, die Gefährdung und Schutzmaßnahmen, die Biologie, die Körpermerkmale und die systematische Einordnung dieser Giftschlange detailliert beschrieben. Ein umfassender Einblick in das Leben und Überleben der Kreuzotter, beleuchtet durch wissenschaftliche Erkenntnisse und faszinierende Details, erwartet Sie.
Die Kreuzotter
(1) Systematische Einordnung:
Die Kreuzotter (Vipera berus LINNAEUS 1758) ist eine der vier in Mitteleuropa vorkommenden Arten der Familie Viperidae. Die anderen drei sind die Wiesenotter (Vipera ursinii), die Aspisviper (Vipera aspis) und die Sandotter (Vipera ammodytes gregorwallneri). (FRÖHLICH 1987) Als Unterarten sind bekannt: Eurasische Kreuzotter (Vipera berus berus), Balkan-Kreuzotter (Vipera berus bosniensis)und Sachalin-Kreuzotter (Vipera berus sachalinensis). (SCHIEMENZ 1989)
- Stamm: Chordata (Chordatiere)
- Unterstamm: Vertebrata (Wirbeltiere)
- Klasse: Reptilia (Kriechtiere)
- Ordnung: Squamata (Schuppenkriechtiere)
- Unterordnung: Serpentes (Schlangen)
- Familie: Viperidae (Vipern)
- Unterfamilie: Viperinae (Echte Vipern)
- Gattung: Vipera
- Art: Vipera berus (Kreuzotter)
Taxonomische Einordnung nach (GRUBER 1989) und (SCHAEFER 1994).
(2) Körpermerkmale:
Unter den Schlagen sind die Vipern diejenigen, welche im Verhältnis zur Körperlänge den dicksten Körper besitzen. Die Kreuzotter gehört aber noch zu den schlanken Vertretern ihrer Familie. Der Kopf ist nicht sehr deutlich vom Hals abgesetzt. (GRUBER 1989) Beim Männchen ist der Kopf eher lang und schmal, beim Weibchen hingegen im hinteren Teil breiter, so dass sich optisch ein Dreieck bildet. Die Schnauze ist kurz und abgerundet und die Schnauzenkante deutlich ausgebildet, wenn auch nur wenig oder gar nicht erhöht. Das Auge besteht aus einer rötlichen Iris und einer Pupille die tagsüber zu einem senkrechten Schlitz verformt ist. (siehe Foto Seite 6) (SCHIEMENZ 1987)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Länge der Kreuzotter beträgt im Durchschnitt zwischen 60-75 cm, einzelne Individuen können aber auch 85 cm erreichen. (GRUBER 1989) Der Körper des Männchens ist schmaler als der des Weibchens, welches meistens größer ist. Die Schwanzwurzel weißt beim Männchen eine deutliche Verdickung auf, danach verjüngt sich der Schwanz um an seinem Ende in einer feinen Hornspitze auszulaufen. Beim Weibchen ist die Schwanzbasis gleich der Körperbreite und die Verjüngung zur Schwanzspitze hin (ebenfalls feine Hornspitze) verläuft eher kegelförmig. (SCHIEMENZ 1987) Im Verhältnis zum Körper ist der Schwanz eher klein. (FRÖHLICH 1987)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Als typisches Merkmal besitzt die Kreuzotter entlang des Rückens ein dunkles Zickzackband, das in den überwiegenden Fällen deutlich ausgebildet ist. Die Färbung der Oberseite reicht beim Männchen von weißlichen bis hellgrauen Farbtönen und beim Weibchen von bräunlichen bis rötlichen Tönen. Mitunter treten auch schwärzliche (Höllenotter -siehe Foto links) oder rötliche (Kupferotter -siehe Foto oben) Färbungsvarianten auf, bei denen das Zickzackband kaum sichtbar ist. Die Bauchseite zeigt eine graue, graubraune oder schwarze Färbung, mit mehr oder weniger ausgeprägten hellen Flecken. (FRÖHLICH 1987)
Die Kreuzotter, welche bis zu 15 Jahre alt werden kann (SCHIEMENZ 1987), gehört zu den Giftschlangen und besitzt zwei Giftzähne, welche das Gift aus den Drüsen in das Opfertier injizieren, wo es cytotoxisch auf Blut- und Gefäßsystem wirkt. Weitere Charakteristika sind das große und vollständig ausgebildete Stirnschild (Frontale) und die Scheitelschilder (Parietalia). Zwischen Augenunterrand und den neun Oberlippenschildern (Supralabialia) ist eine Reihe von Unteraugenschildchen (Subocularia) zu finden (GRUBER 1989)
(3) Biologie:
- Jahresrhythmus:
Die standorttreue Kreuzotter kann man an günstigen Überwinterungsplätzen nahezu jahrelang antreffen. Das Winterquartier wird von Oktober bis März bezogen und erst wieder verlassen, wenn die Tagestemperaturen auf 3-9 Grad 0 C ansteigen. Die ersten, die man beim Frühlingssonnenbad beobachten kann, sind die Männchen - ca. 1-3 Wochen später folgen die Weibchen. An diesen zumeist südexponierten Hängen verweilen Erstgenannte 3-5 Wochen und Letztere 1-3 Wochen, wo sie sich mit stark abgeflachten Körpern intensiv der Sonneneinstrahlung aussetzen, ohne dabei Nahrung aufzunehmen. (FRÖHLICH 1987) Dies dient der Spermatogenese der Männchen bzw. beeinflusst den Ovarial-Zyklus der Weibchen. (SCHIEMENZ 1987) Ende April bis Ende Mai, im Hochgebirge im Juni nach der ersten Häutung der Kreuzottermännchen, schreiten die Tiere zur Paarung. Diese erfolgt vorwiegend am Tage bei warmer Witterung. Nach der Paarungszeit, welche ungefähr 3-4 Wochen beträgt, wandern alle Kreuzottern in die Sommergebiete ab, welche bis zum Winter ihre Jagdgebiete sein sollen. (FRÖHLICH 1987) Die Weibchen halten sich von Juni bis August/September an sogenannten Brutplätzen auf. Entweder werden auch dort die Eier abgelegt oder das Weibchen wandert zu den Sonnenplätzen des Frühjahrs zurück, da diese näher an einem günstigen Überwinterungsplatz liegen. (SCHIEMENZ 1987) Bis in die ersten Oktobertage hinein werden die 5-18 Jungen zur Welt gebracht.
Durch die sinkenden Temperaturen des Frühherbstes stellen die Tiere ihre Nahrungssuche ein und suchen wieder ihre Winterquartiere auf, in welchen noch eine kurze Besonnung von 1-2 Wochen absolviert wird. In den folgenden Monaten verharren die Tiere in Winterruhe, wobei dies oft unter Vergesellschaftung geschieht. So wurden schon 800 Exemplare zusammen in einem Winterlager gefunden. Auch andere Arten überwintern oft mit der Kreuzotter: Erdkröten (Bufo bufo), Waldeidechsen (Lacerta vivipara), Ringelnattern (Natrix natrix), Blindschleichen (Angius fragilis), Grasfrösche (Rana temporaria); Dies geschieht jedoch nicht aus Geselligkeitsdrang, sondern wegen der optimalen mikroklimatischen Verhältnisse. (SCHIEMENZ 1987)
- Lebensweise:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Kreuzotter ist tags- und dämmerungsaktiv, in den Sommermonaten auch nachtaktiv. Kurz vor Sonnenaufgang kommt sie im Allgemeinen zum Vorschein, verschwindet am späten Morgen, um nachmittags wieder ihren Sonnenplatz aufzusuchen. (FRÖHLICH 1987) Eine Temperatur von 30-33 °C sorgt für optimale Reaktionsverhältnisse (GRUBER 1989), aber bei zu heißem oder windigem Wetter bleibt die Kreuzotter in ihrem Tagesversteck in Steinhaufen, Mäuselöchern oder unter Gestrüpp verborgen. Dagegen kommt sie auch in der kalten Jahreszeit zum Vorschein, wenn der Boden nur gering erwärmt wird. Ihre Bewegungen sind träge und ihr Kriechen relativ langsam. Sie ist eine gute Schwimmerin (GRUBER 1989), aber wendet diese Art der Fortbewegung nur in Ausnahmesituationen wie einer Flucht an. Ihr Sehvermögen ist nur mäßig ausgebildet, dafür ist sie aber in der Lage, die geringste Erschütterung des Bodens wahrzunehmen und die nach einem Giftbiss geflohene Beute mit Hilfe der Zunge durch Aufnahme der Duftspur zu verfolgen. (FRÖHLICH 1987) Im Allgemeinen ist die Kreuzotter als heimlich und scheu zu charakterisieren, denn bei Gefahr tritt sie zuerst die Flucht an und erst wenn sie in die Enge getrieben ist, greift sie an. (GRUBER 1989)
- Nahrung:
Die Hauptnahrung bilden Wühlmäuse (Microtinae), aber auch andere Mausarten. (FRÖHLICH 1987) Selten sind auch Maulwürfe (Talpa europaea), Hamster (Cricetus cricetus), junge Wiesel (Mustela nivalis) sowie junge Siebenschläfer (Glis glis) zu nennen. Junge Vögel, vor Allem Nestlinge, Eidechsen (Lacertidae) und Blindschleichen (Anguis fragilis) können das Nahrungsangebot noch erweitern. (SCHIEMENZ 1987) Besonders in feuchten Gebieten stehen Braunfrösche (z.B. Rana temporaria, R. arvalis etc.), gelegentlich auch Teichfrösche (Rana ,,esculenta"-Gruppe), sowie Teichmolche (Triturus vulgaris) auf dem Speisezettel. In den Alpen kann dieser noch vom Alpensalamander (Salamandra atra) ergänzt werden.
- Beuteerwerb:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Kreuzotter fängt ihre Nahrung tagsüber durch Auflauern und nachts durch langsames Umherstreifen. Sie nähert sich bis zu 3-6 cm an ihr Beutetier heran, richtet das vordere Drittel ihres Körpers waagerecht S-förmig nach vorn aus und beißt plötzlich zu. Bei entsprechender Ausdauer kann aus dem Anschleichen auch ein Heranschießen werden, falls das Beutetier versucht zu fliehen. Während des Bisses wird der Kopf mit großer Energie nach vorne geworfen, der Kiefer bis zu einem Winkel von 145° geöffnet und die Giftzähne aufgerichtet. Dringen diese in die Beute ein wird durch Muskelbewegung das Gift in die Röhrenzähne transportiert und in die Beute injiziert. Das Gift der Kreuzotter hat nicht nur die Funktion die Beute zu töten, sondern sorgt bereits für eine Vorverdauung. Es gehört zu den Toxalbuminen. (SCHIEMENZ 1987)
Das gebissene Beutetier tritt die Flucht an, beginnt bald zu taumeln und leidet unter erschwerter Atmung, bis es schließlich zusammenbricht und verendet. Diese Zeit kann bei Mäusen zwischen 5 Sekunden und 14 Minuten liegen. Einige Minuten nach dem Biss nimmt die Kreuzotter lebhaft züngelnd die Duftspur des Beutetieres auf, findet dieses in jedem Fall und beginnt es mit dem Kopf voran zu verschlingen. Dies kann bei Mäusen von 10-15g 4-10 Minuten dauern. Frösche und Eidechsen werden nach dem Biss oftmals festgehalten, da das Gift auf Warmblüter eine stärkere Wirkung hat als auf wechselwarme Tiere. (SCHIEMENZ 1987)
- Fortpflanzung:
Nach 3-4 Jahren erhalten Jungottern die Geschlechtsreife. Nach der ersten Häutung der Männchen nach der Winterruhe suchen diese die Weibchen auf (meistens Ende April bis Ende Mai). Kommt es bei der Suche nach einem reproduktiven Weibchen zum Aufeinadertreffen zweier paarungswilliger Männchen, kann es zum Kommentkampf kommen. Bei diesem kommt es zu aggressiven Aktionen, meist in der Nähe von Weibchen. Beide Schlangen richten ihre Vorderkörper aneinander auf, wobei diese S-förmig gebogen werden, beginnen seitwärts rhythmisch zu pendeln, umschlingen und pressen ihre noch auf dem Boden befindlichen Körperabschnitte bis der Schwerpunkt überschritten ist und sie beide umstürzen. Dieser Vorgang kann öfters wiederholt werden. Meist endet der Kampf mit einem gewaltigen Ruck und das unterlegene Männchen flüchtet. Der Sieger kehrt zum Weibchen zurück und fährt mit der Werbung fort. (SCHIEMENZ 1987)
Hat ein Männchen die Spur eines Weibchens geortet, wird ihr züngelnd gefolgt. (Annäherungskriechen) Beim Weibchen angelangt, wird ihr Rücken und ihre Seiten bezüngelt, wobei die Zunge die Haut des Weibchens berührt. (Bezüngeln) Es folgt ein Rückzug mit anschließender Verfolgung (Folge-Rückzug), bis das Männchen schließlich ganz eng an das Weibchen heran kommt, ca. 100 mal/ Minute mit dem Kopf zuckt (Intensiv- Züngeln) und diesen schließlich auf den ihren legt (Orientierung) Dabei wird der Hinterkörper wellenförmig auf dem des Weibchens bewegt, die Schwanzspitze umfasst den Körper des Weibchens bis schließlich das Begattungsorgan hervortritt. Die Kloake wird auf die des Weibchens gepresst (Kloakenpressen), wobei ein Hemipenis in die weibliche Kloake eingeführt wird. (Kopulation) (SCHIEMENZ 1987)
Die Paarung findet meist an warmen Tagen statt und kann zwischen 0,5-2,5 Stunden dauern. Die Ovulation kann beim Weibchen teilweise erst deutlich nach der Kopulation stattfinden, so dass es eigentlich erst im Juni zur Befruchtung kommt. Des weiteren sind Kreuzotterweibchen teilweise nur alle drei Jahre reproduktiv. (SCHIEMENZ 1987)
Gegen August werden an den aufgesuchten Frühjahrssonnenplätzen die Jungottern zur Welt gebracht. Hochträchtige Weibchen sind meistens am verdickten Hinterkörper zu erkennen. Sie richtet während des Geburtsvorganges ihren Schwanz nach oben und entlässt in einer durchsichtigen, schleimigen Eihülle das Jungtier aus ihrer Kloake. Im Gegensatz zu den meisten anderen Schlangenarten sind die Kreuzottern lebendgebärend. Der gesamte Geburtsvorgang dauert bis zu 2,5 Stunden, eine einzelne Eihülle abzulegen hingegen nur wenige Sekunden. Die Jungottern verharren einige Sekunden regungslos, zerreißen dann mit dem Kopf voran die Eihülle und kriechen davon. Ein Wurf kann bis zu 18 Jungtiere enthalten, meistens sind es jedoch 9-10. (SCHIEMENZ 1987) Sie fangen bereits kurze Zeit nach ihrer Geburt mit der Jagd an, während ihre Mutter etwas eingefallen und faltig zurück bleibt.
(GRUBER 1989)
- Fressfeinde:
Zu den natürlichen Feinden gehören von den Säugetieren vor Allem der Iltis (Mustela putorius) und der Igel (Erinaceus spec.), wobei Letzterer keineswegs immun gegen das Gift ist, aber bedingt durch sein Stachelkleid einen nicht zu verachtenden Schutz besitzt. Gelegentlich stellen auch der Fuchs (Vulpes vulpes), Dachs (Meles meles), Wildschweine (Sus scrofa), Steinmarder (Martes foina) sowie Hermelin (Mustela erminea) und Mauswiesel (Mustela nivalis) eine Gefahr für die Giftschlange dar. (SCHIEMENZ 1987)
Für die Kreuzotter droht auch Gefahr aus der Luft. Diese geht vor Allem von Adlern, wie dem Schlangenadler (Circaetus gallicus) oder dem Steinadler (Aquila chrysaetos), sowie Weiß- und Schwarzstorch (Ciconia ciconia, Ciconia nigra) und dem Mäusebussard (Buteo buteo) aus. Diverse andere größere Vogelarten reihen sich in die Liste der Jäger ein. Die Jungottern können sogar schon zur Beute von kleineren Vogelarten wie z.B. Elstern (Pica pica) und Dohlen (Corvus monedula) werden. Auch große Weibchen des See- oder Teichfrosches (Rana ridibunda, Rana esculenta) können Jungottern fressen. (SCHIEMENZ 1987)
Der größte Feind der Kreuzotter ist selbstverständlich der Mensch. Er zerstört beispielsweise durch Trockenlegung von Sümpfen ihre Lebensräume, ist mit seinem intensiven Straßenbau verantwortlich für ihren Straßentod und sorgte in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhundert durch Prämien auf erschlagene Kreuzottern für eine Jagd auf dieses schüchterne Tier, welcher selbstverständlich auch harmlosere Arten, wie zum Beispiel die Blindschleiche (Anguis fragilis), zum Opfer fielen.
(4) Ökologie:
- Habitat:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Als mesophile Schlangenart bevorzugt die Kreuzotter raues Klima mit starken Temperaturschwankungen zwischen dem Tag und der Nacht. Wie alle Reptilien ist sie wärmeliebend, meidet aber trockenheiße (xerotherme) Örtlichkeiten. Ferner benötigt sie Deckung gegen Sichtfeinde und zu starke Sonneneinstrahlung (Insolation), sowie Unterschlupfmöglichkeiten. Beliebte Habitate sind mit Gebüsch bestandene Waldränder, Kahlschläge, Waldschneisen und mit Sträuchern überwucherte Steinrücken, Hänge und Steinbrüche. Erlenbrüche, feuchte Wiesen, Teichgebiete und Moore werden von der Kreuzotter ebenso wie Dünen und Straßenränder angenommen (FRÖHLICH 1987) Im Hochgebirge geht sie bis über die Baumgrenze hinaus (3000 Meter über NN). Sie lebt in den Alpen besonders in der Krummholzzone, auf alpinen Matten, auf mit Strauchwerk bewachsenen Kiesflächen und sogar auf kurzrasigen alpinen Felsfluren, sofern Deckung vorhanden ist. (SCHIEMENZ 1987) Die höchste Populationsdichte weißt die Kreuzotter im mäßig feuchten bis feuchten Mischwald auf. Die Winterquartiere befinden sich zumeist in trockenen dichtbewachsenen Örtlichkeiten. (FRÖHLICH 1987) Diese können in der Nähe der Sommerhabitate oder aber auch weit entfernt von diesen gelegen sein. (SCHIEMENZ 1987)
- Anpassung an den Lebensraum:
Eine spezielle Anpassung an diverse Lebensräume ist bei der Kreuzotter nicht vorhanden. Sie sucht sich ganz gezielt ihr Habitat aus, welches innerhalb eines Jahres durchaus unterschiedlich sein kann. Auf diese Art und Weise entgeht sie einer Anpassung ihrerseits. So werden nach der Hibernation, die Frühjahrssonnplätze aufgesucht. Zur Paarung, zur Jagd im Sommer und zur Brut werden wieder unterschiedliche Plätze aufgesucht, so dass innerhalb eines Jahres durchaus ein Weg von 1500 m zurückgelegt werden kann. (SCHIEMENZ 1987) Das scheue Tier meidet ganz gezielt die Nähe zum, Menschen und kann bei Kontakt erheblich von ihm gestört werden.
- Verbreitung und Arealgrenzen:
Die Kreuzotter ist die am weitesten verbreitete Giftschlange Europas. (GRUBER 1989) Ihr Verbreitungsgebiet ist sehr ausgedehnt und erstreckt sich über 150 Längen- und 28 Breitengrade. Die Westgrenze stellen Frankreich und Großbritannien dar, über das gemäßigte Asien (Sibirien. Mongolei) endet ihr Areal im Osten auf der Insel Sachalin. Nördlich wird das Gebiet von Lappland, südlich von Griechenland und Bulgarien eingegrenzt. In Asien ist die Nord-Süd-Ausdehnung jedoch nicht so groß wie in Europa. Während die Kreuzotter in den nördlichen Breiten auch in niederen Lagen vorkommt, lebt sie im Süden ihres Areals vorwiegend im Gebirge. (SCHIEMENZ 1987)
Westlich von Frankreich ist sie fast in ganz Europa vertreten, wenn man mal von den zu kalten Teilen des Nordens absieht. (SCHIEMENZ 1987)
- Stellung in der Nahrungskette:
Die Kreuzotter ernährt sich ausschließlich von Tieren und gehört daher zu den Konsumenten, genauer zu den Fleischfressern (Carnivora). Auf Grund ihrer allzu geringen Größe, stellt sie aber keineswegs einen Endkonsumenten dar, sondern dient noch diversen anderen Räubern als Beute.
(5) Gefährdung und Schutzmaßnahmen: · Gefährdung:
Den meisten Ländern fällt es schwer eine Giftschlange unter Schutz zu stellen. Die Kreuzotter genießt in den meisten Ländern Europas jedoch dieses Privileg, denn sie ist vielerorts vom Aussterben bedroht bzw. gefährdet. (SCHIEMENZ 1987) In Deutschland wird sie als stark gefährdet eingestuft. Auf weiträumigen Kulturflächen jedoch, ist die Kreuzotter bereits ausgestorben (FRÖHLICH 1987)
Rote Liste Deutschland: (vom NABU)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1- vom Aussterben bedroht 2- stark gefährdet 3- gefährdet
Viel wichtiger als der Artenschutz ist jedoch der Biotopschutz, denn ohne ihre natürlichen Lebensräume kann sich die Kreuzotter nicht wieder erholen. Es ist jedoch sehr schwer, die von einer Kreuzotter bewohnte Fläche zu erkennen, da sie einerseits sehr groß ist und sie des weiteren jahreszeitlich variiert. Es werden drei Gefahrenquellen unterschieden: (SCHIEMENZ 1987)
(1) Eine Zerstörung der Kreuzotter-Habitate resultiert aus der Wandlung von Wäldern, die früher wirtschaftlich genutzt wurden, sich jetzt aber zum Hochwald entwickeln und somit Sonneneinstrahlung auf den Boden ausschließen. Auch das Beseitigen von Feldgehölzen und Feldhecken, der industrielle Steinabbau, sowie die Trockenlegung von Mooren und der Torfabbau derselben, tragen zur Zerstörung der Lebensräume bei. (FRÖHLICH 1987)
(2) Eine gezielte Ausrottung, verbunden mit der Zahlung von Prämien, gehört zwar der Vergangenheit an, aber es werden immer noch viele Kreuzottern von Spaziergängern, Pilzund Beerensammlern erschlagen.
(3) Anhaltende Störungen durch Besucher im Wald bzw. den steigenden Autotourismus -auch in die entlegensten Winkel unserer Natur- beeinträchtigen die Kreuzotter am stärksten. Auch die teilweise schon extreme Zersiedelung der Landschaft trägt negativ zur Habitatzerstörung bei.
- Schutzmaßnahmen:
Heide- und Pfeifengrasbestände sollten nicht mit Gehölzen zuwachsen und Bäume und Büsche bis auf kleinere Gruppen im Winter entfernt werden. Wichtig ist die Erhaltung von Hoch-, Zwischen- und Flachmooren, sowie reich strukturierter sonnenexponierter Waldränder, Waldwege, Schneisen und Dämme. Zusätzlich kann man durch das Anlegen von Steinhaufen noch Wärmeinseln errichten. Des weiteren sorgt das Anlegen von Kleingewässern für einen zusätzlichen Nahrungs- und Jagdraum für die Kreuzotter. (FRÖHLICH 1987)
Eine nicht zu verachtende Aufgabe liegt in der Aufklärungsarbeit unter der Bevölkerung um das Erschlagen der Tiere zu vermeiden, welches durch eine Schlangenphobie hervorgerufen wird. Die Aufklärung sollte verstärkt in Urlaubsgebieten praktiziert werden. Dazu eignen sich einerseits Vortragsabende vor Schülern, Urlaubern und Vereinen, andererseits sollten auch Hinweisschilder direkt im Wald aufgestellt werden, die den Besucher auf das Kreuzottervorkommen aufmerksam machen sollen. (FRÖHLICH 1987)
(6) Literatur:
- Gruber, U., Die Schlangen Europas und rund ums Mittelmeer, Kosmos Gesellschaft der Naturfreunde FranckhÂsche Verlagshandlung, Stuttgart, 1989, Seite 171 ff.
- Fröhlich, G., J. Oertner, S. Vogel, Schützt Lurche und Kriechtiere, VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, Berlin, 1987, Seite 233 ff.
- Schaefer, M., BROHMER FAUNA von Deutschland, Quelle & Meyer Verlag Heidelberg, Wiesbaden, 1994, Seiten IX-X & 557-560
- Schiemenz, H., Die Kreuzotter, A. Ziemens Verlag, Wittenberg Lutherstadt, 1987, Seiten 5- 98
- Schmidt, D., Schlangen, Urania-Verlag, Leipzig - Jena - Berlin, 1989, Seite 161 ff.
- Wehner, R., W. Gehring, Zoologie, Georg Thieme Verlag, Stuttgart - New York, 1990, Seiten 759 & 760
- Microsoft ENCARTA 99 -Enzyklopädie PLUS
- http://www.amphibienschutz.de/rotlist.htm (Seite des NABU)
(7) Bildnachweis:
- Deckblatt Kreuzotter http://www.cix.co.uk
- Seite 1 Kupferotter http://www.meb.uni-bonn.de
- Seite 1 Höllenotter http://www.meb.uni-bonn.de
- Seite 2 2 Kreuzottern http://reptilienwelt.at
- Seite 3 Kreuzotter bei der Jagd http://www.home.plex.nl
- Seite 4 Kreuzotter in Strauch http://www.home.plex.nl
Häufig gestellte Fragen
Was ist die systematische Einordnung der Kreuzotter?
Die Kreuzotter (Vipera berus LINNAEUS 1758) gehört zur Familie Viperidae innerhalb der Ordnung Squamata (Schuppenkriechtiere) und des Stammes Chordata (Chordatiere). Bekannte Unterarten sind die Eurasische Kreuzotter (Vipera berus berus), die Balkan-Kreuzotter (Vipera berus bosniensis) und die Sachalin-Kreuzotter (Vipera berus sachalinensis).
Welche Körpermerkmale kennzeichnen die Kreuzotter?
Kreuzottern haben im Verhältnis zur Körperlänge einen dicken Körper, wobei die Kreuzotter zu den schlankeren Vipern gehört. Männchen haben einen eher langen und schmalen Kopf, Weibchen einen breiteren, dreieckigen Kopf. Typisch ist das dunkle Zickzackband entlang des Rückens. Die Länge beträgt durchschnittlich 60-75 cm.
Wie ist der Jahresrhythmus der Kreuzotter?
Kreuzottern verbringen den Winter in Winterquartieren (Oktober bis März). Im Frühling sonnen sie sich, um die Spermatogenese bzw. den Ovarial-Zyklus zu beeinflussen. Die Paarung erfolgt Ende April bis Ende Mai. Die Weibchen bringen von August bis Oktober 5-18 Junge zur Welt.
Wie lebt die Kreuzotter?
Die Kreuzotter ist tags- und dämmerungsaktiv, im Sommer auch nachtaktiv. Sie ist eine gute Schwimmerin, bewegt sich aber eher träge. Sie nimmt Erschütterungen des Bodens wahr und verfolgt Beute mit Hilfe der Zunge. Sie ist heimlich und scheu und flieht bei Gefahr.
Was frisst die Kreuzotter?
Die Hauptnahrung der Kreuzotter sind Wühlmäuse, aber auch andere Mausarten, Maulwürfe, Hamster, junge Wiesel, Siebenschläfer, Jungvögel, Eidechsen, Blindschleichen und Frösche.
Wie erlegt die Kreuzotter ihre Beute?
Die Kreuzotter lauert ihrer Beute auf oder streift nachts umher. Sie nähert sich bis auf wenige Zentimeter, richtet den Vorderkörper auf und beißt plötzlich zu. Das Gift, das sie injiziert, tötet die Beute und sorgt für eine Vorverdauung.
Wie pflanzt sich die Kreuzotter fort?
Nach 3-4 Jahren erreichen Jungottern die Geschlechtsreife. Männchen suchen nach der Winterruhe die Weibchen auf. Es kann zu Kommentkämpfen zwischen Männchen kommen. Die Paarung kann zwischen 0,5-2,5 Stunden dauern. Die Kreuzotter ist lebendgebärend, die Jungen werden in einer Eihülle geboren.
Welche Fressfeinde hat die Kreuzotter?
Zu den natürlichen Feinden gehören Iltis, Igel, Fuchs, Dachs, Wildschweine, Steinmarder, Hermelin, Mauswiesel, Adler, Störche und Bussarde. Auch der Mensch ist ein großer Feind der Kreuzotter.
Wo lebt die Kreuzotter?
Die Kreuzotter bevorzugt raues Klima mit starken Temperaturschwankungen und meidet trockenheiße Gebiete. Beliebte Habitate sind Waldränder, Kahlschläge, Waldschneisen, Steinbrüche, Moore, Dünen und Straßenränder. Im Hochgebirge geht sie bis über die Baumgrenze hinaus.
Wie ist die Kreuzotter an ihren Lebensraum angepasst?
Die Kreuzotter sucht sich gezielt ihren Lebensraum aus, der innerhalb eines Jahres variieren kann. Sie meidet die Nähe zum Menschen und kann bei Kontakt erheblich gestört werden.
Wo ist die Kreuzotter verbreitet?
Die Kreuzotter ist die am weitesten verbreitete Giftschlange Europas. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich über 150 Längen- und 28 Breitengrade, von Frankreich und Großbritannien bis nach Sachalin.
Welche Stellung hat die Kreuzotter in der Nahrungskette?
Die Kreuzotter ernährt sich von Tieren und gehört zu den Konsumenten (Fleischfressern). Sie ist aber nicht der Endkonsument, sondern dient noch diversen anderen Räubern als Beute.
Wie gefährdet ist die Kreuzotter und welche Schutzmaßnahmen gibt es?
Die Kreuzotter ist vielerorts vom Aussterben bedroht bzw. gefährdet. Wichtig ist der Biotopschutz, die Erhaltung von Lebensräumen wie Moore und Waldränder. Aufklärungsarbeit unter der Bevölkerung ist wichtig, um das Erschlagen der Tiere zu vermeiden.
- Quote paper
- Christian Rehmer (Author), 2000, Die Kreuzotter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97400