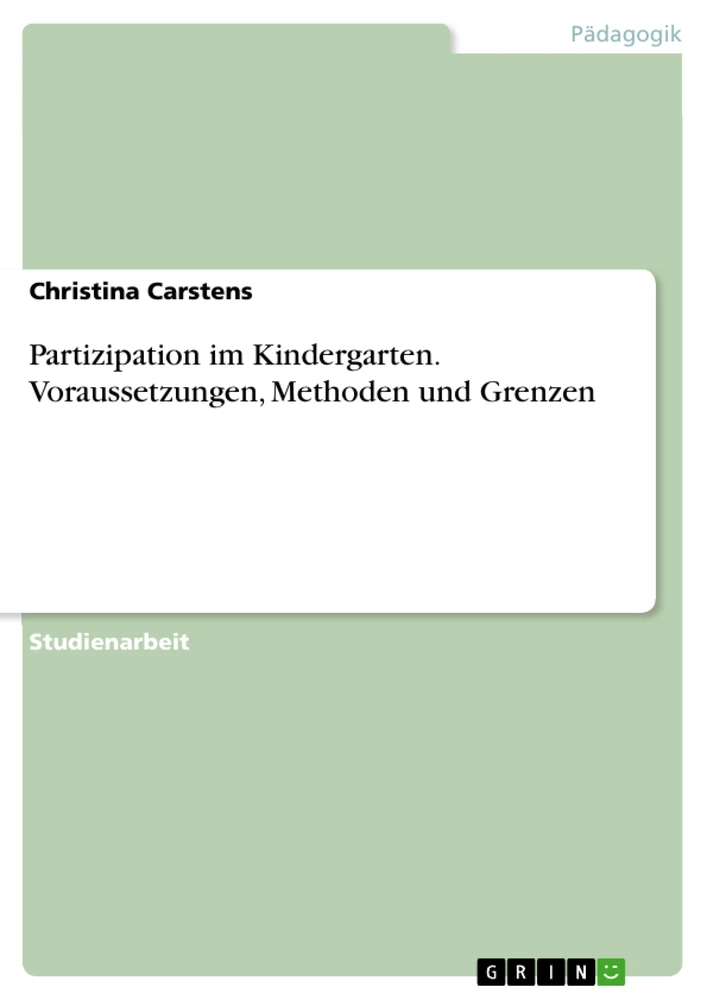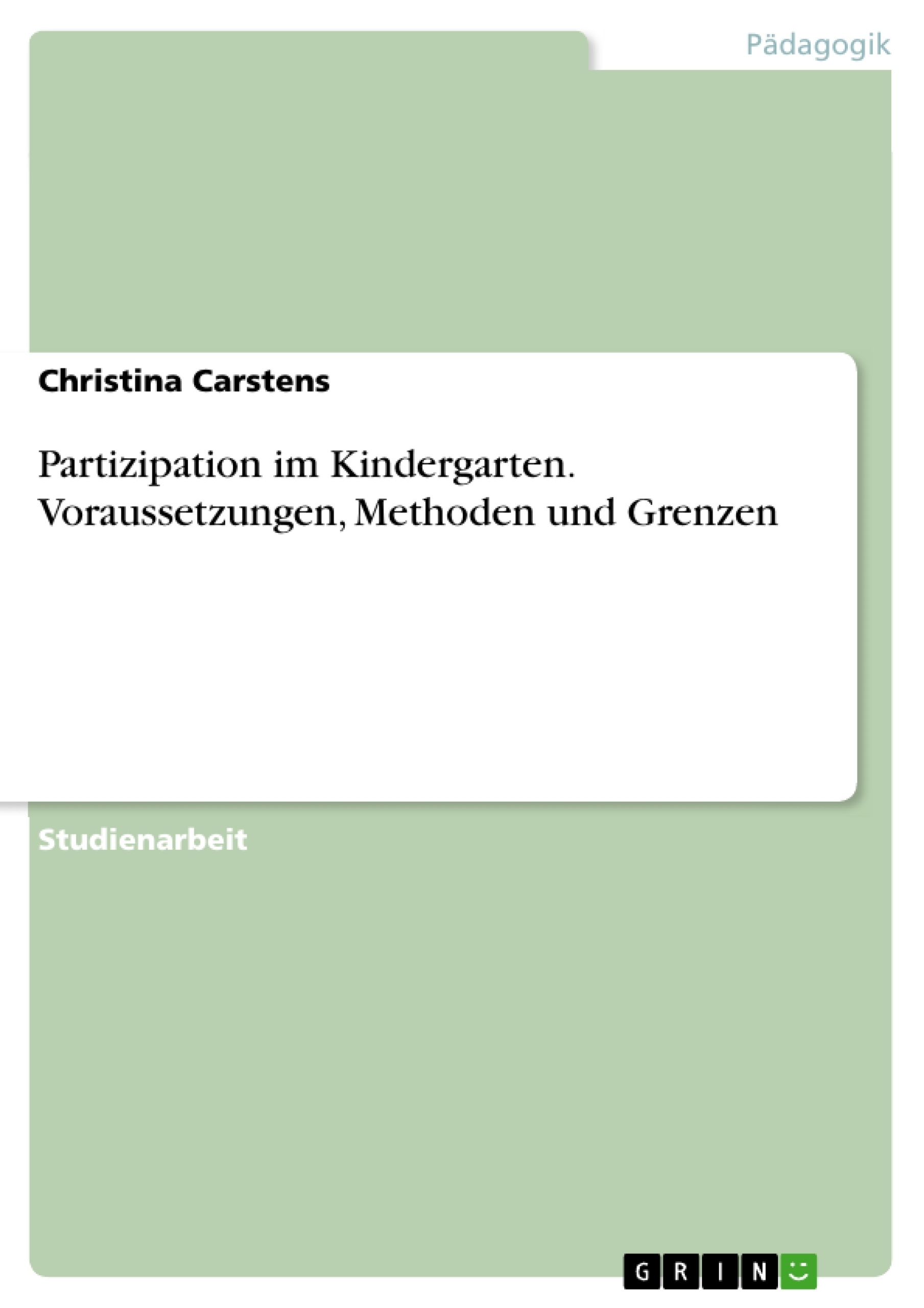Was bedeutet Partizipation im Kindergarten? Was sind die Rechte und die Demokratie in der Partizipation? Was macht Partizipation mit den Kindern? Wie sieht es mit der Inklusion und mit Menschen mit Behinderungen aus in der Partizipation? Welche Methoden gibt es in der Partizipation? Können Ressourcen geweckt werden? Gibt es Grenzen in der Partizipation?
Diesen Frage- und Problemstellungen soll die Arbeit nachgehen. Daher wird zunächst eine Definition der Begriffe Partizipation, Rechte und Demokratie erfolgen. Das Ziel der Arbeit ist es dabei, die Partizipation im Kontext der Kindergartentätigkeit darzustellen und klären, warum Kinder im Kindergarten Partizipation brauchen und erfahren sollten.
Um eine Betriebserlaubnis für einen Kindergarten zu bekommen, sind nach § 45 SGB Abs. 2 Nr. VIII zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung geeignete Verfahren der Beteiligung von Kindern anzuwenden. Mit dem dadurch gesetzlich geregelten Anspruch der Kinder auf Partizipation gewinnt diese im Kindergarten an Bedeutung. Dabei ist der Gedanke der Partizipation nicht neu, denn bereits in den zwanziger Jahren war der Hinweis auf die Partizipation als Begriff in reformpädagogischen Ansätzen zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmungen und Standortdefinition
- Definition von Partizipation
- Gesetzliche Rahmenbedingungen für Kinderrechte
- Demokratie in der Partizipation
- Voraussetzung und Methoden für Partizipation in Kindergarten
- Grundhaltung des Fachpersonals in Kindergarten
- Kinderparlament / Kindergruppenkonferenz im Kindergarten
- Beschwerdeverfahren
- Inklusion und Integration
- Grenzen der Partizipation
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema Partizipation im Kindergarten. Sie untersucht die Bedeutung von Partizipation im Kontext der Kindergartentätigkeit und klärt, warum Kinder im Kindergarten Partizipation brauchen und erfahren sollten.
- Definition und verschiedene Stufen der Partizipation im Kindergarten
- Gesetzliche Rahmenbedingungen und Kinderrechte in Bezug auf Partizipation
- Methoden und Voraussetzungen für Partizipation im Kindergartenalltag
- Inklusion und Integration im Zusammenhang mit Partizipation
- Grenzen der Partizipation im Kindergarten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Partizipation im Kindergarten ein und stellt die Relevanz des Themas im Kontext der gesetzlichen Rahmenbedingungen und der reformpädagogischen Ansätze dar. Kapitel 2 definiert den Begriff der Partizipation und beleuchtet die gesetzliche Grundlage für Kinderrechte in Bezug auf Partizipation. Zudem wird der Zusammenhang zwischen Partizipation und Demokratie im Kindergarten erläutert. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Voraussetzungen und Methoden für Partizipation im Kindergarten, insbesondere mit der Grundhaltung des Fachpersonals, Kinderparlamenten/Kindergruppenkonferenzen und Beschwerdeverfahren.
Schlüsselwörter
Partizipation, Kindergarten, Kinderrechte, Demokratie, Inklusion, Integration, Methoden, Kinderparlament, Kindergruppenkonferenz, Beschwerdeverfahren
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Partizipation im Kindergarten?
Es bedeutet die aktive Beteiligung und Mitbestimmung von Kindern an Entscheidungen, die ihren Alltag in der Einrichtung betreffen.
Gibt es eine gesetzliche Pflicht zur Partizipation?
Ja, nach § 45 SGB VIII ist die Anwendung geeigneter Verfahren zur Beteiligung von Kindern Voraussetzung für die Betriebserlaubnis einer Einrichtung.
Welche Methoden der Mitbestimmung gibt es?
Gängige Methoden sind das Kinderparlament, die Kindergruppenkonferenz sowie strukturierte Beschwerdeverfahren für Kinder.
Wo liegen die Grenzen der Partizipation?
Grenzen bestehen dort, wo das Wohl des Kindes gefährdet ist, bei rechtlichen Vorgaben oder wenn die personellen Ressourcen der Einrichtung erschöpft sind.
Welche Grundhaltung muss das Fachpersonal haben?
Das Personal muss Kindern auf Augenhöhe begegnen, ihre Rechte respektieren und bereit sein, Macht abzugeben, um echte Teilhabe zu ermöglichen.
- Quote paper
- Christina Carstens (Author), 2017, Partizipation im Kindergarten. Voraussetzungen, Methoden und Grenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/974049