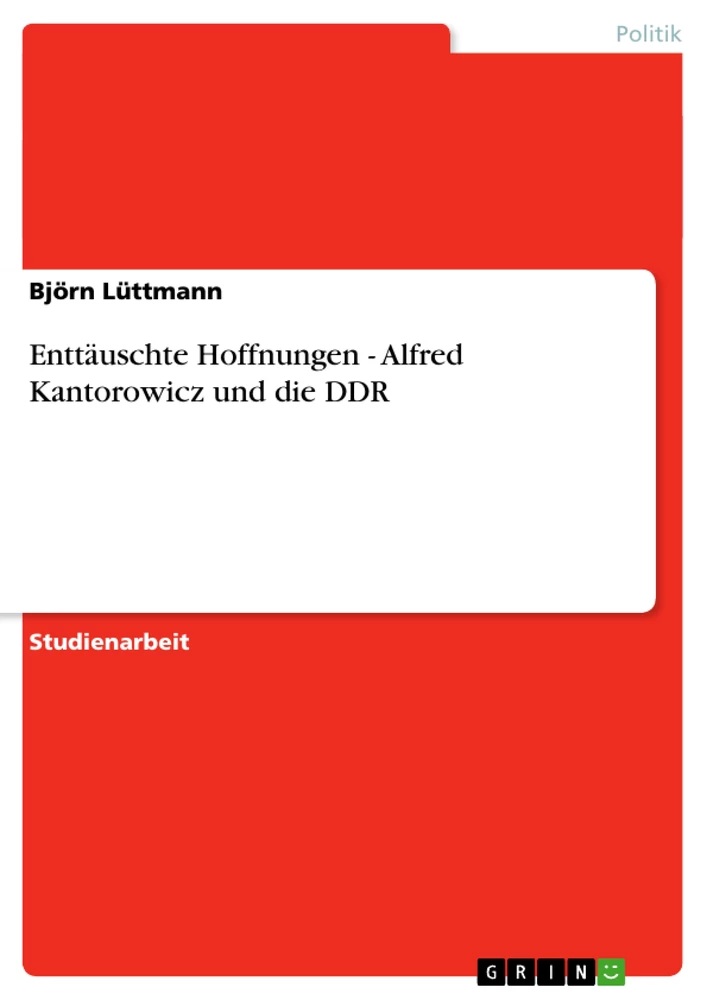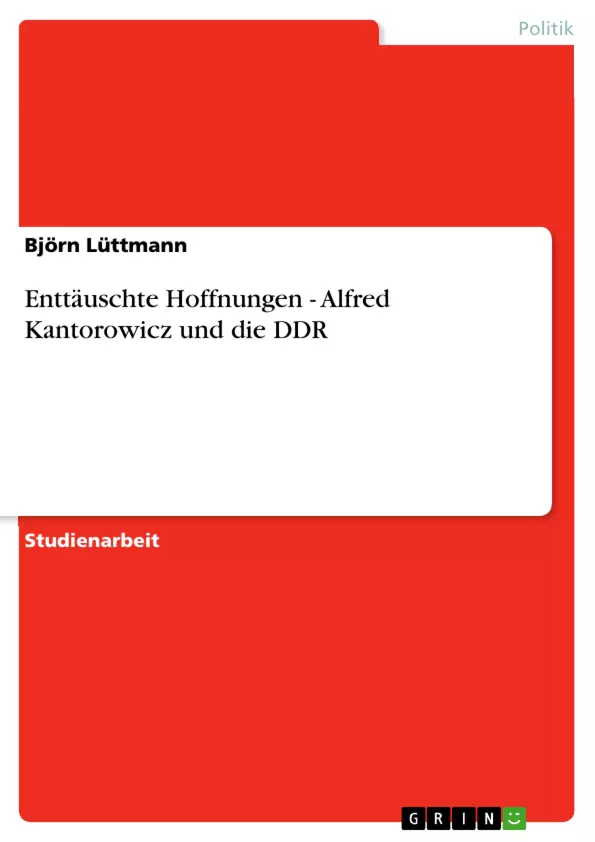Der Anspruch der sozialistischen Idee, über den Befreiungskampf der Arbeiter eine herrschaftsfreie und auf Gleichheit ausgerichtete Gesellschaft zu entwickeln und die Wirklichkeit "real- sozialistischer" Gesellschaften in Europa standen in einem krassen Widerspruch zueinander. Dieser Widerspruch lässt sich anhand der Entwicklung der DDR exemplarisch nachzeichnen.
In der vorliegenden Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, wie der offensichtliche Widerspruch von Anspruch und Realität sich auf einen Menschen auswirkte, der in der Theorie des Sozialismus eine Anleitung für die Gestaltung einer "besseren Gesellschaft" sah und mit der Wirklichkeit sozialistischer Parteiendiktatur konfrontiert wurde.
Beispielhaft sollen die Berichte des Ex- Kommunisten Alfred Kantorowicz untersucht werden, welcher 1957, vormalig Professor in der DDR, in die Bundesrepublik Deutschland geflohen war. In zahlreichen Aufsätzen und Artikeln beschrieb er sein Leben in der DDR. Als Hauptwerk gelten seine Tagebücher, welche auch Hauptgegenstand der Untersuchung waren.
Die Arbeit ist zunächst unterteilt in die Einleitung, gefolgt von recht umfangreichen biographischen Ausführungen, welche als Hintergrund für das Handeln Kantorowicz in der DDR notwendig erschienen. Der dritte Teil bildet den Schwerpunkt dieser Arbeit, er befasst sich mit der Konfrontation Kantorowicz` mit dem realen Sozialismus in der DDR. Im vierten Teil werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und mit einer Stellungnahme des Autors abgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Biographie eines Grenzgängers
1. Die Zeit vor 1945
2. Kantorowicz in Ost- Berlin
a) „Ost und West“
b) Professor an der Humboldt- Universität
c) Flucht und „Asyl" in der Bundesrepublik
III. Enttäuschte Hoffnungen in der DDR
1. Tagebuch als Reflexion der täglichen Enttäuschungen
2. „Der geistige Widerstand in der DDR“
3. Widersprüche
IV. Fazit und Stellungnahme Literaturverzeichnis
I. Einleitung
Der Anspruch der sozialistischen Idee, über den Befreiungskampf der Arbeiter eine herrschaftsfreie und auf Gleichheit ausgerichtete Gesellschaft zu entwickeln und die Wirklichkeit „real- sozialistischer" Gesellschaften in Europa standen in einem krassen Widerspruch zueinander. Dieser Widerspruch lässt sich anhand der Entwicklung der DDR exemplarisch nachzeichnen.
In der vorliegenden Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, wie der offensichtliche Widerspruch von Anspruch und Realität sich auf einen Menschen auswirkte, der in der Theorie des Sozialismus eine Anleitung für die Gestaltung einer „besseren Gesellschaft" sah und mit der Wirklichkeit sozialistischer Parteiendiktatur konfrontiert wurde. Beispielhaft sollen die Berichte des Ex- Kommunisten Alfred Kantorowicz untersucht werden, welcher 1957, vormalig Professor in der DDR, in die Bundesrepublik Deutschland geflohen war. In zahlreichen Aufsätzen und Artikeln beschrieb er sein Leben in der DDR. Als Hauptwerk gelten seine Tagebücher1, welche auch Hauptgegenstand der Untersuchung waren. Die Arbeit ist zunächst unterteilt in die Einleitung, gefolgt von recht umfangreichen biographischen Ausführungen, welche als Hintergrund für das Handeln Kantorowicz in der DDR notwendig erschienen. Der dritte Teil bildet den Schwerpunkt dieser Arbeit, er befasst sich mit der Konfrontation Kantorowicz` mit dem realen Sozialismus in der DDR. Im vierten Teil werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und mit einer Stellungnahme des Autors abgeschlossen.
II. Biographie eines Grenzgängers
1. Die Zeit vor 1945:
Alfred Kantorowicz wurde am 12.8.1899 in Berlin geboren und wuchs in „bürgerlich - jüdischen" Verhältnissen auf.2
Wie viele seiner Zeitgenossen liess er sich von der „vaterländischen" Begeisterung zu Beginn des 20. Jahrhunderts anstecken und meldete sich 1917 freiwillig zum Kriegsdienst, währenddessen er mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurde.
Ob Kantorowicz, wie es später in der Beurteilung eines ehemaligen Mitstreiters3 heisst, nach dem Krieg kurze Zeit Anhänger der „Brigade Erhardt", eines deutschnationalen Freikorps, war oder, laut Selbstdarstellung4, unter sozialdemokratischer Ägide das Rathaus Schöneberg verteidigt hat, ist umstritten.
Alfred Kantorowicz, der in den Folgejahren sein Abitur nachholte, studierte und 1923 über das Thema „Die völkerrechtlichen Grundlagen des nationaljüdischen Heims in Palästina" promovierte, dann als freier Journalist arbeitete, tat sich in den Folgejahren in jedem Falle als Befürworter einer „nationalrevolutionären" Politik für Deutschland hervor.
Seine Vorstellungen einer deutschen Nation unter der Führung einer geistigen Elite stand für einige seiner späteren kommunistischen Genossen von Anfang an in einem deutlichen Widerspruch zu seinem plötzlichen Eintritt in die KPD 1931. Gustav Regler, der Kantorowicz in die Partei aufnahm, nannte ihn rückblickend einen „armen Ritter, der zur falschen Armee gestossen war".5
Für Kantorowiczs schnelle Karriere in der Partei war dies kein Hindernis. Als politischer Leiter der kommunistischen Zelle am Laubenheimer Platz in Berlin, der berühmt war für seine „Künstlerkolonie", welche eine Art Sammelbecken für Linke jedweder Ausprägung darstellte, bewegte er sich in einem illustren Kreis von Intellektuellen, die zum Teil auch in seinem späteren Leben ein wichtige Rolle spielen sollten. So traf er hier zum Beispiel Johannes R. Becher, den späteren Kultusminister der DDR (1954-58) und Ernst Bloch, seinen lebenslangen Mentor.
Nach Hitlers Machtergreifung war Kantorowicz aufgrund seiner kommunistischen Führungsposition einer der ersten, gegen den ein Haftbefehl erlassen wurde (Februar 1933); er floh nach Paris.
Während seiner Zeit im französischen Exil war Kantorowicz für diverse politische Zeitschriften tätig, arbeitete unter anderem als Generalsekretär des „Schutzverbandes Deutscher Schriftsteller" und leitete ab 1934 die „Bibliothek für verbrannte Bücher" in Paris. In der Zeit von 1934 - 36 bereiste Kantorowicz zweimal die Sowjetunion. Im Herbst 1936 ging er nach Spanien, wo er in den Internationalen Brigaden gegen die Truppen Francos kämpfte. Während der nachfolgenden Internierungszeit in Frankreich entstand das nach dem Krieg erschienene „Spanische Tagebuch".
Ab 1941 lebte Kantorowicz in den USA, wo er trotz kommunistischer Parteizugehörigkeit eine Anstellung im Auslandsnachrichtendienst des Radiosenders CBS bekam.6
Eine wichtige Funktion seiner Exiltätigkeiten, während derer sich auch seine Freundschaft zu Heinrich Mann vertiefte, sah Kantorowicz in der Vertretung des „besseren Deutschland", wie er es nach dem Krieg beschrieb:
„Immerhin (...) hat man in der Welt zur Kenntnis genommen, dass es ein anderes, nicht nazistisches Deutschland gab und gibt. Wir zeugten von ihm: direkt, indem wir Kenntnis von den Abwehrkräften im Lande gaben (...); indirekt durch die Werke der Grossen, die die Not mit uns teilten." 7
1946 kehrte Kantorowicz nach Deutschland zurück, lebte zunächst im Westen Berlins (bis 1949), arbeitete allerdings hauptsächlich in der sowjetischen Zone. Diese Aufteilung von Arbeitsplatz und Wohnstätte auf beide Teile des gespaltenen Berlin beinhaltete für Kantorowicz eine beabsichtigte Symbolik.
2. Kantorowicz in Berlin:
a) „Ost und West"
Alfred Kantorowicz kehrte zurück nach Deutschland in der Hoffnung, dass nach der totalen Niederlage des Faschismus nunmehr die Chance gegeben war für eine Entwicklung der deutschen Gesellschaft unter humanistischen und sozialistischen Vorzeichen. Er selbst wollte seinen Beitrag dazu leisten, in dem er eine Zeitschrift konzipierte, die zur Verständigung zwischen Ost und West beitragen sollte. Ausgangspunkt dieser Zeitschrift war für Kantorowicz die gemeinsame Kultur aller europäischen Staaten, auf deren Basis er einen „Brückenschlag" für möglich hielt.
In der konkreten politischen Situation sollte die Zeitschrift, welche auch „Ost und West" betitelt war, zur verbesserten Kommunikation zwischen den Alliierten beitragen, auch deshalb beantragte Kantorowicz die Lizenz in allen Sektoren zugleich. In der Einführung der ersten Ausgabe hiess es, „die einzige Einschränkung, die wir uns selber auferlegen, ist die Versicherung, dass „Ost und West" seine Spalten denen verschliessen wird, die Feindschaft und Hass gegen eine der Besatzungsmächte propagieren".8 Interessant unter Berücksichtigung seines späteren Lebenslaufes erscheint eine weitere Feststellung Kantorowiczs in Hinsicht auf die Zukunft Deutschlands:
„Deutschland in seiner gegenwärtigen Situation kann weder die amerikanische Lebensform noch die Entwicklung des Sozialismus in der Sowjetunion schematisch adoptieren. Wir Deutschen müssen die unseren gegenwärtigen Bedingungen angemessene Lösung der sozialen,ökonomischen und ideologischen Probleme unseres Zeitalters selber finden. Die Zeitschrift, die ich im Sinne habe, wird versuchen, an der Lösung dieser Probleme mitzuarbeiten." 9
Diese Chance bekam die Zeitschrift nie. Trotz seiner guten Kontakte aus der Zeit des amerikanischen Exils bekam Kantorowicz keine Lizenz in den westlichen Sektoren. Die einzige Besatzungsmacht, welche die Zeitschrift sofort zuliess, war die sowjetische. Mit der Zeit geriet die Zeitschrift sowohl in ideologische Zwänge10 , sowie auch in finanzielle Abhängigkeit.
Die Zeitschrift „Ost und West", Kantorowiczs „Lieblingskind", welche unter den hehren Zielen angetreten war, einen wichtigen Beitrag zur Meinungsvielfalt in Deutschland beizutragen, wurde letztlich begraben, als die SED 1949 jegliche Unterstützung versagte. Hier markierte sich ein erster Wendepunkt im Verhältnis Kantorowicz zur DDR.. Das Scheitern seines Projekts, mit dem er eine Brücke schlagen wollte zwischen den Blöcken, war der erste große Rückschlag, den der nach dem Krieg noch hoffnungsvoll gestartete Kantorowicz hinnehmen musste:
„Von jetzt an heisst es West gegen Ost und Ost gegen West." 11
b) Professor an der Humboldt- Universität
Am Tag der letzten Auslieferung der Zeitschrift „Ost und West" wird Alfred Kantorowicz zum Professor für Neueste Deutsche Geschichte in der Philosophischen Fakultät der Humboldt - Universität Berlin berufen. Der noch kurz zuvor Zweifelnde wurde umgehend wieder in das System aufgenommen. Kantorowicz, inzwischen selbst Mitglied der SED, beschrieb dies in seinem Tagebuch als Möglichkeit aus der erneuten Orientierungslosigkeit und Enttäuschung über das SED- Regime zu entfliehen:
„(...) es ist der Ausweg. Die Berufung gibt mir die Möglichkeit, Mauern um mich zu baun, auf anständige Art auszuharren im - Elfenbeinturm der Wissenschaft." 12
Eingeschlossen im „Elfenbeinturm" ließ Kantorowicz kaum Opposition gegen das Regime erkennen. Im Gegenteil: es erschienen Loblieder auf Stalin13 und auch im Umgang mit sogenannten Renegaten war Kantorowicz in seinen Texten nicht zimperlich. Michael Rohrwasser stellt in seiner Analyse des Werkes Kantorowiczs die These auf, dass die Abrechnung Kantorowiczs mit den Renegaten in dieser Phase seines Lebens im Lichte seiner eigenen Zweifel am System gesehen werden kann: „Abtrünnige und Verräter trifft die scharfe Kritik und die wütende Verdammung dessen, der selbst mit der Versuchung kämpft."14 In den Tagebüchern, welche Kantorowicz in dieser Zeit führt, spiegelt sich seine innere Ablehnung des DDR- Regimes wieder, sie schildern zudem, wie es der Alltag unter der ständigen Kontrolle des Systems unmöglich machte, diese Ablehnung in praktische Handlung umzusetzen.
Zum offenen Bruch mit dem Regime kam es schliesslich 1956, als er im Zusammenhang mit dem 20. Parteitages der KPdSU15 , welcher auch andere Schriftsteller ermutigte, sich erstmals öffentlich kritisch zu äußern, einen kritischen Artikel in der „Berliner Zeitung" veröffentlichte, in der er die Rolle des Schriftstellers als „Gewissen und Mahner des Volkes" beschrieb und staatliche Kulturreglementierungen kritisierte. Es folgten weitere Provokationen: Das Verweigern der Unterschrift unter einen Aufruf des Schriftstellerverbandes, welche die repressive Ungarn- Politik der Sowjetunion guthieß und auch das Vorschlagen des in Ungnade gefallenen Georg Lukacs für den Nobelpreis waren bereits Akte eines „offenen Widerstandes".
Einmal aus der Deckung des „heimlichen Widerstandes" auf geistiger Ebene in den
sichtbaren, „offenen Widerstand" getreten, wurde der Druck auf Kantorowicz groß. Seinen Schritt unter Verzicht auf seine Professur in Berlin und die Leitung des Heinrich- MannArchivs bei der Akademie der Wissenschaften, sowie dem Zurücklassen beinahe sämtlichen Besitzes, in den Westen zu fliehen kommentierte er so:
„Die Wahrheit ist, dass ich am Ende meiner Nervenkräfte war und nicht mehr durchhalten konnte." 16
c) „Asyl" in der Bundesrepublik
Die Entscheidung in die Bundesrepublik zu flüchten, konnte Kantorowicz nicht leicht gefallen sein. Zum einen gab er - im materiellen Sinne - eine sehr privilegierte Lebensweise auf, zum anderen musste er sich nun arrangieren mit dem Deutschland, welches kurz zuvor „imperialistisches Ausland" gewesen war. Zudem war er sich dessen bewusst, dass er als ehemaliger Kommunist, Spanienkämpfer, Emigrant, linker Schriftsteller und Jude eine schwere Hypothek mit sich trug.
Seine Befürchtungen bestätigten sich: Seine Anerkennung als politischer Flüchtling wurde ihm in Bayern unter dem Hinweis, dass seine „stützende" Funktion im DDR- Regime ihn selbst zu einem „Täter" gemacht hätte, verweigert.
Erst 1966 bekam Kantorowicz die Anerkennung als politisch Verfolgter nach einem Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts zugesprochen.
Zuletzt lebte er in Hamburg, wo er Mitglied der Akademie der Künste wurde. Er veröffentlichte seine „Tagebücher", um von seinem Schicksal in der SBZ/DDR zu berichten, verweigerte sich jedoch der Vereinnahmung durch die antikommunistische Propaganda. Vielmehr behielt er sein Leben lang (er starb am 27.3.1979) die Hoffnung, dass es einen „menschlichen Sozialismus"17 geben könne, ohne die Ketten, die den Menschen in den real existierenden Ländern angelegt wurden. Die Hoffnung auf einen solchen Wandel setzte er dabei vor allem auf die Jugend, die er fortlaufend dazu aufrief, „geistigen Widerstand" zu leisten und so möglicherweise eine systemimmanente Veränderung in der DDR herbeizuführen.
III. Enttäuschte Hoffnungen in der DDR
Alfred Kantorowicz war 1945 voller Hoffnung aus dem Exil nach Deutschland zurückgekehrt, um den Aufbau eines „besseren Deutschland" zu erleben und mit zu gestalten. Es erschien ihm nach den Erfahrungen mit dem Nazi- Regime naheliegend, dass nun die selbsterklärte Partei des Antifaschismus, die KPD / SED Träger eines solchen Aufbaus sein müsste.
1. Tagebücher als Reflexion der täglichen Enttäuschung
Die Zeugnisse des Alltags Kantorowicz` in der SBZ / DDR sind die bereits erwähnten „Deutschen Tagebücher"18 , welche nach seiner Flucht in den Westteil Deutschlands erschienen. Sie bestehen aus den Abschriften der Aufzeichnungen Kantorowicz in den Jahren 1945-57, ergänzt durch Kommentare, Zeitungsartikel und „stilistische" Korrekturen, welche der Autor später hinzufügte. Ob dadurch Verzerrungen oder gar Verfälschungen des Inhaltes entstanden sind, muss hier offen bleiben.19
Als sicher kann jedoch gelten, dass die Tagebücher für Kantorowicz vor allem eine Funktion hatten: Die Kompensation, das „Herauslassen" seiner täglichen enttäuschenden Erfahrungen in der DDR.
Schon bevor die Frage vertieft werden soll, worin diese Enttäuschungen bestanden haben, lässt sich eines feststellen: Aufgrund der Funktion des Tagebuches muss die Darstellung seiner Zeit in der SBZ / DDR als verzerrt angenommen werden. Was in diesen Tagebüchern fehlt, ist die positive Seite des Lebens von Kantorowicz, der nach eigenem Bekunden seine Privilegien als Professor an der Humboldt- Universität und als Leiter des Heinrich- MannArchivs durchaus zu schätzen wusste.
Noch eine zweite Einschränkung muss vor der Betrachtung der „Deutschen Tagebücher" gemacht werden. Kantorowiczs Blickwinkel ist der eines Schriftstellers und Literaturprofessors, der eines Gelehrten, und Kantorowiczs Analyse der Verhältnisse in der SBZ / DDR konzentriert sich vor allem auf kulturelle Fragen und setzt sich weniger mit allgemeinen politischen Entwicklungen auseinander.
Hermann Kuhn beschreibt diese Einschränkung so: „Nicht die Rede ist bei Kantorowicz von den sozialen Umwälzungen der ersten Nachkriegsjahre in der SBZ, den Verstaatlichungen, der Landreform, den Auseinandersetzungen um die Betriebsräte, Gewerkschaften; nicht von der Ausschaltung der ´nicht- integrierbaren` Teile der alten Sozialdemokratie und der anderen ´Blockparteien`; nicht von der Berlin- Blockade, nicht vom Konflikt mit Tito. Nichts schreibt er auch über das ´Parteileben` im engeren Sinne, denn daran nahm Kantorowicz gar nicht teil.
Reflexionen oder Kritik am politischen Weg der SBZ zur DDR gibt es in den Tagebüchern nicht."20
Alfred Kantorowicz bezeichnete seine Tagebücher selbst als „Klagemauer"21 , an denen er die unterdrückten Gefühle der Ohnmacht und die in der DDR nicht äußerbare Kritik an dem seiner Meinung nach falschen Weg der deutschen Nachkriegspolitik abließ. Von Anfang an standen dabei beide deutschen Staaten im Blickfeld seiner Kritik. Neben der direkten Auseinandersetzung mit dem Alltag im Osten Deutschlands findet sich nicht weniger harsche Kritik an den Zuständen im Westen.
Im Mittelpunkt seiner Kritik an der Bundesrepublik steht insbesondere die unterschwellige und später auch offizielle Amnestie ehemaliger Nationalsozialisten, bei gleichzeitiger Nichtbeachtung von kritischen Intellektuellen, welche für eine antifaschistische Offensive eintraten.
Dies wird im Verlaufe der Tagebücher zu einem wichtigen Faktor: Der augenscheinliche „Wiederaufstieg des Faschismus"22 im Westen versperrt Kantorowicz den Weg aus dem Ulbrichtschen Machtbereich, hatte er doch stets gegen den Faschismus gekämpft. Sein Siedeln und seine Tätigkeit in der DDR waren letztlich vor allem eine Folge des entschiedenen Antifaschismus Kantorowiczs.
Das Bekenntnis zum Antifaschismus war es, welches Kantorowicz in die KPD hatte eintreten lassen, der ihn im spanischen Bürgerkrieg kämpfen ließ. Der Antifaschismus war das einigende Band, welches selbst die kritischsten Kommunisten immer wieder „auf Linie brachte", wenn Zweifel an der Politik der Partei aufkamen. Insbesondere in den Jahren nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten hatte dieser Grundtenor für Kantorowicz und viele seiner Genossen Gültigkeit:
„Die Machtergreifung des Nationalsozialismus, die Unterdrückung und Verfolgung der
Parteiüberdeckte diese Spannungen zeitweilig. Im Zeitpunkt der Niederlage die geschlagene Partei zu verlassen, wäre uns als Desertion erschienen. Gerade deräußere Druck schloss uns noch einmal fester und trotziger zusammen." 23
Dennoch hat auch dieses einigende Band es nicht vermocht, den Blick auf die inneren Widersprüche der kommunistischen Parteien zu trüben. Laut Kantorowicz24 erkannten er und die meisten seiner Mitstreiter in der KPD diese Widersprüche von Beginn an. Diese Widersprüche fanden ihren Niederschlag in dem Gegensatz des humanistischen Anspruchs der Marxschen Lehre und der Realität straffer Parteiführung.
Folgt man den Darstellungen Kantorowiczs, so lassen sich Verdrängungsmechanismen entdecken, die diesen offensichtlichen Widerspruch fortlaufend bekämpften in der Hoffnung, letztlich einer kommunistischen Bewegung zur Seite stehen zu können, die ohne die Mittel des Zwanges auskommen würde. Kantorowicz stellt wiederholend dar, dass die Praxis „funktionärsdiktatorischer" Machtausübung in der Anfangszeit der SBZ / DDR von ihm und vielen Genossen25 quasi als „Geburtswehen" einer „besseren Gesellschaft" angesehen wurden.
Als Begründung dafür, im Osten zu bleiben, führt Kantorowicz an, dass er glaubte, „dass (...) die von außen über [„die DDR"; B.L.] gesetzte (...) ´provisorische Regierung` (...) tatsächlich nichts anderes als eine überhastete Improvisation der kalten Kriegsführung sei, ein Notbehelf, der nicht von Dauer sein würde".26
Der Prozess seiner Loslösung vom Kommunismus und konkret von dem „real existierenden Sozialismus" in der DDR ist der Prozess der Verschärfung des Gegensatzes von Anspruch und Realität. Dieser Prozess spiegelt sich wieder in seinen Tagebüchern.
Am Rande bemerkt sei die Sprache Alfred Kantorowiczs, mit der er die Funktionäre darstellt und dadurch qualifiziert.
So finden sich in seinen Schriften folgende Beschreibungen: „Gauleiter", „Rollkommandos", „Sturmabteilungsmänner", „Totschlägerkolonne", „Sturmführer", „Ulbrichtsche Gestapo", (...), Funktionärsgeschmeiss", „Ratten", „Wanzen", „Maulwürfe", „Ungeziefer", „Unterwertigkeit von Parteifunktionären", „widergeistige Parteibürokraten" usw.27 Michael Rohrwasser merkt hierzu an, dass Kantorowicz „die denunziatorischen Elemente der Parteisprache"28 konserviert habe, das heisst, in gewisser Weise die Methode derjenigen anwendete, die er damit abzuwerten suchte.
Die Schuld für das Versagen der Kommunisten beim Aufbau eines „besseren Deutschland" trugen nach Kantorowicz die Funktionäre, welche unter Leugnung der humanistischen Ideale der „wahren" Sozialisten eine Diktatur errichtet hatten, welche den „Geist" in Ketten gelegt hätte.
„Pöbelherrschaft" versus „Herrschaft des Geistes", so beschreibt dies Hermann Kuhn29 und nennt damit auch eine mögliche Motivlage des Lebenberichtes Kantorowicz. Gegenüber späteren Anfeindungen - von der einen Seite kam die Frage, warum er „so spät" und von der anderen Seite, warum er „so früh" aus der DDR geflüchtet wäre - konnte er so Rechenschaft ablegen.
Aufgerieben zwischen dem faktischen Druck der Staatsgewalt und dem idealistischen Streben nach dem „menschlichen Sozialismus" musste die Entscheidungsfindung eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, konnte jedoch irgendwann nicht mehr fortgeführt werden. Ob dieses Motiv der Rechtfertigung gegenüber den Kritikern von Relevanz für die Betrachtung Kantorowiczs Lebenswerkes ist, kann hier nicht ausführlich diskutiert werden.30 Es ist festzuhalten, dass Kantorowicz sich selbst in der Rolle des Intellektuellen sah, der die autoritäre Herrschaft der Funktionärsdiktatur stets kritisch betrachtete, sich öffentlich fügte und heimlich opponierte: in seinen Tagebüchern.
Laut Eigendarstellung stand Kantorowicz somit von Beginn an auf der Seite der kritischen Kommunisten, welche die Herrschaft der Parteienbürokratie nie gewollt hätten. Er und seine Mitstreiter aus der Intelligenz leisteten nach seiner Definition eine Art „geistigen Widerstand", welcher mal mehr, mal weniger offen zu Tage trat.
2. „Der geistige Widerstand in der DDR"
„Der geistige Widerstand in der DDR" ist auch der Titel eines Aufsatzes31 von Alfred Kantorowicz aus dem Jahre 1968. In diesem Aufsatz beschreibt Kantorowicz die Auflehnung intellektueller Kreise gegen die totalitäre Herrschaft der SED. Es ist ihm hierbei wichtig zu betonen, dass es insbesondere in den Kreisen der kommunistischen Intelligenz diesen Widerstand gab, welche somit im Gegensatz zur kommunistischen Funktionärselite standen. Direkt zu Beginn des Aufsatzes stellt Kantorowicz klar, dass die Bereitschaft der Intellektuellen - zu denen er auch sich selbst zählte32 - Widerstand zu leisten, nicht auf einem platten „Antikommunismus" beruhen konnte. Kantorowicz beschreibt den Antikommunismus, wie er zum Beispiel von den Amerikanern betrieben wurde als kontraproduktiv und gefährlich in seiner Aggressivität. Ausserdem begründete sich der geistige Widerstand auf dem Glauben an die Machbarkeit des „menschlichen Sozialismus" und schloss somit antikommunistische Tendenzen aus.
Der geistige Widerstand fand nach Kantorowicz vielmehr seinen Ausdruck in „kritischer Wachsamkeit und geistiger Eigenständigkeit"33 gegenüber dem System.
Trotz vielfältiger unterschiedlicher Motive für die Bereitschaft, Widerstand zu leisten, hätte es doch immer einen gemeinsamen Ausgangspunkt gegeben:
„Wenn (...) von dem für Ulbricht und seine Spitzenfunktionäre besonders unbequemen Widerstand gegen die Zwangsbewirtschaftung des geistigen und schöpferischen
Lebens die Rede ist, haben wir es mit einem mehrschichtigen differenzierten Prozess zu tun, der sich aus vielen Strömungen speist, die sich auf eine gemeinsame Wurzel zurückführen lassen: Gedanken- und Gewissensfreiheit." 34
In den Beschreibungen des Widerstands der Intellektuellen wird deutlich, dass seine Ausführungen unter anderem darauf abzielen, zu beweisen, dass „Ulbricht und seine mörderische Clique"35 nicht die linke Bewegung repräsentierten, welche spätestens nach dem ersten Weltkrieg angetreten war, den Sozialismus auf deutschen Boden zu verwirklichen. Vielmehr sei die Machtübernahme der in Abhängigkeit von der Sowjetunion stehenden Funktionäre in der SBZ / DDR die Niederlage der sozialistischen Bewegung gewesen. In diesem Zusammenhang verweist Kantorowicz in seinem Aufsatz von 1968 auf den Polnischen Philosophieprofessor Leszek Kolakowski, der 1960 den Stalinismus als eine in Wirklichkeit „rechte" Bewegung charakterisiert hatte und eine Reaktion der „wahren" Linken auf diesen forderte. Eine rein doktrinäre, einseitige Bewegung, auch wenn sie sich einen „sozialistischen" Anstrich gebe, verrate „ihre ursprünglichen intellektuellen und moralischen Grundsätze"36
Die stalinistisch geprägte und in ihren strengen Doktrinen erstarrte DDR hatte solch harsche Kritik am System nie zugelassen, während in anderen Ostblockstaaten, wie zum Beispiel Polen längst ein gewisser „Enstalinisierungsprozess" eingesetzt hatte. Nach dem Tode Stalins war daher unter den ostdeutschen Intellektuellen die Hoffnung auf einen Wandel hin zu größerer Meinungsfreiheit geschwunden, als sich abzeichnete, dass die Regierung Ulbricht hartnäckig an den Traditionen Stalins festhielt, welche sich in Terror gegen jegliche Form der Kritik manifestierten.
Die Reaktion der Intellektuellen in der DDR beschreibt Kantorowicz, in einer vergleichenden Perspektive zu seinen Erfahrungen in der Nazi- Zeit, als Rückzug in die „innere Emigration". Dieser Schritt wurde denjenigen Intellektuellen abverlangt, die im System bleiben wollten und doch eine grundlegende Veränderung wünschten.
Die innere Emigration, das „Schweigen derer, die einst viel zu sagen wussten" wie Kantorowicz es nannte, „ist in Diktaturen ein großes Zeichen"37 .
An anderer Stelle heisst es hierzu bei Kantorowicz: „Wo die Funktionäre reden, schweigen die Musen !"38
Der so betitelte Zeitungsartikel von 1963 erwähnt die Folgen des Zwanges der durch die Funktionäre auf die Intellektuellen und die gesamte Gesellschaft ausgeübt wurde und beschreibt, wie durch ihn die Eigeninitiative der Menschen in der DDR erstickt wurde:
„Man kann Menschen, denen man Lesen und Schreiben beigebracht hat, Menschen, die wissenschaftliche Erfindungen und Entdeckungen von unerhörter Tragweite machen sollen, komplizierte Maschinen bedienen sollen, organisatorisches Selbstbewusstsein zu entwickeln haben, Menschen, die man zum Denken geschult hat, nicht auf die Dauer in geistige Zwangsjacken einschnüren." 39
Hier geschieht es, dass Kantorowicz auch die Mehrheit des Volkes, die „einfachen Bürger", ins Auge fasst. Kantorowiczs Darstellungen des Widerstandes beschrieben hingegen in erster Linie die Wirkung der Zwangsjacken auf die Intellektuellen und ihre Versuche, sich gegen diese zur Wehr zu setzen. Es ist die Überzeugung Kantorowiczs, dass es eine Elite geben muss, die die Masse führt, die hinter diesen Ausführungen steht und die sich durch die Biographie Kantorowiczs zieht.40 In seinen diversen Veröffentlichungen beschreibt er einige der „Frontkämpfer des geistigen Widerstandes", so zum Beispiel Wolfgang Harich, Robert Havemann, Ernst Bloch und viele andere. Illustre Beispiele aber auch die unbekannten kleinen Fälle geistigen Widerstandes, etwa das unangepasste Verhalten eines seiner Studenten werden bei Kantorowicz beschrieben.
Es lässt sich feststellen, dass Kantorowicz sich selbst in den vielen Beispielen des Unangepasstseins, des Schweigens oder des Verweigerns wiederfindet.
Er gesteht durchaus Fehler ein in seinen Einschätzungen und auch in seinem Verhalten in der DDR41 , letztlich präsentieren seine Rückblicke, gestützt durch seine Veröffentlichung der Tagebücher, jedoch ein Bild:
Alfred Kantorowicz sei - zumindest in seinem geistigen Exil - in Opposition zu den Gewaltherrschern gewesen, in einem „geistigen Widerstand" gegen die Funktionäre. In dieser Einschätzung musste er sich der Kritik stellen.
3. Widersprüche
Alfred Kantorowicz Darstellung seiner Zeit in der DDR ist in seiner Form als veröffentlichte Tagebücher, nur ergänzt durch einige Anmerkungen und Dokumente natürlich als höchstgradig subjektiv zu betrachten. Auch die Aufsätze und Artikel, welche Kantorowicz veröffentlichte sind deutlich in ihrer durch subjektive Erfahrungen geprägten Sprache. So bietet das Werk Kantorowiczs sich an für eine ganze Reihe von Widersprüchen - im doppelten Sinn des Wortes.
Zunächst musste sich Kantorowicz in formaler Hinsicht Kritik gefallen lassen. So sei in seinen Tagebüchern einiges durcheinander geraten in Bezug auf Daten, Ablauf historischer Ereignisse etc. Diese Mängel sollen hier nicht Gegenstand einer Überprüfung sein, Kantorowicz erklärt diese unter Hinweis auf den streckenweise fragmentarischen Charakter seiner Aufzeichnungen, sowie dem Unwissen bestimmter Gegebenheiten zur Zeit der Niederschrift.
Gravierender erscheinen jedoch die Widersprüche in der Selbstdarstellung, wenn es um die Verdrängung des „Doppelgesichtes des Renegaten als Täter und Opfer"42 geht, welche Michael Rohrwasser konstatiert.
Ein Blick in die Aufsatzsammlung „Im zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts" offenbart die „Funktionärsseite" Kantorowiczs in beeindruckender Weise. In dieser Aufsatzsammlung finden sich Texte aus der Zeit um 1950, in denen Kantorowicz die „Rangerhöhung des Geistigen" in den stalinistischen Staaten feiert und in einer Festschrift auf Stalin die Klugheit und Güte des Diktators preist.43
Hier zeigt sich, dass auch Kantorowicz im Alltag der SBZ / DDR nicht daran vorbeikam, im System zu funktionieren. Kantorowicz rechtfertigt sich im Vorwort zu den erwähnten Publikationen, in dem er andeutet, dass selbst in diesen Artikeln Anzeichen eines Widerstandes enthalten gewesen wären, zum Beispiel, in dem er in seiner Hymne auf Stalin dessen Lob für bürgerliche Literatur erwähnt hätte. Immer wieder betont Kantorowicz in seinen Werken, dass auch er Fehler gemacht habe und übt Selbstkritik. Im Bezug auf die Stalin-Schrift heisst es:
„Die versteckte Manipulation zugunsten der gefährdeten Meinungsfreiheit wird 1950 nur
wenigen Lesern in der Tageszeitung aufgefallen sein; die Überschrift „Stalin- der Humanist" hingegen mochte von vielen jungen Leuten als Bekenntnis verstanden worden sein. Es war Selbstbetrug gewesen, sich durch das Quentchen verschlüsselter Opposition gegen die einheimischen Stalinisten entlastet zu fühlen." 44
„Selbstbetrug" gesteht Kantorowicz ein, jedoch habe er immer wenigstens ein „Fünkchen" Widerstand gegen die Willkür der Funktionäre geleistet.
In seinen emotional geprägten Hasstiraden gegen das „Funktionärsgeschmeiss"45 , welche die eigene Oppositionsstellung betonen sollten, geht Kantorowicz dabei eindeutig zu weit und versinkt in die Rolle des Opfers. So schreibt Kantorowicz nach dem 17. Juni 1953 in seinem Tagebuch in Erinnerung an 1933, dass die Funktionäre und Parteiführer sich bei Hitlers Machtergreifung „in ihre strategisch uneinnehmbaren Positionen, in die Moskauer Bürostuben zurückzogen, während wir Fussvolk von den braunen Horden zerstampft wurden"46 .
Michael Rohrwasser weist auf den scheinbaren „Gewissensdruck" Kantorowiczs nach dem 17. Juni hin, der ihn veranlasst haben mag, zu vergessen, dass „weder (...) Thälmann in Deutschland (...), noch die Mehrzahl der KPD- Funktionäre in Moskau überlebt" hätten.47
Die inneren Widersprüche und Brüche in der Selbstdarstellung Kantorowicz forderten natürlich auch den Widerspruch ehemaliger Genossen heraus, die sein Wirken aus einem anderen Blickwinkel betrachtet hatten.
So bezeichneten ihn einige rückblickend als „hundertprozentigen" Genossen, der buckelte, wenn Befehle zu empfangen waren, andere hoben seine Schriften hervor, in denen er im Sinne der SED propagiert hatte.48
Kantorowicz gesteht Widersprüche in seiner Biographie ein, weist jedoch die Vorwürfe ehemaliger Genossen entschieden zurück, er habe keinen Widerstand gegen die Funktionäre geleistet. Sein Bleiben in der DDR sei in gutem Glauben gewesen, die Hoffnung auf eine Verbesserung des Systems von innen habe ihn gehalten.
Während er jedoch glaubte, auf der Seite des Humanismus und des Sozialismus für eine bessere Zukunft zu streiten, hätte sich in Wahrheit die Geschichte wiederholt und ein totalitäres System sei errichtet worden, dessen Opfer er schliesslich selbst wurde. In der Rundfunkansprache, in der Kantorowicz seine Fluchtgründe darlegt, heisst es:
„Nein, ich konnte nicht mehr die Augen verschließen vor dem fast mythischen Phänomen,
dass, während wir gläubig für Freiheit und Recht und gegen die faschistische Barbarei gekämpft hatten, Faschismus und Barbarei hinter uns wieder auferstanden waren in Wort und Tat und Ungeist in den Amtsstuben der Apparatschiks." 49
IV. Fazit und Stellungnahme
Die Biographie Kantorowicz ist in vielerlei Hinsicht widersprüchlich, sie ist aufgrund der verschiedenen Facetten bemerkenswert. Diese verschiedenen Facetten erschweren natürlich eine abschliessende Bemerkung, um so mehr als dass es sich bei dem Gegenstand der vorliegenden Untersuchung hauptsächlich um subjektive Erfahrungen handelt. Die Antworten auf die eingangs gestellte Frage - wie der offensichtliche Widerspruch von Anspruch und Realität sozialistischer Regime sich auf einen Menschen auswirkte, der an die Kraft der Theorie zur Schaffung einer besseren Gesellschaft glaubte - haben nicht den Anspruch als verallgemeinerbar zu gelten. Dennoch gibt es sicher viele Parallelen in den Biographien anderer Kommunisten, die nach langer Auseinandersetzung der DDR den Rücken kehrten.
Das zentrale Motiv Kantorowiczs und vieler seiner Genossen, in die KPD einzutreten, war das entschiedene Eintreten gegen den Faschismus gewesen. „Antifaschismus" erscheint als einigendes Band vieler Kommunisten vor, während und noch lange nach dem Krieg. Liest man in Kantorowiczs Tagebüchern, so erscheint der „Antifaschismus" beinahe als eine eigenständige Ideologie. Die Hoffnung in der KPD im Kampf gegen den Faschismus und für die Errichtung einer freien und gleichen Gesellschaft zu kämpfen, liess Kantorowicz „mitmachen" in der DDR.
Geprägt durch frühe Erfahrungen in Berlin und besonders im spanischen Bürgerkrieg hatte Kantorowicz für sich eine Trennlinie in der Kommunistischen Partei eingezogen. Auf der einen Seite gab es die Funktionäre, die aus Opportunismus und Machtbesessenheit in der Partei agierten und es gab auf der anderen Seite die Intellektuellen, die wahrhaftig für den Sozialismus stritten: „Geist versus Macht !"
So wähnte er sich stets auf der Seite der „Guten" und entdeckte nur sehr langsam, dass er, während er sich im geistigen Widerstand sah, längst ein Rädchen im Getriebe der Diktatur wurde.
Dieses Entdecken wurde von Kantorowicz auch bewusst verzögert, aufgrund der angenommenen Alternativlosigkeit. Auf der anderen Seite - sprich: im Westen Deutschlands - sah Kantorowicz den Faschismus. Nachdem er akzeptiert hatte, dass der real existierende Sozialismus in der DDR in seinen repressiven Methoden und hierarchischen Strukturen zunehmende Ähnlichkeit mit dem System bekam, das er die ganze Zeit glaubte zu bekämpfen, blieb ihm als Zufluchtsort nunmehr: Das Niemandsland.50
Kantorowicz sah sich am Ende in seiner Mission gescheitert, vermittelnd zwischen Ost und West zu wirken. Seine Hoffnungen bestanden weiter, dass kommende Generationen in Ost und West aus seinen veröffentlichten Erfahrungen lernen könnten, dass die Gewähr geistiger Freiheit das vielleicht wichtigste Gut einer Gesellschaft darstellt.
Alfred Kantorowicz war ein Opfer. Er war ein Opfer der Ideologien, welche sich ihm als die zwei Pole präsentierten zwischen denen man zu entscheiden hätte.
Zunächst galt es Position zu beziehen gegen den Faschismus. Zum ersten Mal entschied sich Kantorowicz für den scheinbaren Widerpart Kommunismus.
Nach dem Krieg blieb Kantorowicz gefangen in der „Blocklogik", das heisst im scheinbaren Entscheidungszwang entweder für die eine oder die andere Ideologie. Nun hiess die grundlegende Entscheidung: für Kommunismus oder Kapitalismus - Ost oder West.
Kantorowicz entschied sich für den Kommunismus und so wurde er in der DDR auch zum Täter.
Letzteres scheint mir jedoch nicht entscheidend, Kantorowicz unterschwellig das System stützende Funktion als Professor und - zeitweiliger - Agitator wird im Licht seiner Biographie verständlich.
Meiner Ansicht nach ergibt sich aus seinen Schriften, die natürlich, wie schon dargestellt, subjektive Einsichten gewähren, das Bild eines Grenzgängers auf der Suche nach Humanität und Gerechtigkeit. Dabei geriet er immer wieder auf Irrwege.
Konfrontiert mit dem anti-humanen Selbstverständnis der Nationalsozialisten stellt sich Kantorowicz auf die Seite der - laut Programmatik - für den Humanismus streitenden Kommunistischen Partei. Seine Hoffnungen, mit Hilfe der Kommunisten den Humanismus in Deutschland neu zu begründen, erfüllen sich nicht, im Gegenteil, Kantorowicz erfährt erneut die Missachtung der menschlichen Würde in der Realität der DDR. Zum zweiten Mal in seinem Leben sieht sich Kantorowicz gezwungen, ins Exil zu gehen.
Alfred Kantorowiczs Biographie spiegelt die Extreme des 20. Jahrhunderts aus der Sicht eines Betroffenen wieder; liesst man seine Aufzeichnungen, so lässt sich verstehen, wo die Unterschiede, aber auch, wo die Gemeinsamkeiten der totalen Systeme lagen. Sie ist ein Plädoyer für geistige Wachsamkeit und fordert dazu auf, der Entstehung totaler Herrschaft, egal unter welchen ideologischen Vorzeichen, keinen Nährboden zu bieten.
Literaturverzeichnis
1. Verwendete Werke Kantorowicz:
- Kantorowicz, Alfred: „Deutsches Tagebuch, Erster Teil", Verlag europäische ideen, Berlin 1978 (Erstausgabe: 1959). (Zitiert als: Kantorowicz (1978))
- Kantorowicz, Alfred: „Deutsches Tagebuch, Zweiter Teil", Verlag europäische ideen, Berlin 1979 (Erstausgabe: 1961). (Zitiert als: Kantorowicz (1979))
- Kantorowicz, Alfred: „Im Zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts- Illusionen, Irrtümer, Widersprüche, Einsichten, Voraussichten", Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1967. (Zitiert als: Kantorowicz (1967))
- Kantorowicz, Alfred: „Der geistige Widerstand in der DDR", Kammverlag- Politik für alle, Troisdorf 1968. (Zitiert als: Kantorowicz (1968))
- Kantorowicz, Alfred: „Die Geächteten der Republik", Verlag europäische ideen, Berlin 1977.
2. Sekundärliteratur:
- Fricke, Karl Wilhelm: „Opposition und Widerstand in der DDR- Ein politischer Report", Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1984.
- Kuhn, Herrmann: „Bruch mit dem Kommunismus: Über autobiographische Schriften von Ex- Kommunisten im geteilten Deutschland", Verlag Westfälisches Dampfboot, Münster 1990. (Zitiert als: Kuhn (1990))
- Rohrwasser, Michael: „Der Stalinismus und die Renegaten: Die Literatur der
Exkommunisten", J.B. Metzlerische Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1991. (Zitiert als: Rohrwasser (1991))
- Weber, Hermann: „Geschichte der DDR", Deutscher Taschenbuchverlag, München 1985 (Neuausgabe: 1999).
[...]
1 Kantorowicz, Alfred: Deutsches Tagebuch, Erster und Zweiter Teil, München 1959 und 1961; hier wurden verwendet die Neuauflagen: Berlin 1978 und 1979
2 Vergleiche zur Biographie: Rohrwasser, Michael: Der Stalinismus und die Renegaten, Stuttgart 1991, S. 106 ff
3 Maximilian Scheer
4 Vergleiche: Kantorowicz, Alfred (1978) , Nachwort (o. Seitenzahl)
5 Rohrwasser (1991), S. 107
6 Es kann angenommen werden, dass Kantorowicz in dieser Zeit, entgegen seiner späteren Beteuerungen seine politische Herkunft verleugnete. So geriet er unter anderem in Meinungsverschiedenheiten mit dem sozialdemokratischen Exilorgan „Neue Volksstimme" (mit Sitz in New York), in denen er die Zugehörigkeit zur KPD bestreitet. Vergleiche: Rohrwasser (1991), S. 110
7 Mein Platz ist in Deutschland: Zeitungsartikel vom 14.2.1947 (Neue Zeitung München) in: Kantorowicz, Alfred: Im Zweiten Drittel unseres Jahrhunderts, Köln 1967, S.100
8 Ost und West: Einführung in die Erstausgabe (Juli 1947) in: Kantorowicz (1967), S. 108
9 ebenda
10 So fand sich zum Beispiel noch in der letzten Ausgabe 1949 eine Huldigung Stalins zum 70. Geburtstag !
11 Tagebucheintrag am 1.1.1950 in: Kantorowicz (1979), S. 49
12 Tagebucheintrag am 20.12.1949 in : Kantorowicz (1978), S.668
13 Zum Beispiel: Stalin- der Humanist: Zeitungsartikel vom 21.12.1950 (Tägliche Rundschau), in: Kantorowicz (1967), S.124
14 Rohrwasser (1991), S.116
15 In einer „Geheimrede" hatte Generalsekretär Chruschtschow die Verbrechen Stalins angeprangert.
16 In einem Interview für den Sender Freies Berlin, zitiert nach Rohrwasser (1991), S. 112
17 Diese Formulierung versah Kantorowicz mit Anführungszeichen unter dem Hinweis auf die eigentliche Selbstverständlichkeit, dass Sozialismus menschlich sei (in der Definition von Karl Marx).
18 Kantorowicz (1978 und 1979)
19 Zur Diskussion dieser Frage vergleiche: Kuhn, Herrmann: Bruch mit dem Kommunismus, Münster 1990, S. 80 f; Rohrwasser (1991), S. 113 ff
20 Kuhn (1990), S. 91
21 Kantorowicz (1979), S. 26
22 Vergleiche z.B.: Kantorowicz (1979), S. 18
23 Kantorowicz (1978), S. 33 / 34
24 Vgl. z. B.: Kantorowicz (1978), S. 13 / 14
25 Er nennt hier zum Beispiel Bert Brecht und Ernst Bloch.
26 Kantorowicz (1979), S.18
27 Vergleiche hierzu: Rohrwasser (1991), S. 125; Kuhn (1990), S.96 (mit Seitennachweisen)
28 Rohrwasser (1991), S.125
29 Kuhn (1990), S.96
30 Zu dieser Frage: Rohrwasser (1991), S.113ff
31 Kantorowicz, Alfred: Der geistige Widerstand in der DDR, Troisdorf 1968
32 Interessant ist die häufige Verwendung des Wortes „Wir", wenn es um die Abgrenzung der Intellektuellen gegenüber den Funktionären geht. Auf dieses stilistische Mittel- „ihr da oben, wir hier unten"- weist Rohrwasser hin: Rohrwasser (1991), S. 123 ff
33 Kantorowicz (1968), S.4
34 Kantorowicz (1968), S.3
35 Kantorowicz(1978), S.15
36 Kantorowicz (1968), S.15
37 ebenda, S.5
38 Wo Funktionäre reden, schweigen die Musen: Zeitungsartikel vom 13.4.1963 (Mannheimer Morgen), in: Kantorowicz (1967), S. 183 ff
39 Kantorowicz (1967), S.184
40 Man denke zum Beispiel an seine nationalrevolutionäre Vergangenheit in der Weimarer Republik, seine Überzeugung, im Exil das bessere Deutschland vertreten zu müssen.
41 Mehr dazu im folgenden Abschnitt „Widersprüche"
42 Rohrwasser (1991), S. 125
43 „Rangerhöhung des Geistigen" und „Stalin- der Humanist", in: Kantorowicz(1967), S. 117 ff und S. 124 ff
44 Kantorowicz (1967), S. 12
45 Vergleiche S. 10
46 Kantorowicz (1979), S. 372
47 Rohrwasser (1991), S.124
48 vergleiche hierzu: Rohrwasser (1991), S. 122 ff
49 „Warum ich mit dem Ulbricht- Regime gebrochen habe": Rundfunkansprache vom 22.8.1957 (SFB), in: Kantorowicz (1967), S. 157
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments über Alfred Kantorowicz?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau über Alfred Kantorowicz, die ein Inhaltsverzeichnis, Zielsetzungen und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es analysiert Kantorowicz' Leben und Werk im Kontext des sozialistischen Anspruchs und der Realität der DDR.
Welche Hauptthemen werden im Inhaltsverzeichnis behandelt?
Das Inhaltsverzeichnis gliedert sich in folgende Abschnitte: I. Einleitung, II. Biographie eines Grenzgängers (mit Unterpunkten zur Zeit vor 1945, Kantorowicz in Ost-Berlin und seiner Flucht), III. Enttäuschte Hoffnungen in der DDR (Tagebuch als Reflexion, geistiger Widerstand, Widersprüche), IV. Fazit und Stellungnahme mit Literaturverzeichnis.
Was ist das Ziel der Einleitung?
Die Einleitung thematisiert den Widerspruch zwischen dem Anspruch der sozialistischen Idee und der Realität in den „real-sozialistischen" Gesellschaften Europas, insbesondere am Beispiel der DDR. Sie stellt die Frage, wie sich dieser Widerspruch auf Menschen auswirkte, die in der Theorie des Sozialismus eine Anleitung für eine „bessere Gesellschaft" sahen.
Welche Aspekte von Kantorowicz' Biographie werden behandelt?
Die Biographie beleuchtet Kantorowicz' Leben vor 1945 (Geburt, Kriegsdienst, frühe politische Ansichten), seine Zeit in Ost-Berlin (als Herausgeber von „Ost und West" und Professor an der Humboldt-Universität) sowie seine Flucht und sein „Asyl" in der Bundesrepublik.
Was sind die "Enttäuschten Hoffnungen in der DDR"?
Dieser Abschnitt befasst sich mit Kantorowicz' Erfahrungen in der DDR, insbesondere seinen täglichen Enttäuschungen, die er in seinem Tagebuch festhielt, seinem Verständnis vom „geistigen Widerstand" und den Widersprüchen in seinem Verhalten.
Was ist der Zweck der "Deutschen Tagebücher" von Alfred Kantorowicz?
Die "Deutschen Tagebücher" dienten Kantorowicz vor allem als Ventil für seine täglichen enttäuschenden Erfahrungen in der DDR. Sie sind Reflexionen seiner Ohnmacht und seiner Kritik am falschen Weg der deutschen Nachkriegspolitik.
Wie wird Kantorowicz' "geistiger Widerstand" in der DDR beschrieben?
Kantorowicz beschreibt den geistigen Widerstand als Auflehnung intellektueller Kreise gegen die totalitäre Herrschaft der SED. Dieser Widerstand basierte nicht auf Antikommunismus, sondern auf dem Glauben an die Machbarkeit eines „menschlichen Sozialismus" und fand Ausdruck in „kritischer Wachsamkeit und geistiger Eigenständigkeit".
Welche Kritikpunkte werden an Kantorowicz' Darstellung seiner Zeit in der DDR geäußert?
Kritisiert werden die subjektive Natur seiner Darstellung, mögliche Verzerrungen durch spätere Ergänzungen und die Ausblendung positiver Aspekte seines Lebens in der DDR. Auch wird auf Widersprüche in seinem Verhalten hingewiesen, z. B. seine anfängliche Unterstützung des Systems und seine spätere Kritik.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit fasst zusammen, dass Kantorowicz ein Opfer der Ideologien war, zwischen denen er zu entscheiden glaubte. Er war zunächst vom Antifaschismus motiviert, geriet aber in der DDR in ein System, dessen Opfer er schließlich wurde. Seine Biographie spiegelt die Extreme des 20. Jahrhunderts wider und ist ein Plädoyer für geistige Wachsamkeit.
Welche Werke von Alfred Kantorowicz werden im Literaturverzeichnis aufgeführt?
Das Literaturverzeichnis listet u.a. "Deutsches Tagebuch, Erster Teil", "Deutsches Tagebuch, Zweiter Teil", "Im Zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts" und "Der geistige Widerstand in der DDR" auf.
Was waren Kantorowicz Beweggründe, in die KPD einzutreten?
Kantorowicz' zentrales Motiv war sein entschiedenes Eintreten gegen den Faschismus. Er sah in der KPD die Möglichkeit, für eine freie und gleiche Gesellschaft zu kämpfen.
Was war Kantorowicz' Position nach seiner Flucht in die Bundesrepublik?
Kantorowicz sah sich am Ende in seiner Mission gescheitert, zwischen Ost und West zu wirken. Er hoffte, dass kommende Generationen aus seinen Erfahrungen lernen könnten, dass geistige Freiheit das wichtigste Gut einer Gesellschaft ist.
Welche Rolle spielte der Antifaschismus in Kantorowicz' Leben?
Der Antifaschismus war ein einigendes Band für viele Kommunisten, darunter auch Kantorowicz. Er prägte seine Entscheidungen und sein Handeln, sowohl vor als auch nach dem Krieg.
- Arbeit zitieren
- Björn Lüttmann (Autor:in), 1999, Enttäuschte Hoffnungen - Alfred Kantorowicz und die DDR, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97432