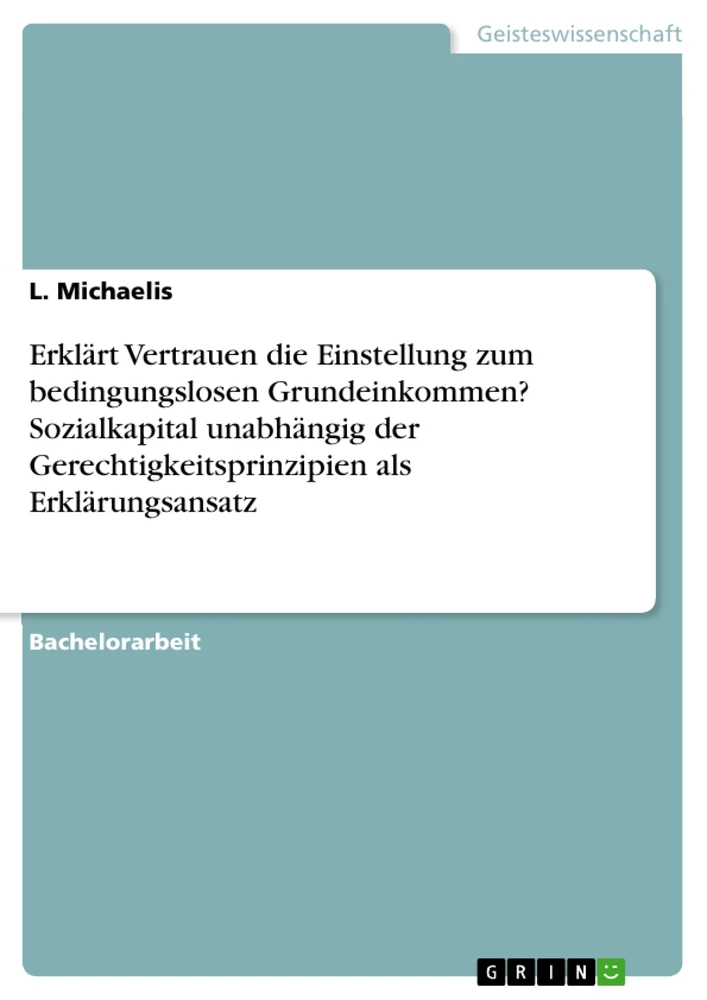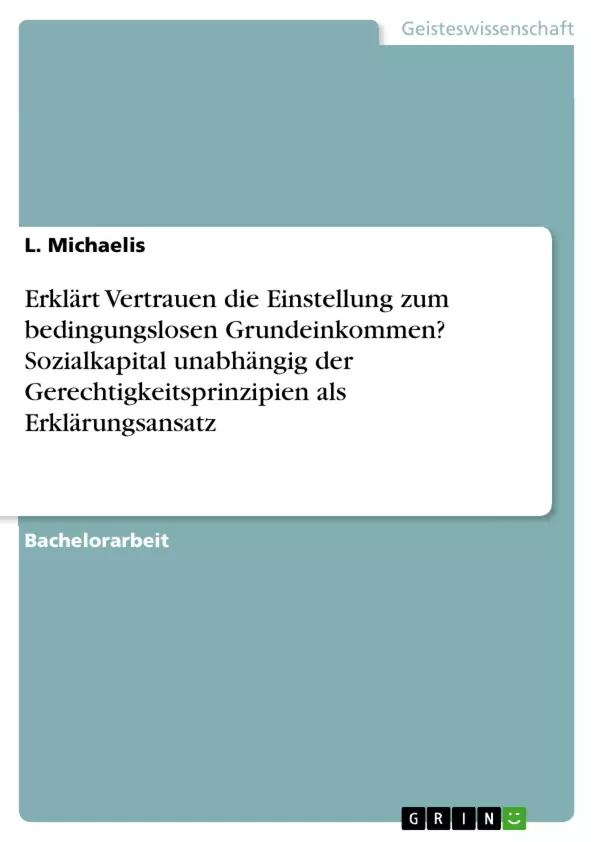Es wird im Rahmen dieser Bachelorarbeit eine empirische Untersuchungen durchgeführt, welche die Einstellung zum bedingungslosen Grundeinkommen als Forschungsgegenstand nimmt. Als möglicher Erklärungsansatz wird das Sozialkapital, in Form des generalisierten Vertrauens, nach Robert D. Putnam, theoretisch herausgearbeitet und in die empirische Analyse integriert. Ergänzend dazu werden unter anderem die Gerechtigkeitsprinzipien als Kontrollinstanz angeführt.
Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens entstand nicht erst im Zuge des 21. Jahrhunderts, sondern erfreut sich einer längeren Geschichte. So weit wie die Geschichte der Idee in die Vergangenheit ragt, so ausdifferenziert sind auch die Meinungen über die möglichen Konsequenzen. Immer und immer wieder war sie Bestandteil von geführten Diskussionen über gesellschaftliche Zukunftsszenarien. Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat sie allerdings noch keinen Durchbruch verzeichnen können.
Unsere heutige Gesellschaft ist geprägt von einem manifestierten Fortschrittsgedanken. Die wohl größte Entwicklungstendenz zeichnet sich offenkundig durch die voranschreitende Digitalisierung ab. Sie wird als eine der größten Herausforderungen unserer westlichen Gesellschaften postuliert. Der technische Fortschritt ist schon seit der Industrialisierung ein großes Thema, doch heutzutage scheint der Einfluss auf die Arbeitsgesellschaft noch drastischer und schneller als zuvor zu verlaufen. Etliche Zukunftsprognosen könnten einem guten Science-Fiction-Film entstammen. Sie kündigen eine bevorstehende Zeit an, in welcher die menschliche Arbeitskraft durch Informationstechnologien und Roboter ersetzt wird. Dieser umschriebene Trend mündet in einer ansteigenden Angst um den Verlust von Arbeitsplätzen, niemand möchte gesellschaftlich abgehängt werden. Um die Vorteile der voranschreitenden Digitalisierung spüren zu können, wird es Zeit für neue Ideen bezüglich unserer, durch die Arbeit strukturierten, Gesellschaft. In der öffentlichen Diskussion wird nicht mehr nur eine Debatte darüber geführt, wie die alten Strukturen besser angepasst werden können, sondern es werden Ideen für eine neue Strukturierung gesammelt. Großer Fortschritt bedeutet auch gleichzeitig Veränderung. Eine Idee, die in diesem Kontext oft genannt wird, ist die Konzeption eines bedingungslosen Grundeinkommens.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Forschungsgegenstand – Das bedingungslose Grundeinkommen
- 3. Theoriehintergrund
- 3.1. Sozialkapitaltheorie nach Robert D. Putnam
- 3.1.1. Entstehung Sozialkapital
- 3.1.2. Wirkung Sozialkapital
- 3.1.2.1. Generalisiertes Vertrauen
- 3.2. Soziale Gerechtigkeit
- 3.2.1. Startchancen
- 3.2.2. Leistung
- 3.2.3. Bedarf
- 3.2.4. Gleichheit
- 3.2.5. Zielbeziehungen
- 4. Hypothesenformulierung
- 5. Forschungsstand
- 6. Daten und Methoden
- 6.1. Erhebungsform, -verfahren und -inhalt
- 6.2. Operationalisierung
- 7. Darstellung der Ergebnisse
- 7.1.1. Bedingungsloses Grundeinkommen
- 7.1. Deskriptive Statistik
- 7.1.2. Sozialkapital
- 7.1.3. Gerechtigkeitsprinzipien
- 7.2. Analyse bivariater Zusammenhänge
- 7.2.1. Bedingungsloses Grundeinkommen und Sozialkapital
- 7.2.2. Bedingungsloses Grundeinkommen und Gerechtigkeitsprinzipien
- 7.3. Analyse multivariater Zusammenhänge
- 7.3.1. Darstellung der Ergebnisse der logistischen Regressionsanalyse
- 7.3.1.1. Block I
- 7.3.1.2. Block II
- 7.3.1.3. Block III
- 7.3.1.4. Block IV
- 7.3.2. Multikollinearität
- 8. Zusammenfassende Interpretation und Diskussion der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit zielt darauf ab, die Einstellung zum bedingungslosen Grundeinkommen empirisch zu untersuchen. Dabei wird das Sozialkapital, insbesondere das generalisierte Vertrauen, als Erklärungsansatz nach Robert D. Putnam herangezogen. Zusätzlich werden Gerechtigkeitsprinzipien als Kontrollfaktoren berücksichtigt. Die Arbeit soll zeigen, ob der Grad des generalisierten Vertrauens die Einstellung zum bedingungslosen Grundeinkommen beeinflusst.
- Das bedingungslose Grundeinkommen als gesellschaftliche Vision im Kontext der Digitalisierung
- Die Rolle des Sozialkapitals (generalisiertes Vertrauen) für die Einstellung zum bedingungslosen Grundeinkommen
- Die Relevanz von Gerechtigkeitsprinzipien für die Bewertung des bedingungslosen Grundeinkommens
- Empirische Untersuchung mittels quantitativer Online-Befragung
- Bivariate und multivariate statistische Analysen mit STATA
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Forschungsgegenstand des bedingungslosen Grundeinkommens einführt und die Relevanz der Thematik im Kontext der Digitalisierung hervorhebt. Anschließend wird die Sozialkapitaltheorie nach Robert D. Putnam erläutert, wobei der Fokus auf dem Konzept des generalisierten Vertrauens liegt. Weiterhin werden die verschiedenen Gerechtigkeitsprinzipien vorgestellt, die als Kontrollfaktoren in der Analyse dienen. Die Arbeit formuliert Hypothesen, um die Beziehung zwischen generalisiertem Vertrauen, Gerechtigkeitsprinzipien und der Einstellung zum bedingungslosen Grundeinkommen zu untersuchen. Die Daten und Methoden werden beschrieben, einschließlich der Durchführung einer quantitativen Online-Befragung und der statistischen Analyse mit STATA. Die Kapitel zur Darstellung der Ergebnisse liefern deskriptive Statistiken zum bedingungslosen Grundeinkommen, zum Sozialkapital und zu den Gerechtigkeitsprinzipien. Außerdem werden bivariate und multivariate Zusammenhänge zwischen diesen Variablen untersucht. Die Arbeit endet mit einer Interpretation und Diskussion der Ergebnisse, die Hinweise auf die Bedeutung des generalisierten Vertrauens für die Einstellung zum bedingungslosen Grundeinkommen geben.
Schlüsselwörter
Bedingungsloses Grundeinkommen, Sozialkapital, generalisiertes Vertrauen, Gerechtigkeitsprinzipien, Digitalisierung, Empirische Forschung, Online-Befragung, STATA, Bivariate und multivariate Analyse, Einstellung, Gesellschaftliche Teilhabe
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst Vertrauen die Einstellung zum Grundeinkommen?
Die Arbeit untersucht die These, dass ein hohes Maß an generalisiertem Vertrauen (Sozialkapital) die Akzeptanz für ein bedingungsloses Grundeinkommen erhöht, da man darauf vertraut, dass andere das System nicht ausnutzen.
Was besagt die Sozialkapitaltheorie von Robert D. Putnam?
Putnam definiert Sozialkapital als Netzwerke, Normen und Vertrauen, die es den Teilnehmern ermöglichen, effektiver zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Ziele zu verfolgen.
Welche Gerechtigkeitsprinzipien spielen eine Rolle?
In der Analyse werden Prinzipien wie Leistung, Bedarf, Gleichheit und Startchancen als Kontrollfaktoren herangezogen, um die Bewertung des Grundeinkommens zu erklären.
Warum ist das Grundeinkommen im Kontext der Digitalisierung relevant?
Die voranschreitende Digitalisierung weckt Ängste vor Jobverlusten durch Roboter und KI. Das Grundeinkommen wird als mögliche Lösung für eine neue Strukturierung der Arbeitsgesellschaft diskutiert.
Wie wurde die empirische Untersuchung durchgeführt?
Die Daten wurden mittels einer quantitativen Online-Befragung erhoben und anschließend mit statistischen Verfahren wie der logistischen Regressionsanalyse in STATA ausgewertet.
- Arbeit zitieren
- L. Michaelis (Autor:in), 2018, Erklärt Vertrauen die Einstellung zum bedingungslosen Grundeinkommen? Sozialkapital unabhängig der Gerechtigkeitsprinzipien als Erklärungsansatz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/974343