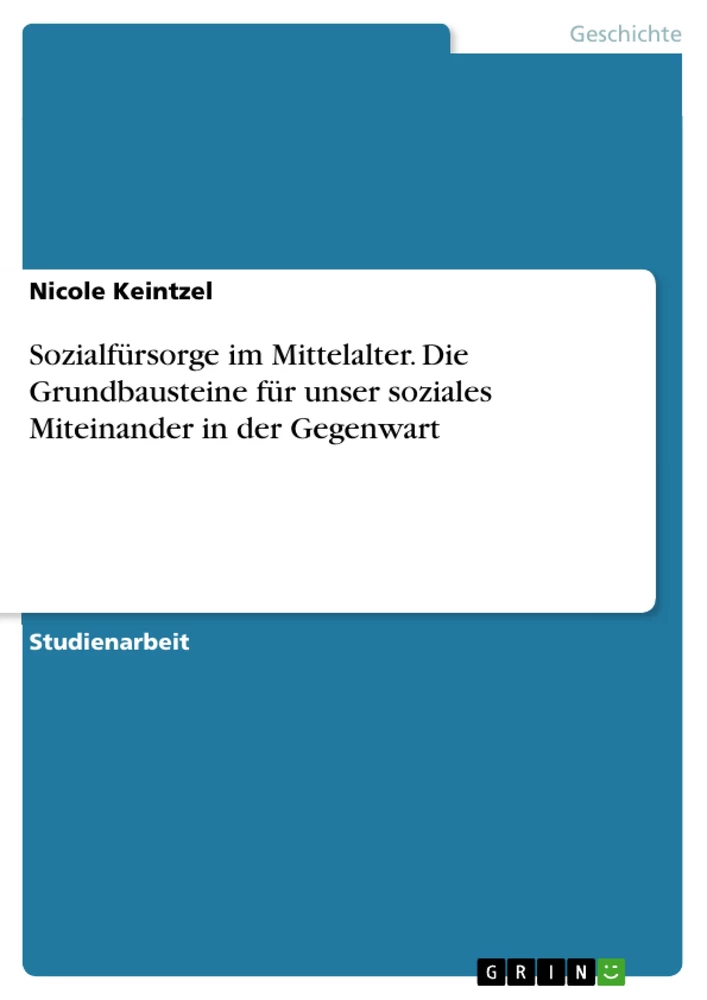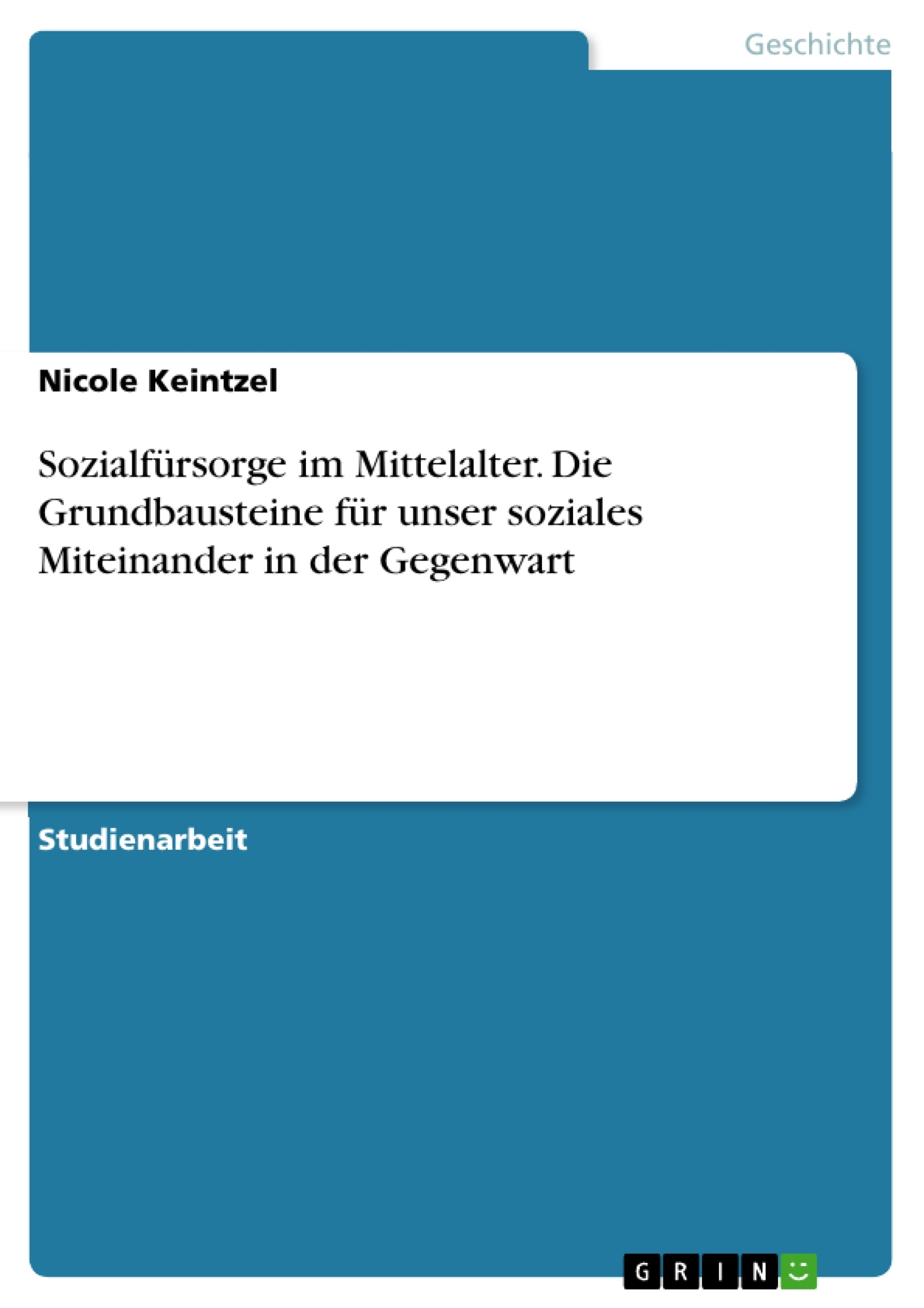Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Armenfürsorge, ausgehend von den aus christlicher Nächstenliebe gespendeten Almosen bis hin zum Spitalwesen und den heutigen Parallelen.
Zunächst wird dafür der Armutsbegriff erläutert und eingeschränkt und die verschiedenen Abstufungen und Armutsgruppen aufgeführt. Die Zuständigkeit für Hilfsbedürftige, sprich Aufgaben der städtischen Armenfürsorge und Armutsbekämpfung und das Entstehen des Spitalwesens geben erste Rückschlüsse auf die heutige Sozial- und Armenfürsorge. Dabei wird insbesondere das Heilig-Geist-Spital aus regionalem Kontext hervorgehoben. Im weiteren Verlauf des Textes wird die Entwicklung des Fürsorgesystems behandelt. Da Armut im Mittelalter ein sehr umfangreiches Thema ist, und es bis jetzt noch nicht gelungen ist bisherige Forschungsergebnisse in einer Überblicksdarstellung zusammenzufassen, wird sich diese Arbeit zeitlich auf das Hoch- und Spätmittelalter fokussieren, wobei verständnishalber an einigen Stellen auch andere Zeitabschnitte genannt werden. Räumlich beschränkt sich diese Arbeit ausschließlich auf deutsche Städte.
Armut - eine Problematik die sich in allen Epochen der Geschichte finden lässt. Trotz des Verlaufs durch verschiedene Formen ist Armut auch heute ein allgegenwärtiges Thema, mit dem der Großteil der Weltbevölkerung mindestens einmal im Leben konfrontiert wird, ein Thema das sich nicht nur in der Dritten Welt wiederfinden lässt, sondern auch hier in Deutschland und anderen Industriestaaten und Staatshandelsländern.
Soweit liegt es auch sehr nah, dass das Thema Armut und Armenfürsorge die internationale Geschichtswissenschaft, als auch die Kirchengeschichte beschäftigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erläuterung des Armutsbegriffs
- Zuständigkeit
- Spitalwesen
- Heilig-Geist-Spital Nürnberg
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Armen- und Sozialfürsorge im deutschen Hoch- und Spätmittelalter. Sie beleuchtet die historischen Wurzeln unserer heutigen Sozialsysteme und zeigt die Parallelen zwischen mittelalterlichen und modernen Ansätzen der Armutsbekämpfung auf. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Armutsbegriffs, der Zuständigkeit für die Armenfürsorge und dem Spitalwesen.
- Entwicklung des Armutsbegriffs im Mittelalter
- Rollen der Kirche und des Staates in der Armenfürsorge
- Das Spitalwesen als zentrale Institution der Fürsorge
- Das Heilig-Geist-Spital Nürnberg als regionales Beispiel
- Parallelen zwischen mittelalterlicher und moderner Sozialfürsorge
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Armen- und Sozialfürsorge im Mittelalter ein und betont die historische Relevanz dieses Themas für unser heutiges Verständnis von sozialem Miteinander. Sie skizziert den Forschungsstand und die methodische Vorgehensweise der Arbeit, welche sich auf das Hoch- und Spätmittelalter in deutschen Städten konzentriert.
Erläuterung des Armutsbegriffs: Dieses Kapitel analysiert den Wandel des Armutsbegriffs im Mittelalter. Es unterscheidet zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Armut und beleuchtet die unterschiedlichen Auffassungen und Kategorisierungen von Armut vor und nach dem Hochmittelalter. Es wird auf die soziale und ökonomische Dimension des Armutsbegriffs eingegangen und die unterschiedlichen Armutsstufen (primäre, sekundäre, tertiäre Armut) erläutert, in Verbindung mit der Rolle der Religion und der sich verändernden gesellschaftlichen Einstellungen zum Betteln.
Zuständigkeit: Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen Akteure und Institutionen, die im Mittelalter für die Armenfürsorge zuständig waren. Es beschreibt die anfängliche Rolle der Familie und den späteren Aufstieg kirchlicher und städtischer Institutionen. Die Bedeutung von Almosen und die Entwicklung von Armenverordnungen werden diskutiert, wobei die Grenzen der Nächstenliebe und die Motivation der Spender beleuchtet werden.
Spitalwesen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das Spitalwesen als zentrale Institution der mittelalterlichen Armenfürsorge. Es verfolgt die Entwicklung des Spitals vom oströmischen Reich bis ins Hoch- und Spätmittelalter, beleuchtet die verschiedenen Typen von Spitälern (geistlich, städtisch, ritterlich), deren Aufgaben und Finanzierung und beschreibt die Rolle von Stiftungen und Stiftern.
Heilig-Geist-Spital Nürnberg: Dieses Kapitel präsentiert eine Fallstudie des Heilig-Geist-Spitals in Nürnberg. Es beschreibt die Gründung, Entwicklung und die Bedeutung des Spitals für die Stadt Nürnberg, die Rolle des Stiftungsgründers Konrad Groß und die Funktionen des Spitals als soziale und medizinische Einrichtung, einschließlich seiner Bedeutung im Kontext des Bevölkerungswachstums und der sozialen Herausforderungen des Mittelalters.
Schlüsselwörter
Armenfürsorge, Mittelalter, Armut, Spitalwesen, Heilig-Geist-Spital Nürnberg, Nächstenliebe, Almosen, soziale Ungleichheit, Stiftungen, städtische Entwicklung, christliche Moral.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Armen- und Sozialfürsorge im deutschen Hoch- und Spätmittelalter
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Armen- und Sozialfürsorge im deutschen Hoch- und Spätmittelalter. Sie beleuchtet die historischen Wurzeln unserer heutigen Sozialsysteme und zeigt Parallelen zwischen mittelalterlichen und modernen Ansätzen der Armutsbekämpfung auf. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Armutsbegriffs, der Zuständigkeit für die Armenfürsorge und dem Spitalwesen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Entwicklung des Armutsbegriffs im Mittelalter, Rollen der Kirche und des Staates in der Armenfürsorge, das Spitalwesen als zentrale Institution der Fürsorge, das Heilig-Geist-Spital Nürnberg als regionales Beispiel und Parallelen zwischen mittelalterlicher und moderner Sozialfürsorge.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Erläuterung des Armutsbegriffs, Zuständigkeit, Spitalwesen, Heilig-Geist-Spital Nürnberg und Fazit.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in das Thema ein, betont die historische Relevanz, skizziert den Forschungsstand und die methodische Vorgehensweise. Sie konzentriert sich auf das Hoch- und Spätmittelalter in deutschen Städten.
Wie wird der Armutsbegriff im Mittelalter erläutert?
Das Kapitel analysiert den Wandel des Armutsbegriffs, unterscheidet zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Armut, beleuchtet unterschiedliche Auffassungen und Kategorisierungen vor und nach dem Hochmittelalter, betrachtet die soziale und ökonomische Dimension und erläutert Armutsstufen (primär, sekundär, tertiär) im Zusammenhang mit Religion und gesellschaftlichen Einstellungen zum Betteln.
Wer war im Mittelalter für die Armenfürsorge zuständig?
Das Kapitel behandelt die Akteure und Institutionen, beginnend mit der Rolle der Familie und dem Aufstieg kirchlicher und städtischer Institutionen. Es diskutiert die Bedeutung von Almosen und die Entwicklung von Armenverordnungen, beleuchtet die Grenzen der Nächstenliebe und die Motivation der Spender.
Welche Rolle spielte das Spitalwesen?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf das Spitalwesen als zentrale Institution. Es verfolgt dessen Entwicklung vom oströmischen Reich bis ins Hoch- und Spätmittelalter, beleuchtet verschiedene Spitaltypen (geistlich, städtisch, ritterlich), deren Aufgaben und Finanzierung und beschreibt die Rolle von Stiftungen und Stiftern.
Was ist die Bedeutung des Heilig-Geist-Spitals Nürnberg?
Dieses Kapitel präsentiert eine Fallstudie des Heilig-Geist-Spitals in Nürnberg. Es beschreibt Gründung, Entwicklung und Bedeutung für die Stadt, die Rolle des Stiftungsgründers Konrad Groß und die Funktionen des Spitals als soziale und medizinische Einrichtung im Kontext des Bevölkerungswachstums und der sozialen Herausforderungen des Mittelalters.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Armenfürsorge, Mittelalter, Armut, Spitalwesen, Heilig-Geist-Spital Nürnberg, Nächstenliebe, Almosen, soziale Ungleichheit, Stiftungen, städtische Entwicklung, christliche Moral.
- Quote paper
- Nicole Keintzel (Author), 2019, Sozialfürsorge im Mittelalter. Die Grundbausteine für unser soziales Miteinander in der Gegenwart, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/974764