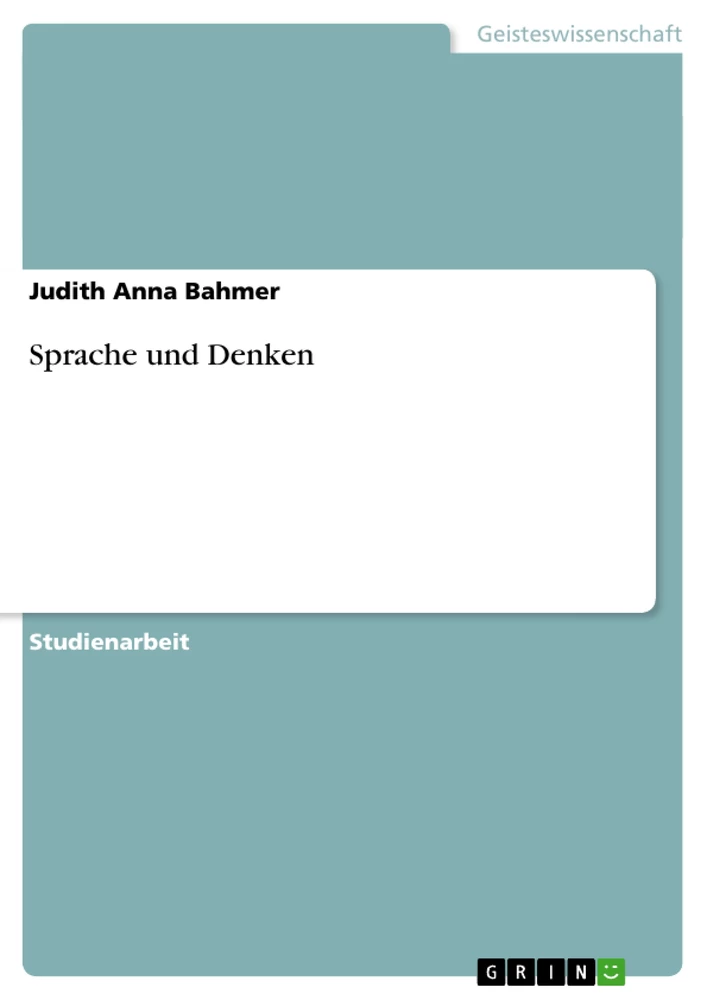Stellen Sie sich vor, Ihre Gedanken wären nicht Ihre eigenen, sondern ein Echo der Sprache, die Sie sprechen. Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine faszinierende Reise in die Tiefen des menschlichen Geistes, um das komplexe und oft unterschätzte Verhältnis zwischen Sprache und Denken zu ergründen. Anhand bahnbrechender Forschung und provokanter Theorien, darunter die einflussreiche Sapir-Whorf-Hypothese, wird die Vorstellung in Frage gestellt, dass Sprache lediglich ein Werkzeug zur Artikulation vorgefertigter Gedanken ist. Vielmehr wird enthüllt, wie unsere Muttersprache unsere Wahrnehmung der Welt formt, von unseren grundlegendsten Begriffen von Raum und Zeit bis hin zu unseren kulturellen Normen und Verhaltensweisen. Entdecken Sie, wie unterschiedliche Sprachen zu unterschiedlichen Denkweisen führen können, indem die Hopi-Sprache und europäische Sprachen vergleichend gegenübergestellt werden, wodurch kulturelle Unterschiede aufgedeckt werden. Erfahren Sie, wie die Sprache unser Gedächtnis beeinflusst, die Problemlösungsfähigkeiten steuert und die Art und Weise prägt, wie wir die Realität konstruieren. Dieses Buch ist nicht nur eine theoretische Abhandlung, sondern bietet auch praktische Einblicke in die Bedeutung der Sprachentwicklung, insbesondere bei Kindern, und zeigt auf, wie sprachliche Kompetenz unsere kognitiven Fähigkeiten maßgeblich beeinflussen kann. Begleiten Sie uns auf einer intellektuellen Entdeckungsreise, die Ihr Verständnis von Sprache, Denken und der menschlichen Erfahrung selbst grundlegend verändern wird. Tauchen Sie ein in die Welt der Linguistik, Psycholinguistik und Kognitionswissenschaft, und entschlüsseln Sie die Geheimnisse, wie Sprache unsere Realität formt. Für jeden, der sich für Philosophie, Psychologie, Erziehungswissenschaften oder einfach nur für die Funktionsweise des menschlichen Geistes interessiert, bietet dieses Buch neue Perspektiven und wertvolle Erkenntnisse. Lassen Sie sich von den innovativen Ideen inspirieren und erweitern Sie Ihren Horizont.
Inhalt
1. Einleitung
2. Das gewohnheitsmäßige Denken und sein Verhältnis zur Sprache
2.1 Die Bedeutung des Begriffs
2.2 Die Natur vermittelnder Prozesse
3. Sprache als Steuerungsinstrument bei der Problemlösung
3.1 Experimentelle Belege
3.2 Kodierung und Gedächtnis
3.3 Kodierung und die syntaktische Struktur der Sprache
4. Die Saphir-Whorf-Hypothese der linguistischen Relativität
4.1 Hintergrund der Hypothese
4.2 Hintergrundscharakter von Sprachphänomenen
4.3 Die Grammatik und ihr Einfluß auf den Gedanken Vergleich von Hopi und SAE (Standard Average European)
4.4 Das linguistische Relativitätsprinzip
4.5 Kritik an der Theorie linguistischer Relativität
5. Motortheorie des Denkens
5.1 Denken als verinnerlichtes Sprechen
6. Die Kognitionshypothese
7. Integration von Sprache und Denken als Entwicklungsprozeß
7.1 Sprachbarrieren
7.2 Didaktische Konsequenzen
8. Zusammenfassung
9. Literatur
1. Einleitung
Jeder Mensch, der in den ersten Jahren seines Lebens sprechen gelernt hat, kann sprechen und gebraucht die Sprache, ohne sich ihrer eigentlichen Bedeutung bewußt zu werden oder sie gar zu hinterfragen. Es existieren naive, tief eingewurzelte Vorstellungen über das Sprechen und dem Verhältnis zwischen Sprache und Denken. Unsere Sprachfertigkeiten geben Anlaß zu der Vermutung, die Sprache sei ein beiläufiger Vorgang, der ausschließlich dazu dient, schon formulierte Gedanken weiterzugeben. Mit der Entstehung der "Gedanken", so meinen wir, hat die Sprache nichts zu tun. Beim Gebrauch der Sprache wird also nur ausgedrückt, was unsprachlich bereits vorformuliert war. Die Formulierung ist in dieser Annahme ein unabhängiger Vorgang, der auch allgemein als Denken bezeichnet wird. Ist jedoch diese Annahme richtig? Ist es das Denken, das unsere Wahrnehmung und den sprachlichen Ausdruck steuert, oder wird das Denken und Weltsicht ganz maßgeblich durch die Systematik und Logik unserer Sprache beeinflußt?
Diese und andere Fragen zum Verhältnis zwischen Sprache und Denken sollen im folgenden Text auf der Basis unterschiedlicher Hypothesen und Vorstellungen geklärt werden.
2. Das gewohnheitsmäßige Denken und sein Verhältnis zur Sprache
"Menschliche Wesen leben weder nur in der objektiven Welt noch allein in der, die man gewöhnlich die Gesellschaft nennt. Sie leben auch sehr weit gehend in der Welt der besonderen Sprache, die für ihre Gesellschaft zum Medium des Ausdrucks geworden ist. Es ist durchaus eine Illusion zu meinen, man passe sich der Wirklichkeit im wesentlichen ohne Hilfe der Sprache an und die Sprache sei lediglich ein zufälliges Mittel für die Lösung der spezifischen Probleme der Mitteilung und der Reflexion. Tatsächlich wird die "Reale Welt" sehr weitgehend unbewußt auf den Sprachgewohnheiten der erbaut [...] Wir sehen und hören und machenüberhaupt unsere Erfahrungen in Abhängigkeit von den Sprachgewohn heiten unserer Gemeinschaft, die uns gewisse Interpretationen vorweg nahelegen."
- EDWARD SAPHIR -
Edward Saphir drückt in diesen Zeilen aus, daß unseren Denk- und Verhaltensweisen in vielen Fällen ein bestimmter Sprachgebrauch zugrunde liegt. Wer sich allerdings auf diese einzige Annahme beschränkt, verfehlt den zentralen Punkt, der besagt, daß ein deutlicher Zusammenhang zwischen Sprache, Kultur und Psychologie besteht. Die Sprache - so Saphir - beeinflußt sowohl unsere kulturellen und persönlichen Aktivitäten, als auch unsere Wahrnehmung.
2.1 Die Bedeutung des Begriffs
Gemäß der Vorstellung der Assoziationspsychologie entsteht die Verbindung von Wort und Bedeutung nach den Gesetzen der Assoziation. Das Wort und der Gegenstand, der durch das Wort ausgedrückt werden soll, fallen dabei oftmals zusammen. Es bildet sich so eine feste Verbindung zwischen der Bezeichnung und dem Bezeichneten. Die Gestaltpsychologie überwand diese einfache Vorstellung und betrachtete das Denken als einen von der Sprache unabhängigen Prozeß, der sich vorwiegend in anschaulichen Gedanken vollziehe. Sprache wurde in dieser Theorie zum Instrument, mit dem man die Gedanken zum Ausdruck bringt. Das Denken gehorcht ebenfalls Gestaltgesetzen - das Wort wird Teil einer umfassenden Bedeutungsstruktur.
Diese ältere Vorstellung zeichnet sich besonders dadurch aus, daß die Bedeutungseinheiten (meist Begriffe und Worte) konstant und unveränderbar sind. Begriffe und Worte verändern sich demnach nicht, sondern werden gefunden und gebildet und unverändert beibehalten. Dies ist eine sprachinstrumentalistische Vorstellung, denn sie geht davon aus, daß die Sprache nur ein Istrument zur Übersetzung und Umsetzung von Denkvorgängen ist. Das Denken an sich wird als unabhängiger Prozeß angesehen. Begriffe sind demnach Vermittler zwischen den Reizmustern (Objekt in der Umwelt) und dem Antwortverhalten (Sprache, Handlung). Ein Wort stellt also die Verbindung zwischen einem Objekt oder einer Objektklasse und dem Antwortverhalten her. Wenn die Repräsentation eines Objektes ein vermittelnder Prozeß ist, so ist einleuchtend, daß dieser Prozeß durch die Sprache verbessert werden kann. Experimente haben gezeigt, daß eine Repräsentation eines Objektes leichter ins Gedächtnis gerufen werden kann, wenn sie mit einem Wort verknüpft ist. Dabei bezeichnet das Wort oftmals mehr als nur ein Objekt. Der Begriff "Hund" steht beispielsweise für eine ganze Klasse tierischer Objekte und nicht nur für einen einzigen, konkreten Hund. Vermittelnde Prozesse werden aus diesem Grunde oft daraufhin untersucht, ob sie Begriffe zur Folge haben, d.h. ob durch den vermittelnden Prozeß eine Menge von gleichartigen oder ähnlichen Objekten zu einer Klasse (oder Dimension) zusammengefasst wird.
2.2 Die Natur vermittelnder Prozesse
Kendler und Mitarbeiter (1963) führten eine Reihe von Experimenten zu vermittelnden Prozessen durch. Ihr Ansatz soll exemplarisch an einem experimentellen Beispiel näher erläutert werden:
Kindern verschiedener Altersstufen wurden zwei Paare von Abbildungen gezeigt (Abb 1). Das eine Kartenpaar zeigt ein großes schwarzes Quadrat (S) und ein kleines weißes Quadrat (w). Das andere Kartenpaar zeigt ein kleines schwarzes Quadrat (s) und ein großes weißes Quadrat (W). Die Kartenpaare enthielten also jeweils Reize zweier Merkmalsdimensionen: "Gr öß e" und "Helligkeit".
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Kartensets im Versuch von Kendler et al. (1963)
Das Kind durfte nun von einem Kartenpaar eine Karte auswählen. Die "richtige" Karte wurde mit einer Murmel belohnt.
Jede der vier möglichen Begriffe (groß-schwarz-klein-weiß) wurde für ein Viertel der Probanden belohnt und war somit richtig. Sollte ein Kind also die Dimension "schwarz" lernen, so wurden die Karten s und S belohnt - bei Wahl von W oder w mußte das Kind je eine Murmel wieder abgeben. Nachdem das Kind den Begriff "schwarz" gelernt hatte, wurde eine zweite Reizserie geboten, die nur jeweils eine Karte der zwei Paare enthielt (z.B. S und w). Das Belohnungssystem wurde so geändert, daßnur noch bei Wahl von w belohnt wurde. Es gab nun drei Möglichkeiten, wie das Kind auf die "richtige" Karte mit dem kleinen weißen Quadrat kommen konnte:
1. Das Kind konnte das Merkmal "klein" bei "weiß" für richtig halten - dies wäre analog zu einem Schwenk von der Gr öß endimension auf die Helligkeitsdimension.
2. Das Kind konnte nur "weiß" betrachten, dann blieb es innerhalb der gleichen, ersten Dimension.
3. Das Kind konnte in der Betrachtung der Dimensionen wechseln.
Um zu bestimmen, auf welcher Basis in der zweiten Reizserie ausgewählt wurde, führten die Versuchsleiter noch eine dritte Serie durch. Hier bestand das Set aus einer Karte mit einem großen weißen Quadrat und einem kleinen schwarzen Quadrat (sowie S und w als restlichem Kartenpaar). Hier konnte das Kind entweder auf "weiß" oder auf "klein" reagieren, nicht jedoch auf beide Dimensionen, weil es sich für eine der Karten entscheiden musste. Wählte das Kind in 10 Durchgängen "klein", so zeigte es, daßes auch in diesem Durchgang nach dem Kriterium "Gr öß e" entschieden hatte. Wählte es abwechselnd unterschiedliche Karten, so wurde sein Verhalten als inkonsistent eingestuft.
Deutet man die Untersuchung in Sinne des klassischen Behaviorismus, so lernt das Kind in der ersten Serie das Merkmal "schwarz" nach der direkten S-R-Koppelung durch positive Verstärkung (Belohnung). Im zweiten Durchgang muss das Kind dagegen auf "weiß" umlernen, wobei ihm eigentlich leichter fallen müsste, das große weiße Quadrat zu wählen, weil im ersten Durchgang ja das große Quadrat verstärkt wurde. Dem Kind müsste also leicht fallen, Größe als entscheidende Dimension zu wählen. In der Tat zeigten die Versuche, daß besonders jüngere Kinder diese Dimension bevorzugt wählen. Daneben fanden Kendler et al. aber auch inkonsistente Verhaltensweisen bei Kindern (Wechsel zwischen den Dimensionen). Betrachtet das Kind in der ersten Reizserie beim Erlernen des Merkmals "schwarz" die Helligkeitsdimension, so muß bereits der Begriff Helligkeit als vermittelnder Prozeß vorhanden sein. In der Kontrollsituation wäre dies der Fall, wenn das Kind die Karte mit dem großen weißen Quadrat wählt (die vorher noch nicht verstärkt wurde). Die Versuche von Kendler und Mitarbeitern zeigen, daß es sprachfreie Begriffsbildung gibt. Sie stellten in einer zweiten Untersuchung den Kindern noch einige Fragen zu den Karten und befragten sie nach den Kriterien für ihre Auswahl. Tatsächlich konnten Kinder, die innerhalb der gleichen Dimension umlernten (reversal shift), die richtige Dimension, nach der sie urteilten (also Helligkeit) benennen. Kinder, die auf eine neue Dimension (Größe) umschwenkten, benannten ebenfalls in einem hohen Prozentsatz die richtige Urteilsdimension. Anders verhielt es sich bei den Kindern, die sich inkonsistent verhalten hatten: Sie zeigten vermehrt irrelevante sprachliche Äußerungen. Kendler et al. unterscheiden auf Basis ihrer Untersuchungen drei unterschiedliche Entwicklungsniveaus:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab.1: Charakteristika verschiedener Entwicklungsniveaus vermittelnder Prozesse.
Die Ergebnisse von Kendler und Mitarbeitern sprechen insgesamt für die Existenz vermittelnder Prozesse zwischen dem Denken und Sprache und gegen die Annahmen der Gestaltpsychologie.
Dabei ist das Ausmaß an vermittelnden Prozessen stark vom Lebensalter (oft auch als Intelligenzalter bezeichnet) abhängig. Im Laufe der Entwicklung werden immer mehr vermittelnde Prozesse möglich. Das bedeutet gleichzeitig, daß sprachliche Mittler den Denkprozeß immer stärker unterstützen. Die Synthese zwischen Sprache und Begriff führt zu einer zunehmenden Leistungssteigerung bei Problemstellungen. Nach Bruner handelt es sich hierbei um die "sprachlich-symbolische Repräsentation", die uns rasch ablaufende Denkoperationen ermöglicht.
3. Die Steuerungsfunktion der Sprache bei der Lösung von Problemen
Der letzte Abschnitt zeigt, daß uns die Sprache Problemlösung dadurch unterstützt, daß sie Etiketten und Begriffe als Repräsentationen äußerer Objekte zur Verfügung stellt (verbal labeling). Es wäre allerdings zu einseitig, würde man die Funktion der Sprache nur auf die Klassifikation und Etikettierung beschränken. So befaßte sich beispielsweise Luria (1961) mit dem Zusammenhang zwischen Sprache und Handlung. Auf ihrem untersten Niveau hat - seiner Ansicht nach - die Sprache keinen Einfluß auf das Verhalten. Die Regulierung der Aktion erfolgt durch Signale, die aus der eigenen Handlung entstehen. Ein Kind von zwei Jahren kann beispielsweise richtig auf ein Lichtsignal reagieren (z.B. mit Druck auf eine Taste). Gibt es keinen Reiz, der die Aktion rückmeldet, so drückt das Kind immer weiter. Dies ist bei Kindern unter zwei Jahren noch der Fall. In einer nächsten Stufe dient die eigene Sprache bereits als Impuls für die Handlung. Das Kind drückt beispielsweise auf sein eigenes Kommando "drücken". Die Sprache hat allerdings nur aktivierenden und nicht auch hemmenden Charakter, d.h. auch auf die Äußerung "nicht drücken" drückt das Kind weiter. Nach Luria ändert sich dies zwischen viereinhalb und fünfeinhalb Jahren. In dieser Zeit wandelt sich die Sprache von einem impulsgebenden System in ein Zeichensystem. Dies zeigt sich anfänglich besonders darin, daß alle Aktionen sprachlich begleitet werden. Die Sprache hat nun auch hemmenden Charakter. Sagt das Kind "nicht drücken", so drückt es auch nicht. Bald darauf kann das Kind sein Verhalten auch kontrollieren, ohne daß es laut jede Handlung kommentiert, anregt oder hemmt. Nach Wygotski (1986) geht das Verstummen der äußeren Sprache einher mit einer allgemeinen Veränderung der Syntax. Das Kind verwendet allgemein mehr Verben - die Sprache wird prädikativer. Auch wenn das Kind laut verbalisiert, neigt es in dieser Phase dazu, Sätze zu verkürzen.
Wird das Kind mit einer schwierigen, nicht alltäglichen Situation konfrontiert, greift es jedoch wieder auf das äußere Sprechen zurück. So können auch komplexe Handlungsabläufe kontrolliert und schwierigere Aufgaben gemeistert werden.
Erwachsene verbalisieren ihr Verhalten, wenn sie Handlungsabläufe nicht stillschweigend meistern können. Allerdings sind die Ausdrucksweisen, die der Erwachsene gebraucht (Erst muss ich... Wie war das noch...) bereits Ausdruck einer inneren Sprache höherer Ordnung. Wie diese innere Sprache beschaffen sein soll, bleibt unklar. Nach den Ausführungen Wygotskis ist die innere Sprache in ihrem Endzustand etwas völlig anderes als die äußere, ausformulierte Sprache. Sie wird von ihm als Prozeß des "sprachlichen Denkens" verstanden. Er schreibt: "Die innere Sprache ist in beträchtlichem Maße ein Denken mit reinen Bedeutungen. Sie ist dynamisch inkonstant und flukturierend und erscheint zwischen den stabileren, extremen Polen des sprachlichen Denkens - zwischen dem Wort und den Gedanken." (Wygotski, 1964, S. 350). Die innere Sprache ist jedoch selbst bei Wygotski durchaus nicht das Denken selbst. Sprache und Denken bilden nach seiner Ansicht nach über eine Synthese ein neues Ganzes.
3.1 Experimentelle Belege
Gagné und Smith (1962) studierten an einer sprachfreien Aufgabe ("Turm von Hanoi"1 ) den Effekt, den das Verbalisieren auf das Verhalten beim Problemlösen hat.
28 Versuchspersonen (Jungen im Alter von 15 bis 16 Jahren) wurde die Aufgabe "Der Turm von Hanoi" gegeben. Nach einer Trainingsphase, in der alle Probanden mit der Aufgabe vertraut gemacht wurden, sollten sie die Aufgaben dreier unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade (3,4 und 5 Scheiben) bewältigen. Die Jungen wurden in unterschiedliche Versuchsgruppen eingeteilt:
Gruppe 1: musste bei jedem Zug angeben, warum der Zug ausgeführt wurde. Zusätzlich sollte am Ende das Lösungsprinzip angegeben werden.
Gruppe 2: musste auch verbalisieren, wurde aber nicht instruiert, das Lösungsprinzip zu erfassen.
Gruppe 3: sollte am Ende das Lösungsprinzip angeben, mußte aber nicht verbalisieren. Gruppe 4 (Kontrollgruppe): musste weder das Lösungsprinzip am Ende angeben noch verbalisieren.
Die Ergebnisse waren verblüffend. Schon bei der Aufgabe mit fünf Scheiben zeigte sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Jungen, die verbalisierten und denen, die ihre Lösungsschritte nicht ausformulieren mußten. Die, die nicht verbalisierten, machten deutlich mehr überflüssige Züge. Bei den beiden Gruppen, die verbalisierten, wurden selbst im höchsten Schwierigkeitsgrad kaum überflüssige Züge gemacht. Die entscheidende Hilfe bei dieser Aufgabe liegt also nicht im bewußten Suchen des Lösungsweges, sondern im lauten Sprechen und Begründen der einzelnen Schritte. In einem Nachtest zeigte sich, daß der Zeitfaktor als Störungsquelle ausgeschlossen werden kann, da die sprachlich aktiven Gruppen auch wesentlich weniger Zeit für die Lösung der Aufgabe benötigten. Man hätte annehmen können, daß die Verbalisierer nur deshalb kaum überflüssige Züge machen, weil sie pro Zug mehr Zeit haben.
Gleiche oder ähnliche Ergebnisse zeigten sich auch im "Progressive Matrices Test" nach Raven und dem "Figure Reasoning Test", da es sich auch hier um sprachfreie Problemstellungen handelt. In verbalen Tests war nur eine geringe Leistungssteigerung dadurch zu erzielen, daß die Probanden ihren Lösungsweg und ihre Handlungsschritte ausformulierten.
In Experimenten von Stern (1967) zeigte sich, daß das Verbalisieren ohne Einfluß bleibt, wenn nachträglich schon vollzogene Lösungsschritte ausformuliert werden. Warum wird jedoch die Leistung bei nicht-verbalen Problemstellungen dadurch verbessert, daß man seine Handlung oder die Lösungsansätze laut ausformuliert? Durch Benennen dessen, was man gerade tut, klassifiziert man das Problem und sein eigenes Verhalten. Es zeigt sich rasch, ob die Lösungsstrategie sinnvoll ist, oder nicht. Die Etikettierung dient dabei dazu, Merkmale besser und bewußter herauszuheben (Figur-Grund-Phänomen). Sie werden gedanklich fixiert und präzisiert. Bei der Lösung dient die Sprache dazu, den roten Faden nicht zu verlieren. Man führt die Strategie konsequenter und bewußter durch, wenn man jeden Lösungsschritt ausdrückt. Merz (1968) meint, daß die Verbalisierung das analytische Denken unterstütze und dabei das konsequente Fortschreiten von einem Teilziel zum nächsten fördere.
3.2 Kodierung und Gedächtnis
Es läßt sich feststellen, daß sprachlich kodierte Sachverhalte besser gemerkt werden und leichter aus dem Gedächtnis abrufbar sind, als Zusammenhänge, die ohne sprachliche Hilfe eingeprägt wurden. Paivio und Csapo (1969) befaßten sich mit dem Zusammenhang zwischen der Speicherung visueller Information und der sprachlicher Einheiten. Sie glaubten, es handle sich hierbei um parallel laufende Verarbeitungsprozesse, die relativ unabhängig voneinander seien. Sie können sich jedoch unter bestimmten Umständen gegenseitig beeinflussen. Sollen Inhalte des visuellen und des sprachlichen Gedächtnisses gleichzeitig abgerufen werden, so ist das Bild-Gedächtnis (imagery) dem Wort-Gedächtnis nicht unterlegen. Anders beim sequentiellen Abrufen, d.h. wenn die Gedächtnisinhalte in einer bestimmten Reihenfolge dekodiert werden sollen. Hier ist das sprachliche Gedächtnis eindeutig überlegen, da die Sprache selbst bereits ein sequentieller Prozeß ist. Worte und Satzteile können nicht beliebig vertauscht werden, sondern haben gemäß der Syntax eine bestimmte, festgelegte Reihenfolge. Untersuchungen zeigten, daß bei rascher Darbietung von Objekten die Gedächtnisleistung für Wörter besser ist als die Gedächtnisleistung für Bilder. Werden die Einheiten langsam oder länger dargeboten, so dominiert das Bildgedächtnis. Bilder werden allgemein besser reproduziert als konkrete Wörter, diese wiederum besser als abstrakte Wörter. Nach Reynolds (1968) werden neue Worte gut kodiert, wenn sie in einen allgemeinen Sinnzusammenhang eingebettet werden können. Besonders vorteilhaft ist, wenn die gesamte visuelle Information (z.B. ein Bild) durch ein Superzeichen (einen Überbegriff) zusammengefaßt werden kann. So werden alle Teilinformationen zu der Gesamtinformation in Zusammenhang gebracht. Diese können als Kontextinformation abgerufen werden. Nach Reynolds liefert die Sprache dabei entweder das Ordnungsprinzip für die Information direkt, oder sie zwingt den Sprecher zu gedanklichen "Ordnungsversuchen". Das Ordnungsprinzip liegt dann in der Sprache direkt, wenn die Worte, die für die Situationsbeschreibung verwendet werden, in eine sinnvolle hierarchische Ordnung zu bringen sind. Die Etikettierung gruppiert dann die Objekte. Es kann auch die Syntax selbst sein, die durch ein System von logischen Verknüpfungsregeln das Gesehene strukturiert. Befunde aus der Gedächtnisforschung belegen, daß sinnvolles sprachliches Material viel besser behalten wird, als sinnloses sprachliches Material, wie z.B. sinnlose Wortsilben.
3.3 Kodierung und syntaktische Struktur der Sprache
Ereignisse, Objekte und Sachverhalte werden durch Sprache ausgedrückt. Sie müssen jedoch in einer Folge von Zeichen dargestellt werden.. Die Sprache dient also als Kode, dessen Regeln von allen Mitgliedern einer Sprachgemeinschaft verstanden werden müssen. Bei diesen Regeln handelt es sich meist um die Verknüpfungsregeln kleinster sprachlicher Einheiten - Silben und Buchstaben.
Abhängig vom Differenzierungsgrad eignen sich Sprachen unterschiedlich gut für die Darstellung unterschiedlichster Sachverhalte. Es existieren Bereiche, in denen Sprache auch in ihrer differenziertesten Form nicht ausreicht, um Sachverhalte oder Beziehungen zwischen Objekten darzustellen. Dies ist z.B. in manchen Bereichen der Mathematik oder den Naturwissenschaften der Fall. Aus diesem Grunde werden für diese Bereiche eigene Formel"sprachen" entwickelt.
Die syntaktischen Strukturen einer Sprache - gemeinhin als Grammatik bekannt - sind demnach auf ein System von Regeln zurückzuführen, nach dem sich beliebige, grammatikalisch richtige Sätze ableiten lassen. Tabelle 2 veranschaulicht die syntaktische Analyse eines einfachen deutschen Satzes (Miller, 1962).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab.2: Syntaktische Analyse eines einfachen Satzes (nach Miller, 1962)
Die in der Tabelle dargestellten Regeln (1-7) erlauben eine schrittweise Umformung eines Axioms. Die Regeln können auch als (generative) Grammatik bezeichnet werden. Die Menge aller Sätze, die mittels der grammatischen Regeln erzeugt werden können, bezeichnet man als Sprache. In dieser Art der Grammatik gibt es Endsymbole, die nicht mehr durch neue ersetzt werden können. Sie stellen den Wortschatz einer Sprache dar. Worte sind somit "Endpunkte der Regeln einer generativen Grammatik." (Miller, 1962)
4. Die Saphir-Whorf-Hypothese der linguistischen Relativität
Die Sprache ist nicht als eine Leistung zu verstehen, die das Denken unterstützt, postuliert Benjamin Lee Whorf in seinem Werk "Denken, Sprache, Wirklichkeit" (1963). Sie schreibt uns vielmehr vor, was wir zu denken haben und auch, was wir tatsächlich denken. Nach Whorf ist ein Denken ohne Sprache gar nicht vorstellbar. Es gibt kein Denken, das sich nicht in den syntaktischen Strukturen unserer Sprache vollzieht. In diesem Abschnitt sollen die Gedanken B.L.Whorfs näher erläutert und seine Vorstellung von der linguistischen Relativität der Erklärung von Raum und Zeit dargestellt werden.
4.1 Hintergrund der Hypothese
Die Hypothese, die sich mit der Abhängigkeit von Sprache und Denken befaßt, wurde maßgeblich von drei Persönlichkeiten geprägt: Franz Boas, Edward Saphir und Benjamin Lee Whorf. Sie ist noch heute umstritten und bietet Ansätze für zahlreiche Untersuchungen. Franz Boas war der Ansicht, daß das Denken die Sprache beeinflußt, da eine Kultur nicht durch ihre Sprache alleine eingrenzbar ist, was der Fall sein müßte, wenn die Sprache unser Denken (und somit unsere kulturelle Aktivität) determinieren würde. Dennoch sind alle Sprachen so umfangreich und komplex, daß sie der Vielfalt menschlichen Denkens gerecht werden können.
Edward Saphir dagegen war der Ansicht, daß die Denkprozesse des Menschen durch die Eigenheiten seiner Sprache strukturiert und gesteuert werden. Er glaubte also an eine direkte Beeinflussung des Denkens durch die Sprache. Die Eigenheiten und Einstellungen, so meint er, sind Resultat spezifischer Sprechweisen. Sprache wird in dieser Theorie zum Spiegel sozialer Wirklichkeit. Dies leitet er aus der Beobachtung ab, daß es keine Sprachen gibt, die einander so ähneln, daß sie annähernd gleiche soziale Realitäten wiederspiegeln können. Benjamin Lee Whorf, dem im Folgenden die Hauptaufmerksamkeit gelten soll, vertrat die radikalste Position. Seiner Meinung nach sind sogar die grundlegendsten menschlichen Begriffe wie Raum, Zeit oder Materie ein Resultat der Sprache. Diese Begriffe sind relativ und haben für Menschen unterschiedlicher Sprachräume ganz unterschiedliche Bedeutung. Whorf macht diese Annahmen mehrfach am Vergleich der Sprache durchschnittlicher Europäer (SAE - Standard Average European) und der von Hopi-Indianern2 deutlich.
4.2 Über den Hintergrundcharakter von Sprachphänomenen
Für den Sprecher haben die Bestandteile der Sprache, die er tagtäglich benutzt, Hintergrundcharakter. Meist liegen sie außerhalb des kritischen Bewußtseins und somit außerhalb der willentlichen Kontrolle. Nach dem "gesunden Menschenverstand" gehen wir davon aus, daß der Gegenstand, den wir (im Konsens mit anderen) sehen und benennen mit dem Begriff übereinstimmt, den wir für ihn gefunden haben.
Wir alle unterliegen einer Täuschung wenn wir annehmen, daß das Sprechen völlig frei und spontan geschieht. Diese Illusion resultiert aus der Tatsache, daß die Grammatik unseren scheinbar so freien Redefluß völlig autokratisch steuert und sich weder Sprecher noch Zuhörer dessen bewußt sind. "Alle Sprechenden unterliegen linguistischen Strukturen ungefähr so, wie alle Körper der Schwerkraft unterliegen." (Whorf, 1963). Wir haben keine Vorstellung von den Prozessen, die während der Begriffsbildung ablaufen. Das erstaunlich komplizierte System linguistischer Strukturen und Klassifikationen bleibt unbewußt. Nur für Grammatiker - auch als Linguisten bezeichnet - sind diese Hintergrundsphänomene von großer Bedeutung. Sie sind bemüht, eine Vorstellung von den Prozessen zu gewinnen, die zu der faszinierenden Struktur und dem reibungslosen Funktionieren von Sprache führen.
4.3 Die Grammatik und ihr Einfluß auf den Gedanken -
Vergleich von Hopi-Sprache (HS) und SAE (Standard Average European) Whorf fand, daß das linguistische System (die Grammatik) jeder Sprache nicht nur ein reproduktives Instrument ist, mit dem Gedanken ausgedrückt werden. Die Sprache ist es vielmehr selbst, die den Gedanken formt und Schema für die geistige Aktivität des Individuums ist. Eindrücke und deren Analyse werden durch die Sprache determiniert und sie bestimmt, welche Mittel uns zur Verfügung stehen, um unsere Umwelt wahrzunehmen und zu strukturieren. Die Formulierung von Gedanken ist kein unabhängiger, rationaler Vorgang, sondern ist maßgeblich durch die Grammatik unserer Muttersprache beeinflußt. Abhängig von verschiedenen Sprachen ist also auch die Formulierung von Gedanken verschieden. Die Objekte, die wir aus unserer Welt herausheben, finden wir nicht einfach in ihr und sie springen uns auch nicht in die Augen. Im Gegenteil: die Welt präsentiert sich uns wie ein Strom voll verschiedener Eindrücke und unserem Geist kommt die Aufgabe zu, die unterschiedlichen Wahrnehmungen sinnvoll zu organisieren. Wenn hier von Geist die Rede ist, so meint Whorf stets das linguistische System in unserem Geist. Wir können nach seiner Ansicht nicht sprechen, ohne uns der Ordnung und Klassifikation einer Grammatik zu unterwerfen.
Um diese Abhängigkeit des Denkens von der Sprache zu untersuchen, widmete sich B. L. Whorf lange dem Vergleich zwischen der Sprache der Hopi-Indianer und der Sprache europäischer Sprachfamilien. Es zeigte sich ein enger Zusammenhang zwischen der Hopi- Sprache und der Hopi-Kultur, sowie zwischen der europäischen Sprache und ihrer Kultur. Dies betraf besonders jene Empfindungsqualitäten, die in unserer Sprache mit Begriffen wie "Zeit", "Materie", "Raum" und "Substanz" verknüpft sind. Der Teil der Untersuchungen, über den hier berichtet werden soll, läßt sich in zwei zentralen Fragen zusammenfassen:
1. Sind unsere Begriffe von Raum, Zeit und Materie wesentlich durch die Erfahrung bestimmt und daher für alle Menschen gleich, oder sind sie zum Teil durch die Struktur besonderer Sprachen bedingt?
2. Gibt es faßbare Affinitäten zwischen den kulturellen Normen und Verhaltensregeln einerseits und den großen linguistischen Strukturen andererseits?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab.3: Vergleichstabelle zwischen Hopi-Sprache und SAE (nach Whorf, 1963)
Der Vergleich zwischen den Denk- und Sprachwelten von Hopi-Indianern und Europäern kann nur unvollständig geleistet werden. Die Gedankenwelt eines Individuums ist jener Mikrokosmos, den er in sich trägt, und durch den er versucht, den Makrokosmos zu verstehen und begreifbar zu machen. Der SAE-Mikrokosmos analysiert die Umwelt vonehmlich in dinglichen Begriffen (Körpern und Quasikörpern) und Substanzen (formlose, aber doch extensionale Qualitäten). Er neigt dazu, auch Nichtdingliches (wie z.B. "Zeit") in räumlichen Formen auszudrücken. Der Mikrokosmos der Hopi dagegen betont die Ereignisse. In der Sprache dominieren Ausdrücke des "sich ereignens". Dabei können die Ereignisse sowohl subjektiven als auch objektiven Charakter haben. In dieser Gedankenwelt gibt es keine lineare Vorstellung vom Leben als Prozeß zwischen Entstehen und Vergehen. Die Metamorphosen aller Dinge stehen im Mittelpunkt, nicht ihre Position auf einer imaginären Zeitachse. Jedes Ganze ist charakterisiert durch ein Wachsen und Abnehmen, durch Stabilität, Zyklizität und seinen schöpferischen Charakter.
In unserem Verhalten finden sich stets Hinweise auf unsere Sprache. So verhalten sich Menschen gegenüber Situationen oft so, wie sie über diese Situationen sprechen. Ein charakteristischer Zug im Verhalten der Hopis ist nach Whorf ihre Betonung der Vorbereitung auf ein Ereignis. Dabei kann das vorbereitende Verhalten unterteilt werden in Ankündigung, äußeres Vorbereiten, inneres Vorbereiten, verdeckte Teilnahme und Beharrung. Es liegt starkes Gewicht auf der Vorstellung, durch Wunsch und Gedanken Macht ausüben zu können. In der Vorstellung der Hopi berührt das Denken alles und durchzieht das Universum. Betont wird auch die Intensität von Gedanken. Ein Gedanke, der wirkungsvoll sein soll, muß bestimmt, lebhaft, bewußt und mit stark gefühlten, positiven Intentionen geladen sein und über lange Zeit festgehalten werden. Es ist weitaus schwieriger, den sprachlichen Zügen der europäischen Kultur in Worten gerecht zu werden. Ein Charakteristikum ist jedoch sicherlich die "Form- plus-Substanz-Dichotomie"3 (Form plus formlose Substanz). Aus der Wechselwirkung zwischen Sprache und Kultur gehen unter anderem hervor:
3. Aufzeichnungen, Tagebücher
4. Buchhaltung, Rechnungsführung und Mathematik
5. Interesse an Reihenfolgen, Datierungen, Kalendern, Chronologien, Uhren, Zeitlöhnen, Zeitmessung und dem physikalischen Zeitbegriff.
6. Geschichtswerke, Annalen, Historik, Archäologie, Einteilung der Zeit in Epochen (z.B. Klassizismus, Romantizismus)
Nach unserer Auffassung erstreckt sich die Zeit also in die Vergangenheit ebenso wie in die Zukunft. Wir geben unseren Entwürfen für die Zukunft die gleiche Form wie unseren Aufzeichnungen über die Vergangenheit. Die formale Gleichheit quasiräumlicher Einheiten, in denen wir Zeit auffassen und messen, läßt uns die Zeit als homogenen Fluß verstehen. Ob eine Zivilisation wie unsere mit einem völlig anderen Zeitverständnis überhaupt existieren könnte, sei dahingestellt. Es ist jedoch festzuhalten, daß die Hopi-Kultur sehr gut ohne allgemeine Anschauung der Zeit als fließendes Kontinuum auskommt. Nach langer und sorgfältiger Analyse kam Whorf zu der Auffassung, daß die Hopi-Sprache keine Wörter, grammatische Wendungen, Kostruktionen oder Ausdrücke enthält, die sich direkt auf das beziehen, was wir "Zeit" nennen. Dennoch ist diese Sprache in der Lage, allen beobachtbaren Phänomenen in einem pragmatischen oder operativen Sinn gerecht zu werden.
4.4 Das linguistische Relativitätsprinzip
Diese oben genannten Tatsachen sind für die Wissenschaft von großer Bedeutung. Sie besagen implizit, daß kein Individuum die Natur mit völliger Unparteilichkeit beschreiben kann. Wir alle sind durch unsere Sprache und Kultur auf eine bestimmte Interpretationsweise beschränkt. Wir gelangen durch Whorf zu einem neuen Relativitätsprinzip, das besagt, "daßnicht alle Beobachter durch die gleichen physikalischen Sachverhalte zu einem gleichen Weltbild geführt werden, es sei denn, ihre linguistischen Hintergründe sindähnlich oder können in irgendeiner Weise auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden." (Whorf, 1963)
Whorf deckt damit die Relativität aller begrifflichen Systeme - unseres mit eingeschlossen - und ihre Abhängigkeit von der Sprache auf.
4.5 Kritik an der Theorie linguistischer Relativität
In einer 1972 erschienenen Studie widerspricht Helmut Gipper der Auffassung Benjamin Lee Whorfs, es gäbe eine sprachliche Relativität. Gipper stellt den grundsätzlichen Unterschied zwischen den Sprachen verschiedener Industriegesellschaften und Naturvölkern in das Zentrum seiner Betrachtung. Bei Naturvölkern sei ein wesentlich engerer Zusammenhang zwischen der Sprache und den Denkinhalten zu erkennen. Eine enge Verknüpfung von Sprache und Denken scheine selbstverständlich. In westlichen Industriestaaten sei dies nicht der Fall. Hier würden kritischen Wissenschaften entwickelt, die wiederum über eine angemessene, wissenschaftlich-abstrakte Sprache verfügten. Diese "Wissenschaftssprachen" können zu einer ganz eigenen, wissenschaftlichen Betrachtung und Interpretation der Umwelt führen. Diese Fachterminologien (auch als Metasprachen bezeichnet) erlauben es, über den Spielraum gewöhnlicher Sprache hinaus zu denken.
Analog zu Whorf beschreibt Gipper, daß die Sprache der Hopi eine sehr viel bessere Einsicht in die Denk- und Wahrnehmungswelt der Menschen erlaubte, als dies beispielsweise in unserer Sprache der Fall ist. Verschiedene Sprachwelten sind also doch in gewisser Weise Ausdruck unterschiedlicher Weltbilder. Interessant wäre es, die verschiedenen Weltbilder konkret zu fassen, was wissenschaftlich bisher noch nicht möglich war. Gipper betont allerdings, daß allen Menschen gewisse genetische Voraussetzungen gemeinsam sind, die sich auch in der Sprache und der Wahrnehmung der Welt niederschlagen. Diese "genetischen Regulative" sind von Natur aus gegeben und bedürfen keiner Interpretation in Hinblick auf unterschiedliche Sprachwelten - sie sind quasi der einheitliche Kern aller unterschiedlicher Sprachen.
Auch in einem weiteren Punkt widerspricht Gipper den Ansichten Whorfs: Die Welt sei, so sagt er, nicht mehr als "kaleidoskopartiger Strom" von Ereignissen zu verstehen. Er sieht in ihr vielmehr ein "Gewebe komplexer Ordnungen und Strukturen, die der menschliche Geist nicht erst erfindet, sondern entdeckt." (Gipper, 1972). Gipper selbst formuliert in seinem Werk ein eigenes sprachliches Relativitätsprinzip:
"Jeder menschliche Gedanke, der sprachlich objektiviert und damit wissenschaftlicher Analyse zugänglich wird, ist "relativ", d.h. steht in nachweisbarer Beziehung zu den Aussagemitteln und Aussagemöglichkeiten derjenigen Sprache, in der er zum Ausdruck gelangt. Dies gilt in dem elementaren und fundamentalen Sinne, daßder Gedanke nicht anders als im Rahmen [...] syntaktischer Strukturen, Gestalt gewinnen kann." (Gipper, 1972)
Es sei jedoch betont, daß diese Aussage noch keine Information darüber enthält, welche Besonderheiten und Charakteristika wissenschaftlichen Urteilen aus verschiedenen Ländern aufgrund ihrer linguistischen Unterschiede eigen sind. Dies dürfte ein interessantes Gebiet für transkulturelle Untersuchungen sein!
5. Die Motortheorie des Denkens
Die These, daß Denken inneres Sprechen sei, findet sich bereits bei Platon, der im Sophistes schreibt: "Dasselbe ist Denken und Sprechen, nur daßdas Gespräch der Seele mit sich selbst, was ohne Stimme vor sich geht, Denken genannt worden ist."
Watson (1968) - der Begründer des Behaviorismus - ist der Ansicht, daß das innere Sprechen von der Umwelt erzwungen wird. Kleine Kinder, so führt er aus, reden zuerst vor sich hin. Sie beschreiben laut alle Ereignisse und beschreiben die Dinge, die sie wahrnehmen. Die Umwelt empfindet diese Lautäußerungen nicht selten als störend, was zur Folge hat, daß das Kind gemaßregelt wird. Das Kind beginnt zu flüstern, um schließlich lautlos zu "sprechen". Aus genau dieser Gleichsetzung von Denken und Sprechen leitet sich die Motortheorie des Denkens ab. In ihrer absoluten Version besagt die Theorie, daß das Denken aus verdeckten Antworten der peripheren Sprechorgane4 besteht. Jacobson gelang es 1932 erstmals, geringe motorische Aktivitäten (u.a. des Kehlkopfes, der Zunge und der Lippen) bei Personen festzustellen, denen Denkaufgaben gestellt wurden. Für diese Hypothese scheint auch der Befund zu sprechen, daß bei Gehörlosen minimale Fingerbewegungen festgestellt werden konnten (Max 1937; Sokolov 1971). Gehörlose Kinder zeigen neben den eben genannten Fingerbewegungen artikulatorische Antwortaktivitäten.
Denken ist also nach der peripheralistischen Hypothese Sprechen ohne Lautbildung. Im Gegensatz hierzu postuliert die zentralistische Hypothese der Gestaltpsychologie reine Denkakte. Lashley (1951) und Hebb (1959) sind der Ansicht, daß das Denken alleine in der Aktivität des zentralnervösen Systems besteht. Auch für diese These gibt es Befunde. So fand Leuba 1968, daß die Problemlösefähigkeit bei Probanden nicht eingeschränkt war, wenn ihre Sprechmuskulatur durch Curare gelähmt wurde. Dies scheint dafür zu sprechen, daß das Denken nicht notwendigerweise mit innerem Sprechen verbunden ist. Sokolov (1971) und Vinacke (1974) weisen darauf hin, daß der "kinästhetische Kode" bei der Lösung schwieriger Probleme hilfreich sein kann. Die Rückmeldung der peripheren Sprechorgane scheint also nicht wirklich bedeutungslos zu sein.
6. Die Kognitionshypothese
Jean Piaget (1970), der sich hauptsächlich mit der kindlichen Entwicklung beschäftigte, war der Ansicht, daß die Sprache kein notwendiges Element des Denkens sei. Seine Postulate werden häufig auch unter dem Begriff der Kognitionshypothese zusammengefaßt. Grob gefaßt ist seine entwicklungstheoretische Sichtweise in drei Aussagen zusammenfaßbar:
7. Die kognitive Fähigkeit ist Wurzel der sprachlichen Fähigkeit
8. Die Sprache ist keine notwendige Bedingung für die Transformation kognitiver Operationen. Vielmehr ist es so, daß die intellektuellen Transformationen die Voraussetzung für die Sprachentwicklung darstellen.
9. Die Sprache ist keine notwendige Bedingung für die Bildung formal-logischer Operationen. Sie hat lediglich instrumentelle Funktion.
Diese Aussagen stehen im Gegensatz zu den Annahmen anderer Entwicklungspsychologen, wie z.B. Chomsky (1969) und Mc Neills (1970). Sie gehen davon aus, daß das Kind mit angeborenen linguistischen Fertigkeiten ausgestattet ist, die es ihm erlauben, Sprache(n) zu erwerben. Auch Wygotsky (1964) postuliert, daß die Sprache wie auch das Denken eigene, genetische Wurzeln haben. Gegen weitere Annahmen Piaget wird vorgebracht, daß die kognitiven Fertigkeiten von Kindern erst mit zunehmender Sprachfertigkeit ausdifferenziert werden. Es scheint also so, als würden die kognitiven Strukturen erst durch das allgemeine Sprachwissen strukturiert. Daß die Sprache allgemein einen strukturierenden Charakter hat, hebt auch Dörner (1976) hervor. Er schreibt: " Jemand, der gelernt hat, Situationen nach bestimmten Regeln zu beschreiben, wird auch dazu neigen, Situationen gem äß diesen Regeln wahrzunehmen." Auch er betont also die Bedeutung, die der Sprache für unsere Wahrnehmung der Welt zukommt.
7. Integration von Sprache und Denken als Entwicklungsprozeß
Aus den unterschiedlichen Positionen verschiedener entwicklungspsychologischer Theoretiker ergibt sich die Frage nach der Bedeutung sprachlicher Förderung von Kindern. Ein entwicklungspsychologischer Standpunkt ist, daß die sprachliche Förderung die primäre Aufgabe von schulischer Ausbildung sei. Eine andere Position sieht die sprachfreie Intelligenz und deren Förderung als das wichtigste Fundament für eine gesunde geistige Entwicklung an (Piaget 1966; Dienes & Jeeves 1968; Hunt 1961). Beide Seiten können Befunde für ihre Thesen anführen.
Wie aber hat man sich eine Synthese von Denken und Sprechen - wie sie vielfach angenommen wird - vorzustellen? Ist sie von Geburt an vorhanden, oder wird sie erst im Laufe der kindlichen Entwicklung erworben?
Nach heutigem Wissen verlaufen Denk- und Sprachentwicklung zunächst unabhängig voneinander. Die Sprache entwickelt sich rascher als die Intelligenz, was daran erkennbar ist, daß die wesentlichen Züge der Grammatik einer Erwachsenensprache schon von Kindern mit vier bis fünf Jahren beherrscht werden. Das Kind benutzt bereits in diesem Alter die sprachlichen Regeln sinnvoll und ist in der Lage vollständige Satzkonstruktionen zu bilden.
Dieser rasche Erwerb der Sprache veranlaßt immer mehr Theoretiker zu der Annahme, daß es endogene Programme (z.B. in Form einer generativen Grammatik wie von Piaget postuliert) geben muß, die als Grundlage für alle sprachlichen Fertigkeiten (Grammatik etc.) dienen. Erst mit sechs bis sieben Jahren treten die Leistungen der operativen Intelligenz auf. Mehrere kognitive Operationen können gleichzeitig ausgeführt werden - es kommt zu einer Dezentrierung und Denkprozesse werden reversibel. Dies ist der Zeitpunkt, zu dem die Sprache erstmals wichtiger Bestandteil des Denkens wird. Sie wird in ihrer Funktion als Symbolstruktur begriffen und erleichtert den Denkvorgang. Die Sprache hilft dem Kind immer mehr bei der Organisation seiner Wahrnehmungen. Möglicherweise ist dies auch der Grund dafür, daß sich im Vorschulalter die Intelligenzleistungen von Kindern aus unterschiedlichen sozio-ökonomischen Schichten deutlich untescheiden: Mittel- und Oberschichtkinder gewinnen einen (Intelligenz-)Vorsprung gegenüber Kindern aus einfacheren Verhältnissen. Zuvor spielt die soziale Herkunft noch keine Rolle. Wie Bayley (1965) nachweisen konnte, unterscheiden sich Kinder im Alter von zwei Jahren bezüglich ihrer Intelligenz noch nicht voneinander - unabhängig davon, aus welcher Schicht sie stammen.
Nach Oevermann (1969) lassen sich die Unterschiede in den Intelligenzleistungen von Kindern verschiedener sozial-ökonomischer Schichten dadurch erklären, daß die Wurzeln der Sprachentwicklung im sozialen Kommunikationsprozess liegen. Die Intelligenz hat somit ihren Ursprung in der Auseinandersetzung mit der Umwelt. Welche Möglichkeiten einem Kind zur Verfügung stehen, in diesen sozialen Kommunikationsprozeß zu treten, hängt sicherlich nicht zuletzt auch von den sozialen und ökonomischen Bedingungen ab, in denen es aufwächst.
7.1 Sprachbarrieren
Wie wir gesehen haben, ist eine Beeinträchtigung des Denkens durch einen Mangel bei der Sprachentwicklung durchaus möglich. Wie Bernstein (1964) ausführt, ist der sprachliche Kode der Unterschicht in weitaus geringerem Maße für die Bildung abstrakter Begriffe geeignet und versagt in Situationen, die eine analytische Sprache erfordern. Weitere Untersuchungen über den Einfluß des linguistischen Kodes auf das Denken sind jedoch rar. Trotzdem wachsen Kinder in unterschiedlichsten Sprachmilieus auf. Viele Kinder lernen nur wenige Wörter, wobei die Bedeutungen der Wörter oftmals nur vage umrissen sind. So entwickelt sich die Sprache nur unzureichend, weil es an nötiger Umweltstimulation und Sprachförderung fehlt. Die Ursachen für eine schlechte Sprachentwicklung können dabei in einem fehlenden bzw. undifferenzierten Sprachmodell (Eltern) oder in einem Mangel an Kontakt liegen. Da diese Faktoren besonders bei Kindern aus sozial-ökonomisch schwachen Familien auftreten, ist bei ihnen eine Beeinträchtigung des Denkens durch mangelde Sprachfähigkeiten eher zu erwarten. Neben diesen negativen Einflüssen durch die soziale Umwelt gibt es noch den Einfluß der Sprachfamilie auf das Denken des Einzelnen (Whorf- Hypothese). So haben Landkinder beispielsweise einen anderen Wortschatz als Stadtkinder und auch das Denken beider Gruppen beschäftigt sich bis zu einem gewissen Grad mit verschiedenen Inhalten. Arbeiter und Handwerker benutzen mehr konkrete Begriffe als der höhere Mittelstand. Die Sprache dient also für verschiedene soziale Gruppen ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Sie reflektiert unterschiedliche Umwelten. Das alleine sagt nicht aus, daß eine Sprache, die von der eines Wissenschaftlers abweicht, ärmer ist. Man denke nur an den sprachlichen Reichtum einiger Dialekte, der in der deutschen Hochsprache nicht zu finden ist.
7.2 Didaktische Konsequenzen
Als Konsequenz aus den vorangegangen Ausführungen lag bisher ein Schwerpunkt auf der schulischen Förderung der Sprachentwicklung. Trotz vielfacher didaktischer Ansätze und einem hohen zeitlichen Aufwand zeigt diese Förderung jedoch nicht den gewünschten Erfolg. Dies liegt sicherlich auch daran, daß Kinder an ihrer Sprache, die sie im Vorschulalter erworben haben, festhalten. Die Sprache entspricht einem gewissen Rollenverständnis und spiegelt nicht zuletzt die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozio-ökonomischen Schicht. Somit dürfte bereits wieder die Solidarität - wenn auch nur sprachlich - als Barriere gegenüber Förderungsmaßnahmen wirken. Vielleicht ist auch im Schulalter die Veränderung der Sprachfertigkeiten nicht mehr gut möglich, weil die sensible Phase für den Spracherwerb bereits abgeschlossen ist. Vielleicht wäre ist sinnvoller, in der Schule eine "Fachsprache" zu vermitteln, die es den Schülern erlaubt, wissenschaftliche Sachverhalte zu verstehen, die über den Wortschatz ihrer Umgangssprache hinausgehen. Man könnte sich also ein sprachliches Bezugssystem vorstellen, das der Schüler beim Denken und beim Lösen von Problemen benutzt, aber beiseite lassen kann, wenn es in seiner außerschulischen Umgebung unangebracht ist. In der Schule muß ein Kind also in erster Linie eine adäquate Etikettierung erlernen, die eine Synthese von Sprache und Intelligenz erlaubt. Bei der schulischen Förderung sollte also einerseits die Bildung eines angemessenen Wortschatzes und einer adäquaten Syntax im Vordergrund stehen. Bei der Etikettierung geht es darum, vermittelnde Prozesse durch Begriffe und Benennungen griffig und schnell verfügbar zu machen. Der Schüler muß lernen, daß das Wort nicht die Sache selbst ist, sondern eine Marke oder ein Symbol für einen Sachverhalt, der unabhängig von dem Wort existiert. Mit Kodierung ist dagegen mehr als nur eine bloße Etikettierung von Sachverhalten gemeint. Hier geht es um die präzise Darstellung von Strukturen, Relationen und Zusammenhängen. So könnte eine nachträgliche Synthese von Sprache und Denken im schulischen Umfeld geleistet werden, wenn die Sprache in der vorschulischen Entwicklung zu undifferenziert ausgebildet wurde. Ein anderes Problem bei der Förderung von Denkprozessen in der Schule ist das Verbalisieren. Selbst Erwachsene profitieren bei schwierigen Problemen von der lauten Formulierung ihrer Vorgehensweise. Da im Unterricht lautes Denken nur selten möglich ist, müßten Unterrichtsformen entwickelt werden, die das Verbalisieren fördern. Hier könnten Formen der Partnerarbeit möglich sein, bei denen jeweils einer der beiden Schüler seine Problemlösungsschritte ausformulieren kann. Der Partner könnte dabei korrigierend und fragend eingreifen. Auch dies könnte ein kleiner Schritt auf dem Wege zu einer didaktisch sinnvollen schulischen Förderung von Sprache und Denken sein.
8. Zusammenfassung
Nach einer ansatzweisen Klärung der Begriffe "Denken" und "Sprache" und entwicklungspsychologischen Vorstellungen zur Bedeutung der Sprache für die Lösung von Problemen, zu Kodierung und syntaktischer Struktur der Sprache wird das Saphir-Whorf Konzept der linguistischen Relativität vorgestellt. Die Sprache wird dabei nicht als Leistung, die das Denken unterstützt, verstanden, sondern im Gegensatz dazu die Sprache beinahe apodiktisch als Instrument gesehen, welches das Denken strukturiert. Benjamin Lee Whorf vedeutlicht seine Hypothese über einen Vergleich der Sprache der Hopi-Indianer mit einer postulierten Europäischen Standardsprache. Sprache kann aber nicht nur als Strukturgeber für Denkinhalte (linguistische Relativität) verstanden werden, sondern auch als Werkzeug des Denkens (sprachinstrumentalistische Vorstellung). Einwände gegen die Hypothese von Lee Whorf kommen vor allem aus der Entwicklungspsychologie. Untersuchungen zur kindlichen Entwicklung zeigen, daß beide Leistungen - Denken und Sprache - unabhängig voneinander entstehen. Erst im Verlauf der Entwicklung kommt es zu einer Integration von Sprache und Denken dann, wenn die Ereignisse, Objekte, Situationen und Prozesse symbolisch repräsentiert werden können. Die Annahmen von Benjamin L.Whorf werden auch durch Untersuchungen von Helmut Gipper relativiert, der zeigen konnte, daß Entwicklung von Sprachfertigkeiten und Denkprozessen nicht nur von der Umwelt, sondern auch von genetischen Faktoren bestimmt werden. Weitere Einwände gegen die Hypothese von Benjamin L. Whorf ergeben sich aus behavioristischen Schriften zur Motortheorie des Denkens und aus Untersuchungen zur Kognition. Unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt relativieren die verschiedenen Konzepte gängige Anschauungen über die Bedeutung der schulischen Sprachförderung. Da die Sprache nur dann eine Hilfe für das Denken bedeutet, wenn sie einen bestimmten Grad der Differnzierung erreicht hat, sollte eine moderne Pädagogik besonderes Augenmerk auf die Förderung der Sprachfertigkeiten - Wortschatz und Syntax - legen.
9. Literatur
1. Whorf, BL (1956): Sprache - Denken - Wirklichkeit. Beiträge zur Metalinguistik und Sprachphilosophie; rowohlts enzyklopedie; Hamburg.
2. Garnham A, Oakhill J (1994): Thinking and reasoning. Blackwell; Oxford, UK&Cambridge, USA.
3. Grimm H, Engelkamp J (1981): Sprachpsychologie. Handbuch und Lexikon der Psycholinguistik, Schmidt-Verlag, Berlin.
4. Oerter R (1977): Psychologie des Denkens. Auer-Verlag, Donauwoerth
5. Wygotsky, LS (1986): Thought and Language. MIT-Press, Cambridge.
6. Labov W (1970): The logic of nonstandard English. In Williams F. (ed.), Language and Poverty, Markham, Chicago.
7. Gipper H. (1972): 7 Gibt es ein sprachliches Relativitätsprinzip? Untersuchungen zur Sapir-Whorf-Hypothese. In: Uexküll Th und Grubrich-Simitis I (Hrsg.): Conditio humana. Ergebnisse aus den Wissenschaften vom Menschen, Fischer, Frankfurt am Main.
[...]
1 Turm von Hanoi: Hierbei muß ein Turm, bestehend aus übereinanderliegenden, immer kleiner werdenden Scheiben auf einem neuen Feld aufgebaut werden, wobei verschiedene Regeln zu beachten sind.
2 Hopi: nordamerikanischer Stamm der Puebloindianer im Staat Arizona (USA). Ihre Sprache gehört zur schoschonischen Sprachgruppe.
3 Dichotomie: jede Einteilung, die ihre Gegenstände vollständig in zwei Klassen sich gegenseitig ausschließende Klassen einteilt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser Seite?
Diese Seite präsentiert eine umfassende Analyse des Verhältnisses zwischen Sprache und Denken, basierend auf verschiedenen Hypothesen und Vorstellungen. Sie behandelt Themen wie gewohnheitsmäßiges Denken, die Steuerungsfunktion der Sprache bei der Problemlösung, die Sapir-Whorf-Hypothese, die Motortheorie des Denkens, die Kognitionshypothese und die Integration von Sprache und Denken als Entwicklungsprozess.
Was ist das "gewohnheitsmäßige Denken" im Kontext dieser Seite?
Gewohnheitsmäßiges Denken bezieht sich auf Denk- und Verhaltensweisen, die stark von unserem Sprachgebrauch beeinflusst werden. Es wird die Vorstellung diskutiert, dass unsere Wahrnehmung und Interpretation der Realität maßgeblich durch die Systematik und Logik unserer Sprache geprägt sind.
Was besagt die Sapir-Whorf-Hypothese (linguistische Relativität)?
Die Sapir-Whorf-Hypothese, auch bekannt als das linguistische Relativitätsprinzip, postuliert, dass die Struktur einer Sprache die Denkweise und Weltsicht ihrer Sprecher beeinflusst. Dies bedeutet, dass verschiedene Sprachen zu unterschiedlichen Wahrnehmungen und Interpretationen der Realität führen können. Benjamin Lee Whorf vergleicht hierzu die Sprache europäischer Sprachfamilien mit der von Hopi-Indianern.
Was ist die "Motortheorie des Denkens"?
Die Motortheorie des Denkens besagt, dass Denken im Wesentlichen inneres Sprechen ist. In ihrer radikalen Form argumentiert sie, dass das Denken aus verdeckten Reaktionen der peripheren Sprechorgane besteht.
Was ist die "Kognitionshypothese" (nach Piaget)?
Die Kognitionshypothese, vertreten durch Jean Piaget, besagt, dass die kognitive Entwicklung die Grundlage für die Sprachentwicklung bildet. Demnach ist Sprache nicht unbedingt notwendig für das Denken, sondern vielmehr ein Produkt kognitiver Prozesse.
Wie integrieren sich Sprache und Denken im Laufe der Entwicklung?
Die Seite argumentiert, dass Sprache und Denken zunächst unabhängig voneinander entstehen. Im Laufe der kindlichen Entwicklung kommt es dann zu einer Integration, wobei die Sprache zunehmend das Denken unterstützt und die Organisation der Wahrnehmung erleichtert. Jedoch wird nicht der Einfluß der Umwelt und genetischer Faktoren, die eine Sprachfertigkeit mitbestimmen, außer Acht gelassen.
Was sind die didaktischen Konsequenzen, die aus dieser Analyse gezogen werden können?
Die Analyse legt nahe, dass eine effektive Sprachförderung in der Schule einen Schwerpunkt auf die Entwicklung eines differenzierten Wortschatzes und einer adäquaten Syntax legen sollte. Die Bildung eines sprachlichen Bezugssystems wird als hilfreich betrachtet, um wissenschaftliche Sachverhalte zu verstehen, die über den Wortschatz der Umgangssprache hinausgehen. Außerdem sollte ein angemessener Umgang mit der Verbalisierung von Denkschritten im Unterricht gelernt werden.
Welche Kritik gibt es an der Sapir-Whorf-Hypothese?
Helmut Gipper widerspricht der Auffassung Benjamin Lee Whorfs, es gäbe eine sprachliche Relativität. Er stellt den grundsätzlichen Unterschied zwischen den Sprachen verschiedener Industriegesellschaften und Naturvölkern in das Zentrum seiner Betrachtung. Weiterhin gäbe es genetische Voraussetzungen die sich in Sprache und Weltwahrnehmung widerspiegeln. Die Erkenntnisse von Whorf werden durch Studien zur Motortheorie des Denkens und zur Kognition relativiert.
- Quote paper
- Judith Anna Bahmer (Author), 2000, Sprache und Denken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97497