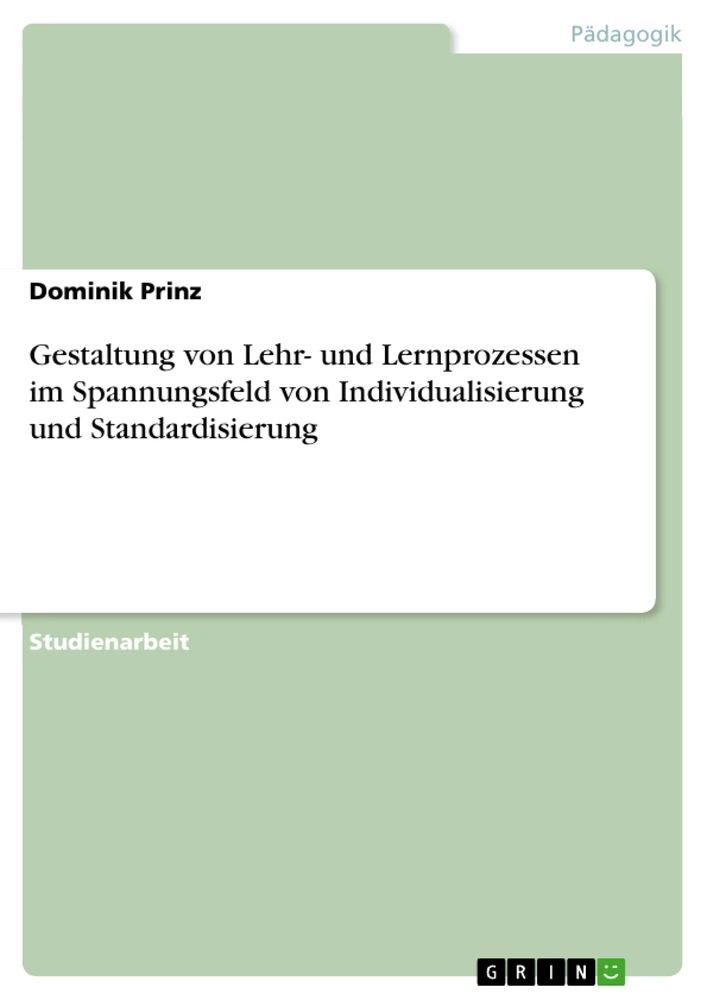In dieser Hausarbeit soll das Spannungsfeld zwischen Individualisierung und Standardisierung in der Schule genauer betrachtet werden. Dazu wurde eine Befragung bezüglich der Wahrnehmung des Unterrichts aus verschiedenen Perspektiven bestimmter Akteure an einem ausgewählten Schulstandort im Dezember 2018 durchgeführt. Bei den Akteuren handelt es sich um Lehrpersonen sowie um SchülerInnen des 7. Wiener Gemeindebezirk.
Der Geographie- und Wirtschaftskundeunterricht zeichnet sich durch große Spielräume aus, wie Lehr- und Lernprozesse gestalten werden können. Die Inhalte von GW sind gesellschafts-relevant und verlangen die Einbindung jedes/jeder einzelnen Schülers/Schülerin. Darüber hinaus sollen die persönlichen Interessen, Fähigkeiten und Stärken jedes/jeder einzelnen Lernenden berücksichtigt werden, um den Lernprozess optimal zu gestalten und das Potential des/der Lernenden so gut wie möglich auszuschöpfen. Daher sollen didaktische Entscheidungen auf Basis eines schüler/innenzentrierten und individuumsbezogenen Lernverständnisses getroffen werden. Um dies zu ermöglichen ist es notwendig die Grundsätze der Individualisierung zu berücksichtigen.
Seit vielen Jahren ist der Begriff ‚Individualisierung‘ im pädagogisch-didaktischen Bereich inkludiert. Individualisiertes Lernen stellt kein ‚Rezept‘ für die Realisierung eines guten Unterrichts dar, sondern ist vielmehr als Unterrichtsideal mit klaren Zielvorstellungen zu verstehen. Wie individualisierter Unterricht gelingen kann hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Das insbesondere im Zuge der Einführung der Zentralmatura aufkommende Bestreben Bildung zu standardisieren stellt sich dabei konträr zur Individualisierung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ziele und Forschungsfragen
- 3. Methodik
- 3.1. Aufbau der Arbeit
- 3.2. Befragung und Einbindung des Analyseinstruments
- 4. Ausgangslage und Problemstellung
- 4.1. Theoretische Grundlagen
- 4.2. Forschungsstand
- 4.3. Konkrete Praxissituation
- 5. Analyse
- 5.1. Diskussion der Ergebnisse
- 5.1.1. Didaktische Entscheidungen
- 5.1.2. Schul- und Lernkultur
- 5.1.3. Organisationsstruktur
- 5.2. Individualisierung - Herausforderungen, Hindernisse und Probleme
- 5.3. Kritik der ExpertInnen
- 5.1. Diskussion der Ergebnisse
- 6. Synthese
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Forschungsarbeit untersucht, ob individualisiertes Lernen im Sinne einer inneren Differenzierung im Geographie- und Wirtschaftskundeunterricht praktiziert wird. Dazu wurden drei Klassen einer AHS und deren GW-Lehrpersonen befragt. Ziel ist es, die Wahrnehmung des Unterrichts hinsichtlich gelungener innerer Differenzierung aus der Perspektive der LehrerInnen und SchülerInnen zu analysieren und das Spannungsfeld zwischen Standardisierung und Individualisierung im schulischen Kontext zu diskutieren.
- Individualisiertes Lernen im Sinne einer inneren Differenzierung
- Wahrnehmung des Unterrichts aus SchülerInnen- und LehrerInnenperspektive
- Spannungsfeld zwischen Standardisierung und Individualisierung im schulischen Kontext
- Faktoren, die individualisiertes Lernen und innere Differenzierung im GW-Unterricht behindern
- Potentielle Maßnahmen zur Optimierung von Lehr- und Lernprozessen durch Individualisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema „Individualisierung und Standardisierung im Unterricht“ ein, definiert zentrale Begriffe und stellt das Spannungsfeld zwischen beiden Ansätzen im schulischen Kontext dar. Kapitel 2 definiert die Ziele und Forschungsfragen der Arbeit, wobei der Fokus auf der Analyse von individualisiertem Lernen im GW-Unterricht und der Wahrnehmung des Unterrichts aus verschiedenen Perspektiven liegt.
Kapitel 3 beschreibt die Methodik der Forschungsarbeit. Es werden die verwendeten Daten-Erhebungsmethoden und das Analyseinstrument vorgestellt. Kapitel 4 behandelt die Ausgangslage und Problemstellung, indem es auf theoretische Grundlagen, den Forschungsstand und eine konkrete Praxissituation eingeht.
In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der Befragungen analysiert und diskutiert. Es wird untersucht, ob sich Diskrepanzen zwischen der Wahrnehmung des Unterrichts durch LehrerInnen und SchülerInnen ergeben und welche Herausforderungen, Hindernisse und Probleme mit individualisiertem Unterricht und innerer Differenzierung verbunden sind.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit umfassen Individualisierung, Standardisierung, innere Differenzierung, Geographie- und Wirtschaftskundeunterricht, SchülerInnen- und LehrerInnenperspektive, Wahrnehmung des Unterrichts, schulischer Kontext, Forschungsfragen, Hypothesen, Analyse, Befragungen, Daten-Erhebungsmethoden, theoretische Grundlagen, Forschungsstand, Praxissituation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Individualisierung und Standardisierung in der Schule?
Individualisierung zielt darauf ab, die persönlichen Stärken jedes Schülers zu fördern, während Standardisierung (z.B. durch die Zentralmatura) eine Vereinheitlichung der Bildungsleistungen anstrebt.
Was bedeutet "innere Differenzierung" im Unterricht?
Innere Differenzierung bezeichnet didaktische Maßnahmen innerhalb einer Lerngruppe, um den unterschiedlichen Voraussetzungen und Interessen der Schüler gerecht zu werden.
Warum eignet sich das Fach Geographie und Wirtschaftskunde (GW) besonders für Individualisierung?
GW bietet große Spielräume in der Gestaltung, da die Inhalte gesellschaftsrelevant sind und die Einbindung persönlicher Interessen der Schüler erfordern.
Welche Hindernisse gibt es für individualisierten Unterricht?
Zu den Hindernissen zählen starre Organisationsstrukturen, Zeitdruck durch Standards und die Herausforderung, jedem Schüler einzeln gerecht zu werden.
Wie wurde die empirische Untersuchung für diese Arbeit durchgeführt?
Es wurden Befragungen von Lehrpersonen und Schülern an einem Schulstandort im 7. Wiener Gemeindebezirk durchgeführt, um die Wahrnehmung des Unterrichts zu analysieren.
- Quote paper
- Dominik Prinz (Author), 2018, Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen im Spannungsfeld von Individualisierung und Standardisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/975789