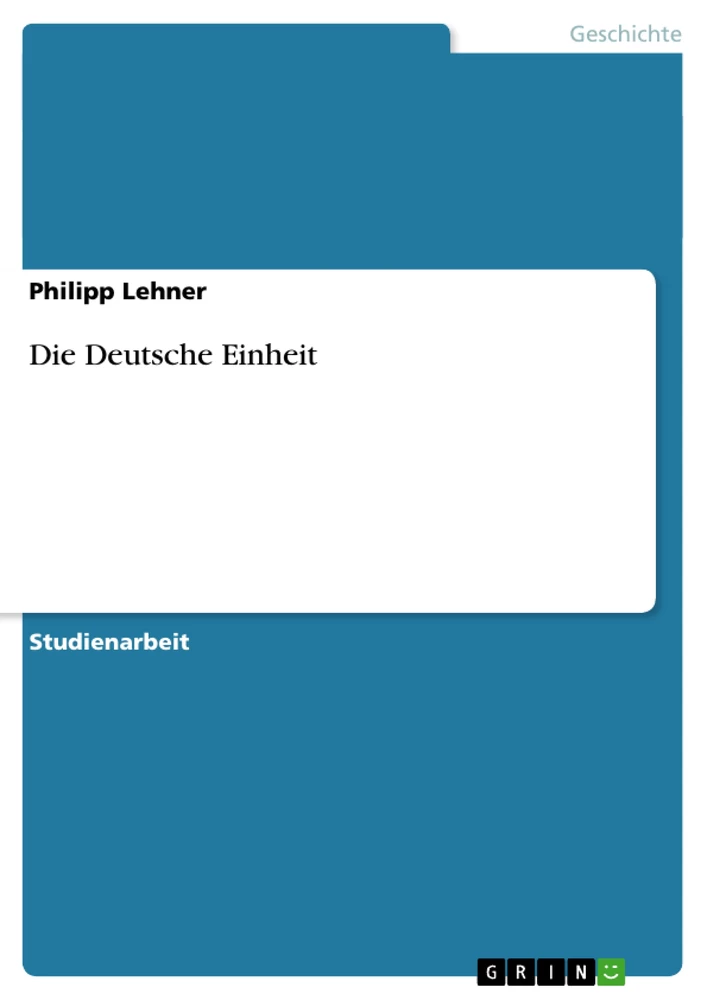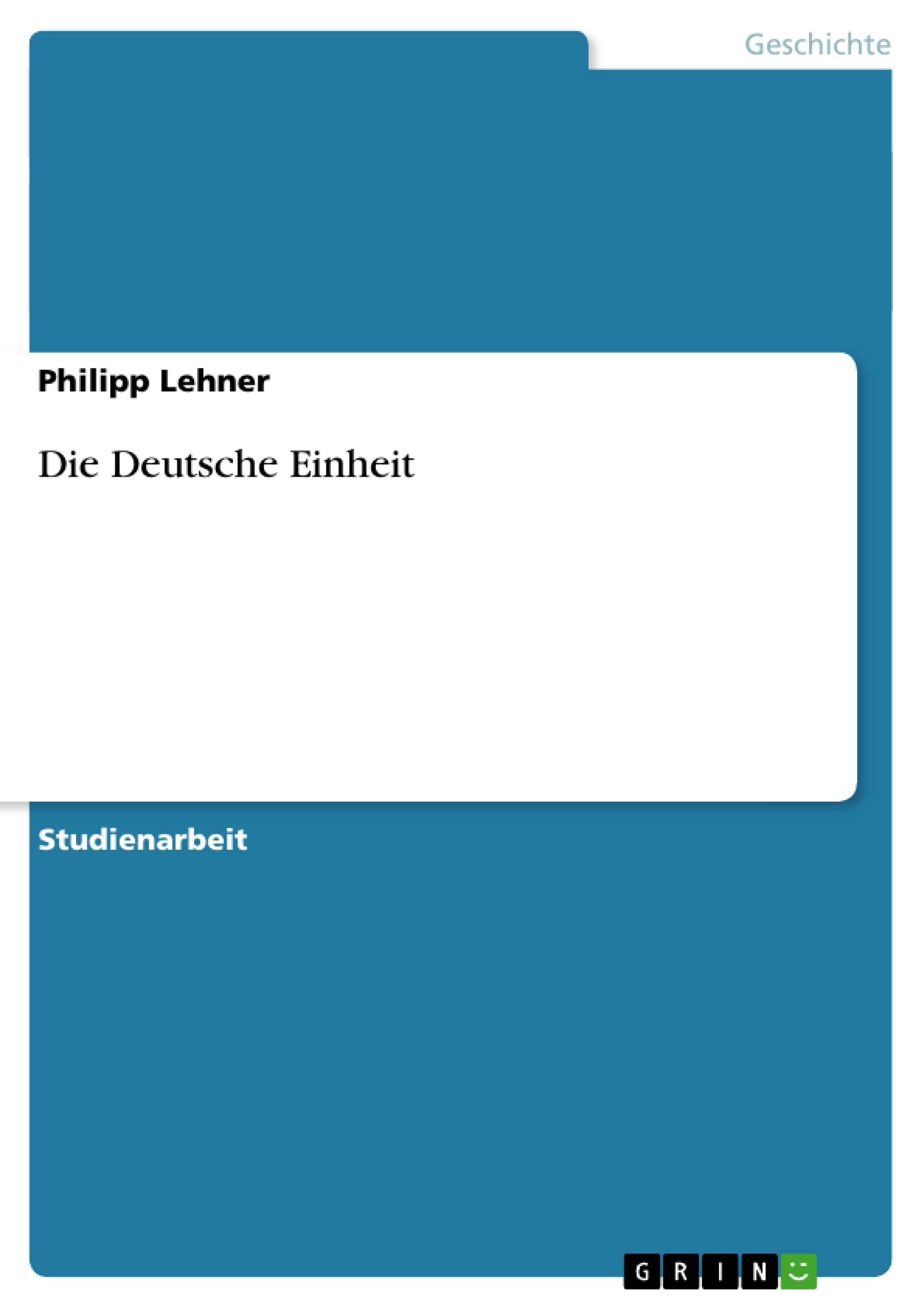DER WEG ZUR DEUTSCHEN EINHEIT
Umbruchstimmung im Osten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1985 wurde Michail Gorbatschow zum neuen Generalsekretär der KPdSU gewählt. Nun begann sich langsam der Eiserne Vorhang ein wenig zu öffnen. Perestroika und Glasnost waren die Schlagwörter seiner Reformen. Viel schneller als in der Sowjetunion griff der Reformkurs bei den anderen Ostblockstaaten, den sogenannten Satellitenstaaten der UdSSR. Kaum wurden die Zügel von Moskau gelockert, war der Umbruch meist kaum mehr aufzuhalten. Gorbatschow, der am 25. Mai 1989 zum Präsident der UdSSR gewählt wurde, unternahm — dem internationalen und inneren Druck ausgesetzt — wenig Anstrengungen diesen Wandel aufzuhalten: am 7. Juli 89 legte er offiziell die Zukunft der sozialistischen Ostblockstaaten in deren eigene Hände. Diese Geste war jedoch weniger ein Geschenk von Moskau, sondern eher eine Kenntnisnahme eines Prozesses der unaufhaltsam schien. Der Stein rollte: in Polen werden der Sozialismus abgeschafft und freie, demokratische Wahlen ausgeschrieben1, im Juli 89 erklären die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen ihre Unabhängigkeit, das ungarische Volk drängt auf Reformen, in Peking kommt es auf dem Platz des Himmlischen Friedens zu einem Studentenaufstand, der blutig niedergeschlagen wird2, in Rumänien kommt es zur Revolution, die mit der Hinrichtung des Diktators Ceaucescu ihren Höhepunkt erreicht.
Diese Umbruchstimmung erreicht natürlich auch die DDR.
Die friedliche Revolution in der DDR
Schon Mitte der achtziger Jahre bildeten sich in der DDR Menschenrechts-, und Friedensgruppen, zunächst unter dem Dach der Kirche. Die Kirche in der DDR trug einen wichtigen Teil zur Einheit bei, da sie den einzigen Freiraum bot, der nicht direkt von der Stasi kontrollierbar war. Hierzu möchte ich den Theologen Richard Schröder zitieren:
“ Das alles (die kirchenlichen Einrichtungen) waren Inseln in der Monotonie der ideolo gisierten Gesellschaft, Orte, in denen das freie Wort und die freie Bewegung ihre seltene Chance hatten, und nicht nur f ü r Christen. ”
Somit war allerdings die Kirche gleichzeitig ein beliebtes Ziel der Stasi. Erste Demonstrationen solcher Organisationen wurden von der Stasi im Keim erstickt.
Im Mai 1989 stellten Bürgerinitiativen bei den Kommunalwahlen in der DDR Wahlfälschung heraus. Darauf folgend kam es zu Demonstrationen im ganzen Land. Zynischerweise erstatteten man Anzeige gegen Unbekannt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Nachdem schon im Februar eine Familie mit ihrem Wagen die Sperre der VOPO3 zur Ständigen Vertretung der BRD durchbrach, um somit ihre Ausreise zu erzwingen, flüchteten zahlreiche DDR- Bürger im Laufe der Monate in die Ständige Vertretung in Ostberlin oder in die deutschen Botschaften in Prag, Warschau und Budapest, die dann teilweise wegen Überfüllung geschlossen werden mußten. Als schließlich in der Nacht zum 11. September die Ungarische Regierung ihre Grenzen zum Westen öffnete, flüchteten Tausende von Menschen über Ungarn in die Bundesrepu- blik. Für manche kam dieses Ereignis nicht unerwartet, denn schon im August hatte man dies bei einem Treffen des ungarischen Ministerpräsidenten und Außenministers und dem deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl beschlossen. Die scharfe Kritik der DDR-Regierung gegenüber Ungarn stieß auf taube Ohren. Nach und nach wurde den SED-Funktionären bewußt, daß die DDR ohne Signale der Verhandlungsbereitschaft ausbluten werde. Ende September wurden die Ausreisen der ‘Botschaftsbesetzer’ in Sonderzügen genehmigt. Die Zugfahrt führte durch die DDR, wo Ausreisewillige versuchten, auf die Züge aufzuspringen. Es kam zu erneuten Demonstrationen. Jeden Montagabend gingen in Leipzig Tausende von Menschen auf die Straßen (Montagsdemonstrationen), und jede Woche wurden es mehr. Den 40-sten Jahrestag der DDR am 7. Oktober 89 wollte Erich Honecker4 mit einer großen Feier und Militärparaden angehen. Diese Preisung der DDR viel jedoch ins Wasser, als es in Berlin und vielen anderen Städten zu großen Demonstrationen kam. Bei einer Großdemonstration in Leipzig am Montag dem 9. Oktobers gingen 70 000 Menschen auf die Straßen. Zwar griff die Stasi ein und eine gewaltsame Beendigung des Aufstandes war vorbereitet (z.B. Namenslisten für Internierungslager), jedoch hielten sich die gewalttätigen Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften in kleinem Rahmen. Das Desaster auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking ließ die SED vor Gewaltanwendung zurückschrecken. Außerdem genoß die DDR keinerlei sowjetische Unterstützung, weder militärisch noch politisch. Dazu ein Zitat von Breschnew zu Honecker:
“ Erich, ich sage dir offen, vergesse es nie: die DDR kann ohne uns, ohne die Sowjet union, ihre Macht und St ä rke, nicht existieren. ”
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In der Regierung kam Unsicherheit auf, und es kam zu Ungereimtheiten innerhalb der SED. Trotz mahnender Worte Michail Gorbatschows — aus seiner Rede in Ostberlin am 7.10. stammen die berühmten Worte: “Wer zuspät kommt, den bestraft das Leben” — wehrte sich Honecker gegen Reformen. Am 18. Oktober wird er vom SED-Politbüro abgesetzt. Als Nachfolger entscheidet man sich für Egon Krenz. Dieser konnte die Macht der SED jedoch nicht mehr retten. Die Demonstrationen rissen nicht ab. Über eine Million Menschen forderten auf dem Alexander-Platz in Ostberlin anfang November Reformen und die Abschaffung des SED-Machtmonopols. Inzwischen bildeten sich in einigen Städten Reformgruppen, Parteien5 und sogar Gewerkschaften6. Einige schlossen sich zum sogenannten ‘Neuen Forum’ zusammen. In manchen Teilen der DDR löste sich der Staatsapparat langsam auf und wurde durch ‘Runde Tische’ ersetzt. Am 7. November trat schließlich die gesamte DDR-Regierung zurück. Schon am nächsten Tag wurde von der SED eine neue Regierung zusammengestellt, jetzt mit neuen Gesichtern. Am Abend des 9. November 1989 wurden die Reisebeschränkungen zwischen DDR und BRD vollständig aufgehoben. Nach dieser etwas unklar formu- lierten Mitteilung brach in Berlin ein Chaos aus. Millionen von Menschen strömten nach Westen. Die friedliche Revolution trug ihre Früchte: 28 Jahre nach dem Bau7 war die Mauer gefallen.
Die politischen Schritte zur staatlichen Einheit
Das Volk der DDR hatte den Sturz der SED-Diktatur erkämpft, nun lag es an den Politikern weitere Schritte zur Wiedervereinigung zu tun.
Zehn-Punkte-Programm von H. Kohl
Am 28. November verkündete Bundeskanzler Helmut Kohl sein Zehn-Punkte-Programm zur Überwindung der Teilung Deutschlands. In diesem Programm fordert er:
- erleichterter Reiseverkehr zwischen Ost und West
- Ausbau der Infrastruktur zwischen DDR und BRD (z.B. Telefonnetz, Eisenbahnstrecke Hannover-Berlin)
- wissenschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle und ökologische Zusammenarbeit
- enge Zusammenarbeit beider Regierungen (z.B. gemeinsame Institutionen)
- politische Reformen (freie, gleiche und geheime Wahlen, rechtsstaatliche Grundsätze, Freilassung politischer Gefangener)
- Abschaffung der Planwirtschaft und Durchsetzung der soziale Marktwirtschaft (Öffnung für Investitionen aus dem Westen)
- Integrierung der DDR in die EG und somit Zugang für die DDR zum westeuropäischen Markt
- Bereitstellung von Devisenfonds8 der BRD für die DDR
- Vorantreiben des KSZE-Prozesses9 (Sicherheit und Stabilität in Europa)
- Abrüstung und Rüstungskontrolle innerhalb Europas, der NATO und des Warschauer Pakts
- Staatliche Einheit Deutschlands weiterhin politisches Ziel
Am 6. Dezember, ganze sieben Wochen nach seinem Amtsantritt, legte Egon Krenz sein Amt als Staatsratvorsitzender nieder, und es kam zur Errichtung eines ‘Runden Tisches’ auf Staatsebene.
Volkskammerwahlen
Kohls Forderungen folgend wurden demokratische Wahlen zur Volkskammer ausgeschrieben, die dann am 18. März 1990 stattfand. Inzwischen hatten sich viele neue Parteien gegründet. Die CDU und die neuen Parteien ‘Deutsche Soziale Union’ und ‘Demokratischer Aufruf’ schlossen sich zu einer ‘Allianz für Deutschland’ zusammen. Sie errang überraschenderweise die Mehrheit, die Wähler sprachen sich somit für eine schnelle Wiedervereinigung Deutschlands aus.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion
Am 1. Juli trat die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion in Kraft, die am 18. Mai in einem Staatsvertrag beschlossen wurde. Durch die Wirtschaftsunion wurde ein einheitlicher deutscher Markt geschaffen, in dem Ware und Kapital unbehindert verkehren konnten. Schnell begannen westdeutsche Unternehmer in der DDR zu investieren.
Vorraussetzung für eine funktionierende Wirtschaftsunion, und damit mit dieser unabdingbar verbunden, war die Währungsunion. Nur durch ein einheitliches Zahlungsmittel war ein reibungsloser Fluß von Kapital möglich. Das Umtauschverhältnis von Ost-Mark auf DM war von Art und Umfang des Vermögens abhängig (siehe Schaubild). Auf dem Weltmarkt war eine D-Mark ungefähr 4,5 Ost-Mark wert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Um die harten Folgen des Wirtschafts- umschwungs abzumildern, wollte man durch die Sozialunion eine schrittweise Angleichung der Sozialsysteme (Arbeitsrecht, Rentenversicherung, Krankenkassen usw.) bewerkstelligen. Die Sozialunion war mit enormen Kosten verbunden, für die hauptsächlich der Bund aufkam.
Die deutsche Einheit und die Vier Siegermächte
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Mindestens so wichtig wie die innenpolitischen Maßnahmen zur Wiedervereinigung war die Klärung der deutschen Frage auf internationaler Ebene. Die Zustimmungen der Siegermächte war nicht zu umgehen. Während die USA bedenkenlos eine Wiedervereinigung Deutschlands befürwortete, befürchteten Frankreich und Großbritannien eine eventuelle Übermacht Deutschlands in Europa. Auf die historischen Erfahrungen berufend sprach die interna- tionale Presse sogar von einem vierten deutschen Reich. Ohne Zweifel hatte die UdSSR bei einer Wiedervereinigung am meisten zu verlieren. Für eine Wiedervereinigung hatte Deutschland eine Reihe von Forderungen zu erfüllen. Diese Forderungen waren — vor allem zwischen den Westmächten und der damaligen UdSSR — sehr unterschiedlich oder standen sich sogar entgegen. So forderte Gorbatschow zum Beispiel die Neutralität Gesamtdeutschlands, sprich: keine Mitgliedschaft in der NATO. Die Westmächte wollten jedoch auf den Bündnispartner Deutschland nicht verzichten. Erst nach vielen Bemühungen und Verhandlungen gelang Helmut Kohl und dem damaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher der Durchbruch. Am 16. Juli 1990 machte Gorbatschow den Weg zur Wiedervereinigung frei, stimmte einer NATO-Mitgliedschaft Gesamtdeutschlands und seiner Entlassung in die uneingeschränkte Souveränität zu. Für diesen historischen Schritt mußte der Westen zum Ausgleich der Sowjetunion einige Zugeständnisse machen. So übernahm zum Beispiel Deutschland teilweise die Kosten für den Abzug der sowjetischen, in Ostdeutschland stationierten Truppen. Am 9. November unterzeichnete Deutschland und die UdSSR einen “Vertrag über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit”.
Der Zwei-plus-vier-Vertrag
Es gab aber noch ganz andere Probleme, die auf eine Lösung warteten: bis 1990 gab es keinen Friedensvertrag zwischen Deutschland und den Vier Siegermächten, der die ‘deutsche Frage’ nach '45 löste; die Oder-Neiße-Grenze war vertraglich noch nicht anerkannt; Deutschland unterlag offiziell noch den Rechten der Alliierten. Um diese Punkte ging es bei den sogenannten “Zwei-plus-vier- Verhandlungen”. In den Verhandlungen einigte man sich darauf...
- die Oder-Neiße-Linie als Westgrenze Polens anzuerkennen,
- die deutschen Streitkräfte auf 370 000 Mann zu beschränken,
- keine Atomwaffen oder NATO-Truppen auf dem Gebiet der DDR zu stationieren (zum Schutz der Ostblockstaaten)
- und Gesamtdeutschland, nach Ratifizierung des Vertrags aller Staaten, die volle Souveränität zurückzugeben.
Am 12. September 1990 wurden diese Vereinbarungen im “Zwei-plus-vier-Vertrag”10 unterzeichnet. Nun war auch international grünes Licht für die deutsche Wiedervereinigung gegeben.
Die deutsche Einheit
Am 23. August 1990 beschloß die Volkskammer den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik. Die Gründungsväter des deutschen Grundgesetzes hatten eigentlich den Artikel 146 für die Wiedervere- inigung vorgesehen. Dieser sieht eine neue Verfassung für Gesamtdeutschland vor. Um das bewährte Grundgesetz beibehalten zu können, beschloß die Volkskammer am 23. August 1990 den Beitritt der DDR zur BRD nach Artikel 23, demnach die DDR in Form neuer Bundesländer in die Bundesrepublik aufgenommen wurde. Eine Woche später, am 31. August, wurde der deutsch- deutsche Einigungsvertrag von beiden Seiten unterzeichnet und am 12. September von beiden Parlamenten11 verabschiedet. Am 3. Oktober schließlich wurde Deutschland nach über 40 Jahren der Trennung wieder geeinigt.
DIE FOLGEN
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Finanzierung der deutschen Einheit
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Bundesregierung stand nach der Wiedervereinigung vor einem unüberschaubar großen Berg von Problemen unterschiedlicher Art und ihre Ausgangssituation war denkbar ungünstig: die neuen Bundesländer und deren Kommunen waren hoch verschuldet, die Wirtschaft war keineswegs mit dem Westen konkurrenzfähig, die unterentwickelte Infrastruktur mußte ausgeweitet und modernisiert werden, der ineffiziente, marode Verwaltungsapparat verschlang viel Geld und Arbeitskraft, die überlassenen ökologischen Probleme drängen zu kostenaufwendigen Sanierungen. Wie sollte man die deutsche Einheit finanzieren? Noch heute kreidet man Bundeskanzler Helmut Kohl an, kein konkretes Finanzierungskonzept ausgearbeitet zu haben. Mittels drei Wege versucht man nun den neuen Ländern finanziell auf die Beine zu helfen:
Steuererhöhungen:
Während im Osten Steuervorteile zur Förderung von Investitionen eingeräumt werden, werden im Westen die Steuerschrauben angezogen. Von Juni 91 bis Juni 92 wurde im Rahmen des Solidarpaktes ein 7,5%-iger Zuschlag auf Lohn-, Einkommen-, und Körperschaftssteuer erhoben. Die Tabak- und Mineralölsteuer wurden mehrmals angehoben, wobei die Benzinpreise wahrscheinlich in Zukunft — vor allem auch aus ökologischen Gründen — weiter steigen werden. 1992 wurde die Mehrwertsteuer von 14 auf 15% erhöht und 1993 trat das Zinsabschlagsgesetz in Kraft. Die Steuereinnahmen des Bundes von 1993 werden auf 367,5 Mrd. DM geschätzt. Bis 1996 sollen sie auf einen Betrag von 421,4 Mrd. ansteigen.
Einsparungen im Haushalt:
In den Jahren 92 bis 94 will der Bund etwa 67 Mrd. DM einsparen. Von den Kürzungen des Haushaltsplanes sind vor allem die Bundeswehr, der gesamte Forschungsbereich und die Finanzspritzen für die alten Bundesländer betroffen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Kredite:
Für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbau der Ex-DDR wurde vom Bund und den westlichen Bundesländern der Fonds ‘Deutsche Einheit’ gebildet. Er beläuft sich momentan auf ca. 147 Mrd. DM pro Jahr; davon werden 95 Mrd. über Kredite aufgebracht. Ursprünglich sollte die Treuhandanstalt nach der Privatisierung der volkseigenen Betriebe und dem daraus resultierenden Gewinn die Staatsschulden tilgen. Dies war jedoch eine grobe Fehleinschätzung der westlichen Politiker und Wirtschaftsexperten. Die Wirtschaftskraft Ostdeutschlands wurde über-, und der Umfang der finanziellen Belastungen erheblich unterschätzt. Heute trägt die Treuhandanstalt selbst eine 275 Mrd. DM-schwere Schuldenlast. Die Neuverschuldung des Staates betrug im letzten Jahr einschließlich der beiden Bahngesellschaften und der Treuhandanstalt 220 Mrd. DM. Der deutsche Schuldenberg wuchs somit auf 1,7 Billionen und wird Ende 94 wahrscheinlich die 2 Billionenmarke erreichen.
Wirtschaftslage
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Vor allem aber hofft die Bundesregierung auf private Investitionen im Osten, die durch Steuervorteile und Subventionen gefördert werden. Trotz der rezessiven Wirtschaftslage und den privatwirtschaftlichen Hemmnissen, wie z.B. die teils ungeklärten Besitzverhältnisse, erlebt der Osten Deutschlands einen enormen Aufschwung — hauptsächlich in der Bauwirtschaft —, während der Westen die Talsohle der westlichen Wirtschaftsflaute noch nicht überwunden hat.
Daß auch die alten Bundesländer von der schwachen Konjunktur nicht unberührt bleiben, zeigt die Zahl der Arbeitslosen, die im Osten durch die Wirtschaftsreformen ohnehin groß ist. Die Arbeitslosenquote in der ehemaligen DDR beträgt über 17% und entspricht 1,3 Mio. Arbeitslosen. Im Westen liegt die Quote mit 2,74 Mio. Erwerbslosen bei 9% — Tendenz steigend. Mit insgesamt 4,04 Mio. hat die Arbeitslosigkeit seit Ende des Zweiten Weltkrieges ihren Höchststand erreicht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gesellschaftliche Aspekte
Bei einer sehr wirtschaftsorientierten Politik, die sich momentan vor allem in Ostdeutschland konzentriert, gerät meist die Verantwortung und Rücksicht auf die Umwelt, die in SED-Zeiten schwer belastet wurde, in den Hintergrund. Wie mit ökologischen Problemen tut man sich ebenfalls mit der Vergangenheit schwer. Die Offenlegung der Stasi-Akten gab und gibt viel gesellschaftlichen und politischen Zündstoff. Den Behörden und der Justiz wurde eine problematische, zwiespältige und ebenso umstrittene Aufgabe aufgetragen. Zum Beispiel Mauerschütze: Aus rein menschlichem Verstand heraus sollten die Todesschützen an der Berliner Mauer verurteilt und bestraft werden. Doch eigentlich handelten die Grenzsoldaten nach Befehl und nicht gegen das Gesetz der DDR. Man kann niemanden verurteilen aufgrund einer Tat, die für ihn kein Unrecht war. Und nach welchen Maßstäben soll geurteilt werden — nach westlichen oder östlichen. Kann ein Grenzsoldat überhaupt für die Schüsse an der Mauer verantwortlich gemacht werden. Haben nicht die mit der größten Macht auch die größte Verantwortung?
Die Probleme mit der Vergangenheit gehen jedoch noch viel weiter zurück. Die Informationen der DDR-Archive reichen bis in die NS-Zeit. Die entsprechenden Akten werden weitergeleitet zur Ludwigsburger ‘Zentralstelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen’, wo sie ausgewertet werden. So jagt und entlarvt man also nicht nur Ostspione und Stasimitglieder, sondern auch ehemalige NS-Ver- brecher, die oft schon Tod oder das hohe Alter von 80 Jahren überschritten haben. So mancher ließe die Vergangenheit lieber in den blechernen Schubladen der DDR-Archive und nicht ohne Grund urteilt der Schriftsteller Peter Bender folgendermaßen:
“ (die Aufarbeitung der Akten) vergiftet die zwischenmenschlichen Beziehungen — sowohl bei Opfern als auch bei T ä tern ” .
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
ZUM REFERAT
Quellen
- “Informationen zur politischen Bildung” Nr. 233: “Die Teilung Deutschlands 1955 bis zur Einheit”; Bundeszentrale für politische Bildung, 1991
- SPIEGEL-Dokumente: Okt. 90/Nr.3, Nov. 90/Nr.4, Sept. 93/Nr.5
- “Handbuch zur deutschen Einheit”, Hrsg.: Werner Weidenfeld / Karl-Rudolf Korte, Bundeszentrale für politische Bildung, 1993
- “Die Wende in der DDR”, Bundeszentrale für politische Bildung, 1992
- “Unsere Erbschaft, Was war die DDR — was bleibt von ihr?” von Peter Bender, Luchterhand Essay; 1992
- Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
- Gemeinschaftskunde-Referate
- Öffentliche Presse
- “MIT - Mittelstandsmagazin”
Philipp Lehner - J 13/2
14. April 1994
[...]
1 4. Juli 1989
2 4. Juni 1989
3 Volkspolizei
4 seit 1971 SED-Generalsekretär und damit praktisch mächtigster Mann im Staat
5 z.B. die ‘Sozialdemokratische Partei in der DDR’ SDP am 7.10.
6 z.B. die Gewerkschaft ‘Reform’ am 23.10.
7 13. August 1961
8 Fonds = Finanzmittel, die für einen bestimmten Zweck eingesetzt werden.
9 KSZE = Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
10 oder: “Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland”
Häufig gestellte Fragen zu "DER WEG ZUR DEUTSCHEN EINHEIT"
Was war der Auslöser für die Umbruchstimmung im Osten?
Die Wahl Michail Gorbatschows zum Generalsekretär der KPdSU im Jahr 1985 und seine Reformen unter den Stichworten Perestroika und Glasnost führten zu einer Lockerung des Eisernen Vorhangs. Dies wirkte sich besonders stark auf die Ostblockstaaten aus.
Welche Rolle spielte die Kirche in der DDR während der friedlichen Revolution?
Die Kirche bot den einzigen Freiraum, der nicht direkt von der Stasi kontrolliert wurde und ermöglichte somit die Bildung von Menschenrechts- und Friedensgruppen.
Was geschah am 9. November 1989?
Am Abend des 9. November 1989 wurden die Reisebeschränkungen zwischen der DDR und der BRD vollständig aufgehoben, was zum Fall der Berliner Mauer führte.
Was beinhaltete das Zehn-Punkte-Programm von Helmut Kohl?
Das Zehn-Punkte-Programm umfasste unter anderem die Erleichterung des Reiseverkehrs, den Ausbau der Infrastruktur, wirtschaftliche Zusammenarbeit, politische Reformen, die Abschaffung der Planwirtschaft und die staatliche Einheit Deutschlands als politisches Ziel.
Was war die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion?
Sie trat am 1. Juli in Kraft und schuf einen einheitlichen deutschen Markt mit freiem Waren- und Kapitalverkehr. Sie umfasste die Einführung der D-Mark in der DDR und die Angleichung der Sozialsysteme.
Welche Rolle spielten die Vier Siegermächte bei der Wiedervereinigung?
Die Zustimmung der Siegermächte war entscheidend. Deutschland musste eine Reihe von Forderungen erfüllen, insbesondere im Hinblick auf seine militärische Stärke und seine Bündniszugehörigkeit. Der Zwei-plus-vier-Vertrag regelte die abschließenden Fragen bezüglich Deutschlands.
Wann fand die deutsche Einheit statt?
Am 3. Oktober wurde Deutschland nach über 40 Jahren der Teilung wieder geeinigt, indem die DDR der Bundesrepublik Deutschland beitrat.
Wie wurde die deutsche Einheit finanziert?
Die Finanzierung erfolgte durch Steuererhöhungen, Einsparungen im Haushalt und Kredite. Der Fonds 'Deutsche Einheit' wurde gebildet, um den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbau der Ex-DDR zu unterstützen.
Welche wirtschaftlichen Folgen hatte die Wiedervereinigung?
Die Wiedervereinigung führte zu einem wirtschaftlichen Aufschwung im Osten Deutschlands, insbesondere in der Bauwirtschaft, während der Westen mit einer Wirtschaftskrise zu kämpfen hatte. Es kam zu hoher Arbeitslosigkeit, insbesondere in den neuen Bundesländern.
Welche gesellschaftlichen Aspekte sind im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung zu beachten?
Die Umweltbelastung in der ehemaligen DDR, die Aufarbeitung der Stasi-Akten und die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, einschließlich der NS-Zeit, spielten eine wichtige Rolle.
- Arbeit zitieren
- Philipp Lehner (Autor:in), 1994, Die Deutsche Einheit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97587