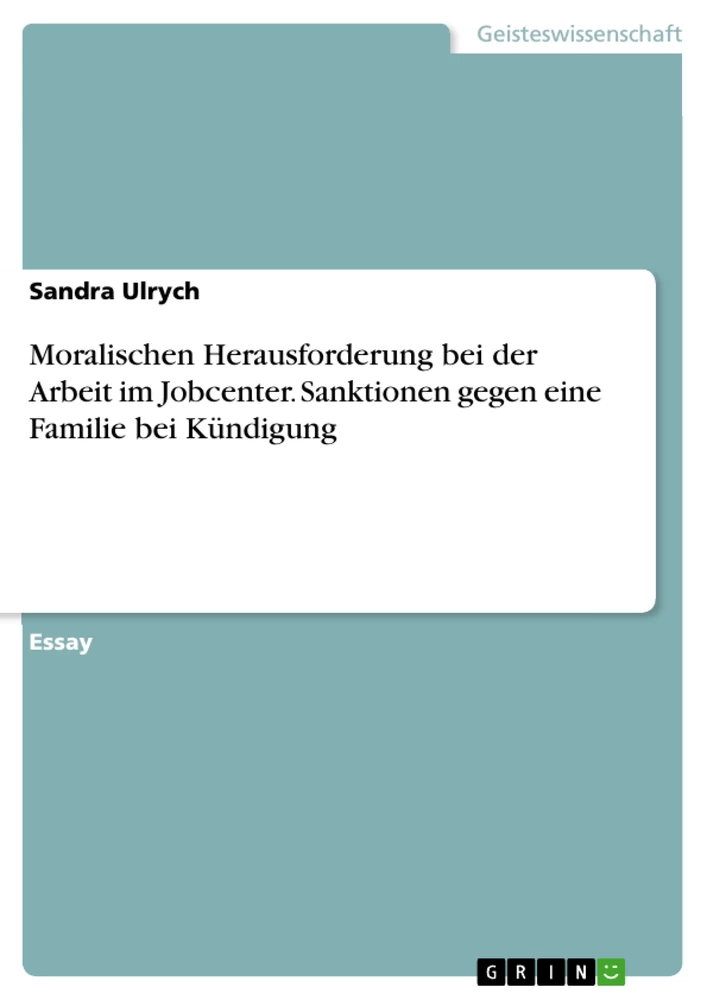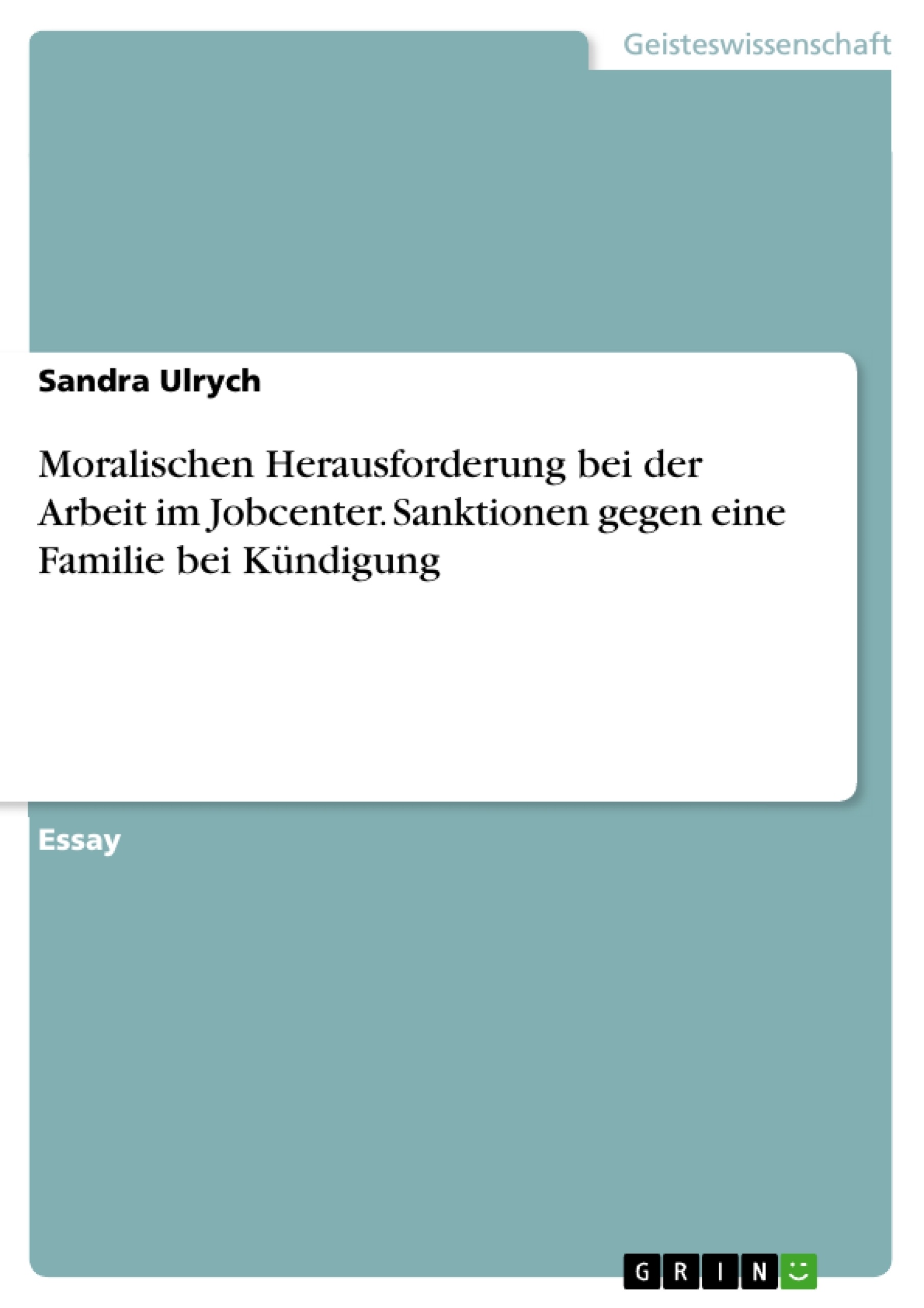Die Arbeit analysiert eine moralische Herausforderung bei der Arbeit im Jobcenter. Der Autor beschreibt den Fall von Sanktionen gegen eine Familie bei Kündigung.
Hartz IV dient laut SGB II § 1 der Grundsicherung für Arbeitssuchende und soll die Eigenverantwortung der Leistungsberechtigten stärken, damit sie wieder unabhängig von der Grundsicherung leben können. Ziel ist es folglich, das Leben aus eigenen Kräften und Mittel zu bestreiten. Dem Grundsatz des Förderns und Forderns folgend muss der Leistungsempfänger jede zumutbare Arbeitsgelegenheit übernehmen.
Im § 10 wird Zumutbarkeit und Unzumutbarkeit genauer definiert: „Einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person ist jede Arbeit zumutbar“, es sei denn, jemand ist nicht zu der Arbeit in der Lage, die Arbeit erschwert die Rückkehr in die alte Tätigkeit aufgrund körperlicher Beanspruchung, die Erziehung unter dreijähriger würde gefährdet oder die Pflege eines Angehörigen könnte dadurch nicht stattfinden. Unzumutbar ist eine Arbeit aber nicht, weil sie nicht der bisherigen Tätigkeit, entspricht, die Tätigkeit weiter vom bisherigen Wohnort entfernt ist oder die Arbeitsbedingungen ungünstiger sind als bei vorangegangen Beschäftigungen. Das Einkommen aus Tätigkeiten die Leistungsempfänger ausüben, wird mit dem Hartz IV Betrag verrechnet. Wenn ein Leistungsempfänger beschließt, dass eine zumutbare Tätigkeit nicht fortgeführt wird, begeht er eine Pflichtverletzung und wird sanktioniert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Das moralische Dilemma
- Der Utilitarismus
- Die Deontologie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ethische Herausforderung, die sich im Kontext von Sanktionen gegen eine Familie im Jobcenter ergibt. Der Fokus liegt auf der Analyse eines konkreten Falls, in dem eine alleinerziehende Mutter aufgrund einer Kündigung eine Sanktion erhält, obwohl sie sich in einer prekären Situation befindet.
- Die ethische Problematik von Sanktionen im Jobcenter
- Die Perspektive des Utilitarismus: Nutzenmaximierung vs. individuelle Notlage
- Die Perspektive der Deontologie: Pflichten und moralische Prinzipien vs. pragmatische Erwägungen
- Die Auswirkungen von Sanktionen auf Familien und Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung erläutert den rechtlichen Rahmen des Hartz IV-Systems und die Vorgaben für die Arbeitsvermittlung. Sie stellt das konkrete Fallbeispiel einer alleinerziehenden Mutter vor, die aufgrund einer Kündigung eine Sanktion erhält, obwohl ihre Gründe für die Kündigung nachvollziehbar sind.
Hauptteil
Das moralische Dilemma
Dieser Abschnitt beschreibt das moralische Dilemma, das sich aus der Kündigung der alleinerziehenden Mutter ergibt. Es werden die Argumente für und gegen eine Sanktionierung in diesem konkreten Fall aufgezeigt.
Der Utilitarismus
Der Utilitarismus wird auf das Dilemma angewendet. Die Argumentation fokussiert auf die Folgen der Handlung für die Mehrheit der Betroffenen, wie die Kundin, die Kinder, das Jobcenter, die Sachbearbeiterin und den Steuerzahler. Es wird untersucht, ob die Sanktionierung den größten Nutzen für die größtmögliche Anzahl von Menschen bringt.
Die Deontologie
Die Deontologie analysiert die Handlung selbst und untersucht, ob sie an sich moralisch gerechtfertigt ist, unabhängig von ihren Konsequenzen. Der Fokus liegt auf den Motiven der Handlung und der Frage, ob sie universalisierbar sind.
Schlüsselwörter
Hartz IV, Sanktionen, Jobcenter, Arbeitsvermittlung, moralische Herausforderung, Utilitarismus, Deontologie, Pflichtenethik, Familien, Kinder, sozialer Friede, Gerechtigkeit, Arbeitsmarkt, Arbeitnehmerrechte, Kündigung, Belästigung am Arbeitsplatz
- Quote paper
- Sandra Ulrych (Author), 2020, Moralischen Herausforderung bei der Arbeit im Jobcenter. Sanktionen gegen eine Familie bei Kündigung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/976060