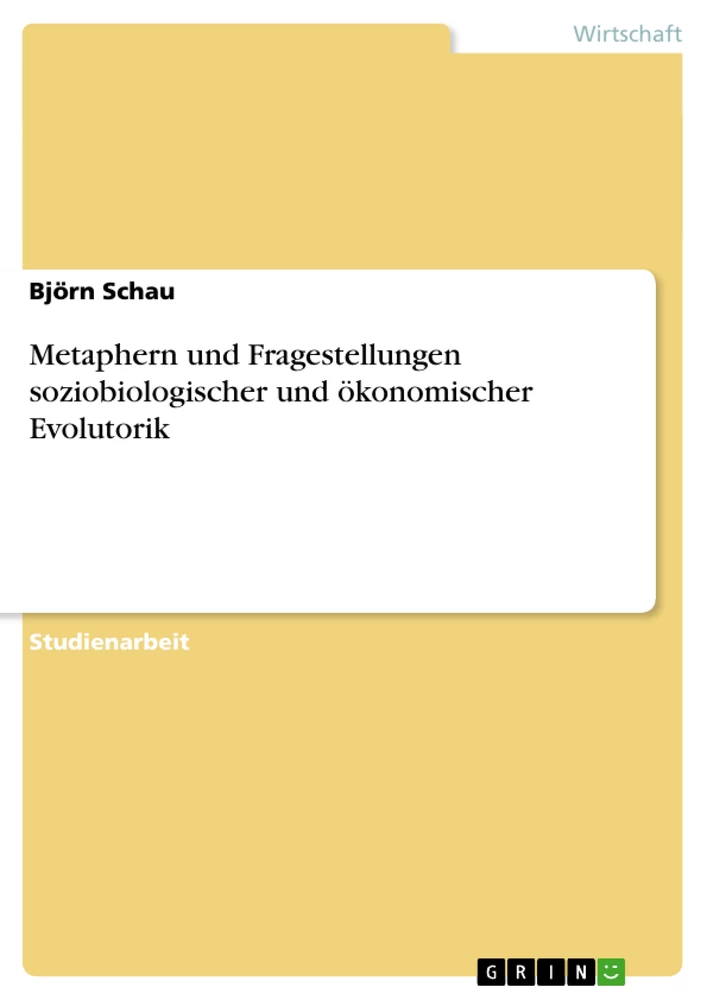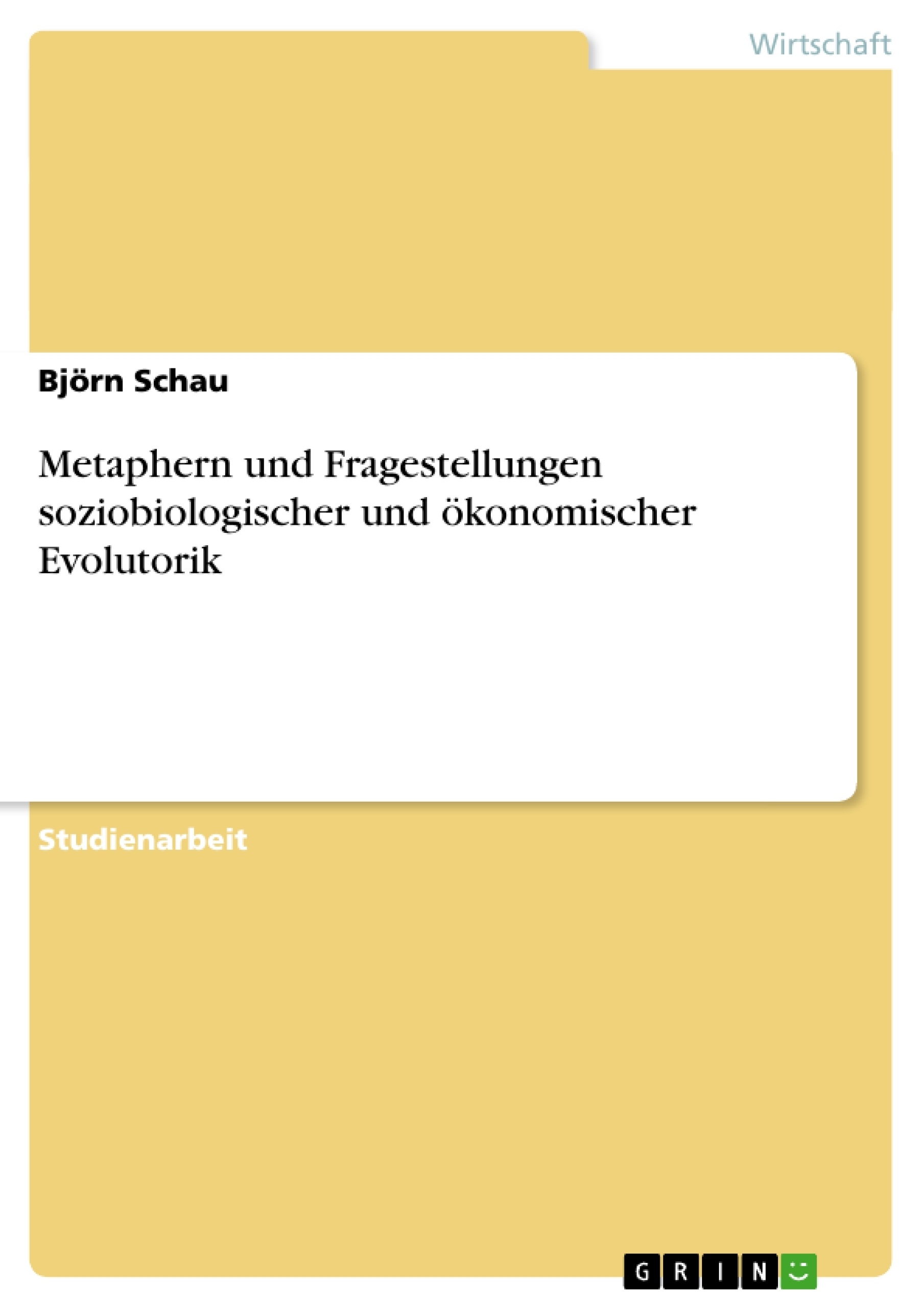Inhalt
1. EINLEITUNG
2. DIE EVOLUTIONSTHEORIE CHARLES DARWINS
3. FRAGESTELLUNGEN UND ANNAHMEN
3.1 Eine gemeinsame Fragestellung?
3.1 Gemeinsame Rahmenbedingungen menschlichen Handelns
4. DIE EVOLUTION VON ALTRUISMUS UND KOOPERATION
4.1 Egoismus und Altruismus
4.2 Das Entstehen von Kooperation
5. SCHLUßBEMERKUNGEN LITERATURVERZEICHNIS
1. Einleitung
Thema dieser Arbeit soll es sein aufzuzeigen, was soziobiologische und ökonomische Theorien einer Evolution erklären wollen und welcher Begrifflichkeiten sie sich hierzu bedienen. Auf den ersten Blick scheint das Thema klar umrissen zu sein. Im Laufe der Auseinandersetzung mit evolutorischen Theorien wurde jedoch offensichtlich, daß der Bereich der Evolution so vielfältig ist, und sich auf eine Vielzahl von Gebieten anwenden läßt, daß eine genaue Abgrenzung schwerfällt. Verdeutlichen läßt sich dies schon an der in Langenscheidts Fremdwörterlexikon gefundenen Beschreibung von Evolution: ,,Evolution ist die (biologische) Weiter-, Höherentwicklung der Lebewesen von niederen zu höheren Formen im Laufe der Entwicklungsgeschichte durch Auslese und allmähliche Veränderung der Organismen, [bzw.] kontinuierliche Entwicklung, allmähliche Fortentwicklung." Vor allem im Ausdruck der kontinuierlichen Entwicklung zeigt sich, daß schon die Definition von Evolution schwierig ist. Fortentwicklung kann sich auf viele Bereiche beziehen, sei es die Entwicklung von Lebewesen, die Entwicklung einfacher Tauschbeziehungen zu Märkten, oder auch der Entwicklung familialer Zusammenschlüsse. Menschliches Leben ist in einer Vielzahl von Beziehungen einem Wandel unterworfen. Aus diesem Grund soll hier nicht explizit auf bestimmte Modelle innerhalb soziobiologischer und ökonomischer Evolutorik eingegangen werden, sondern vielmehr aufgezeigt werden, welche grundlegenden Annehmen dahinter stehen.
Hierzu wird zuerst Darwins Theorie der Evolution näher betrachtet da sie die Grundlage vieler neuerer Evolutionstheorien bildet, bzw. Begriffe dieser Theorien sich häufig in evolutorischen Überlegungen wiederfinden.
Aufbauend hierauf soll versucht werden die Fragestellungen soziobiologischer und ökonomischer Evolutorik näher abzugrenzen. Hierfür werden deren elementaren Hypothesen genauer betrachtet, wobei auch die synonyme Verwendung von Begriffen und die Verwendung bildhafter Sprache zur Erklärung bestimmter Sachverhalte Erwähnung finden soll.
Als nächstes werden gesellschaftliche Phänomene wie Gruppenbildung, Egoismus und Altruismus und Kooperation näher betrachtet, da diese entscheidende Bestandteile menschlichen Verhaltens sind. Zur Erklärung werden hier das individualistische Zentraltheorem und die Theorie des reziproken Altruismus einerseits, und die Entstehung von Kooperation nach Axelrod verwendet.
In einem Ausblick werden dann abschließend weitere Aspekte der Evolution menschlichen Verhaltens dargestellt.
2. Die Evolutionstheorie Charles Darwins
Bevor man sich mit einer soziobiologischen oder ökonomischen Evolutorik beschäftigt, sollten zunächst die biologischen Grundlagen der Evolutionstheorie erläutert werden, da nicht nur beide Disziplinen sich Erkenntnisse derselben zu Nutze machen, sondern sich teilweise auch explizit auf sie berufen. Ferner werden in evolutionstheoretischen Modellen häufig Begriffe gebraucht, die der biologischen Theorie entliehen sind.
Es ist unbestreitbar, daß jedes organische Leben einer stetigen Entwicklung und Veränderung unterworfen ist. Bis ins späte neunzehnte Jahrhundert ging man davon aus, daß dieser Entwicklungsprozeß zielgerichtet sei, einem bestimmten Zweck diene, der von einer höheren Instanz vorgegeben sei. Mit seinem Werk ,,On the Origin of Species" sorgte Charles Darwin 1859 für Aufruhr, indem er dieser teleologischen Sicht der Evolution ein mechanisches Prinzip der Evolution entgegensetzte, das nicht mehr und nicht weniger als ein Naturprinzip ist, und eben nicht von einer höheren Instanz gegeben1.
Darwin stellt fest, daß sich alle Lebewesen in einem Kampf ums Überleben befinden2. Die Knappheit natürlicher Ressourcen, wie etwa Nahrung oder Lebensraum, bedingt, daß sich alle Individuen in einem Wettbewerb um diese Ressourcen befinden, um ihre Existenz zu sichern. Allerdings geht es beim Überleben hier nicht nur um das eigene Überleben, sondern vor allem auch um das Überleben der eigenen Art. So schreibt Darwin3: ,,I should premise that I use this term [struggle for existence] in a large and metaphorical sense, including dependence of one being on another, and including (which is more important) not only the life of the individual, but success in leaving progeny."
Nur die Arten und Individuen, die sich den Bedingungen des Existenzkampfs4 gut genug angepaßt haben überleben. Jedes Individuum müßte sein Handeln folglich danach richten in weit es seiner Tauglichkeit (fitness), unter den gegebenen Umweltbedingungen zu überleben dienlich ist. Individuen, die sich nicht ausreichend an ihre Umwelt anpassen werden selektiert, sie fallen der ,,natürlichen Auslese" anheim, werden aus der Gesamtheit der Natur entfernt. Allein das Prinzip des survival of the fittest reicht aber noch nicht, um Darwins Evolutionstheorie zu beschreiben. Der zweite wichtige Punkt ist die Feststellung, daß die Individuen einer Art in der Ausprägung ihrer Merkmale variieren, einzigartig sind. Wenn nun zwei Individuen einer Art Nachkommen hinterlassen, werden bei diesen wieder einige dieser Merkmale vorhanden sein, allerdings in einer neuen Kombination. Bei der Rekombination der Merkmale kann es zur Entstehung von Neuem - zur Mutation - kommen. Mutation kann durch Fehler im biologischen Reproduktionsprozeß entstehen. Dies wiederum stellt sicher, daß es eine hinreichend große Auswahl an Phänotypen innerhalb einer Art gibt, was es der Art zumindest ermöglicht sich auf eine Änderung externer Einflüsse einzustellen. Jedes neue Individuum tritt nun wieder in den Existenzkampf ein, und wird von der Natur dahingehend beurteilt wie gut es sich an seine Umweltbedingungen anpassen kann. Es setzt abermals der Prozeß der natürlichen Auslese ein, der darüber entscheidet ob das Individuum und damit langfristig auch die Art überlebt. Erst die Variation macht eine Selektion möglich. Wären alle Individuen einer Art gleich, wie und warum sollte dann eine Auswahl unter ihnen stattfinden5 ?
Die Determinanten der Evolution sind also nach Darwin Variation und Selektion. Die Variation ist dem Zufall überlassen, da die Eltern bei der Fortpflanzung keinen Einfluß auf die Weitergabe bestimmter Merkmale haben. Die Selektion hingegen ist nicht zufällig, sondern durch herrschende Umweltbedingungen gegeben. Das Überleben des Individuums hängt von seiner Tauglichkeit ab, sich an diese Bedingungen einzustellen. Entscheidend für das Überleben einer Art ist der Reproduktionserfolg der Individuen. Das Zusammenspiel von Variation und Selektion ist dann jenes Phänomen, das als Evolution bezeichnet wird. Die Evolution bezieht auf alle Aspekte des Lebenden6. Das heißt das auch das Verhalten von und die Interaktion zwischen Lebewesen der Evolution unterworfen sind7. Wenn nun also eine (Sozial)-Wissenschaft menschliches Verhalten untersucht, macht es Sinn auch die evolutorische Komponente in die Überlegungen mit einzubeziehen.
3. Fragestellungen und Annahmen
3.1 Eine gemeinsame Fragestellung?
Die Soziobiologie hat sich die ,,systematische Untersuchung der biologischen Grundlagen alles Sozialverhaltens" zum Ziel gesetzt8. Auch wenn hieraus zwar der Anspruch der Verallgemeinerung deutlich wird, ist meines Erachtens nach ein entscheidender Aspekt soziobiologischer Forschung das menschliche Verhalten9. Denn je komplexer die betrachtete Lebensform ist und vor allem je komplexer die soziale Interaktion zwischen Lebewesen, desto fruchtbarer können Forschungsergebnisse sein. Ein Schluß von einem komplexen Sachverhalt auf eine weniger komplexen, also eine deduktive Erklärung, ist sicherlich leichter und einleuchtender als im umgekehrten Falle.
Die Wirtschaftswissenschaft ihrerseits will die Funktionsweisen der Wirtschaft erklären, wobei ,,Wirtschaft als der rationale Umgang mit knappen Gütern"10 verstanden wird. Ob man nun allerdings eine Volkswirtschaft, einen Markt oder einen Haushalt betrachtet, es sind letztendlich immer Menschen die handeln, mit den knappen Gütern ,,umgehen" und miteinander oder gegeneinander agieren.
Bewußt verallgemeinert kann man also sagen, daß sowohl Soziobiologie als auch Ökonomik das Verhalten von Menschen untersuchen. Um nun aber fundierte Aussagen über das Verhalten zu treffen ist es nicht ausreichend nur eine statische Betrachtungsweise zu wählen, also nur zu untersuchen wie ein Mensch in einer gegebenen Situation handelt. Vielmehr sollte man sich zusätzlich fragen wie menschliches Verhalten entsteht, wie es sich entwickelt. Also zu fragen wie es dazu kommt, daß ein Mensch in einer gegebenen Situation auf eine bestimmte Art handelt indem man die Vergangenheit mit einbezieht. Aber auch dies reicht nicht aus um menschliches Verhalten zu erklären. Man muß ferner auch die Entstehung neuer Verhaltensweisen betrachten. Hier soll allerdings nicht die Frage geklärt werden was entstehen wird, sondern vielmehr wie es dazu kommt, daß überhaupt Neues entsteht. Hier setzt nun das Konzept einer evolutorischen Theorie menschlichen Verhaltens an, indem die Frage gestellt wird: Wie entwickelt sich Verhalten in den Dimensionen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft?
Auch wenn sich Soziobiologie und Ökonomik diesbezüglich in ihren Überlegungen unterscheiden, lassen sich doch einige Gemeinsamkeiten im Gang der Untersuchung und im Sprachgebrauch feststellen, die teilweise der im vorigem Kapitel dargestellten Theorie Darwins ähnlich sind, oder sich zumindest deren Terminologie bedienen. Einige Gemeinsamkeiten sollen nun im folgenden Abschnitt dargestellt werden.
3.1 Gemeinsame Rahmenbedingungen menschlichen Handelns
Sowohl in der soziobiologischen als auch der ökonomischer Evolutorik steht das Individuum im Zentrum der Betrachtung. Es wird davon ausgegangen, daß die elementaren Bestandteile einer Gesellschaft, und damit auch die Bestandteile von Gruppen, Organisationen, Unternehmen und politischen Körperschaften, Individuen sind. Soziales Verhalten, soziale Interaktion und Institutionen können folglich aus dem Handeln der Individuen erklärt werden. Dieses Prinzip des methodologischen Individualismus fordert, ,,daß Erklärungen auf die kleinsten möglichen Handlungseinheiten Bezug nehmen sollen."11. Ausgehend von der Betrachtung des Individuums wird nun ferner angenommen, daß das Handeln gewissen Einschränkungen unterliegt. Diese Einschränkungen treten zum einen in Form von natürlichen Ressourcen auf. Dieser Begriff wird in der Soziobiologie analog zu Darwin verwandt, bezeichnet also die Knappheit von Nahrung und Lebensraum. Die Handlungsmöglichkeiten der Individuen, die Auswahl an Strategien, sind also dahin gehend beschränkt, daß jedes Individuum sich an diese Knappheitssituation anpassen muß, und sich vor allem auch nicht beliebig fortpflanzen kann. Auch in der Ökonomik findet sich stets der Begriff der Knappheit von (natürlichen) Ressourcen. Waren diese Ressourcen lange Zeit beschränkt auf sehr greifbare (und meßbare) Werte wie das verfügbare Einkommen, die Preise am Markt erhältlicher Güter oder Zeit12, so wird der Begriff der Ressourcen in den Wirtschaftswissenschaften auch immer mehr auf andere Aspekte menschlichen Lebens angewandt. Genannt seinen hier Begriffe wie ,,... Wissen (Know-how),..., Kreativität (Innovationspotential), Tatendrang (Dynamik),... Sympathie und Vertrauen..."13.
Problematisch erscheint mir bei der Annahme von einer Knappheit natürlicher Ressourcen jedoch, daß hier wieder etwas als gegeben angenommen wird, was entscheidend das menschliche Verhalten beeinflußt. Jede Ressource, sei es nun Lebensraum oder Wissen, ist selbst im Zeitablauf einem Wandel unterworfen. Insofern muß grade diese Restriktion für menschliches Handeln selbst Bestandteil einer Evolutionstheorie sein. Eben hierzu äußerte sich Prof. Udo Müller in einem Interview wie folgt: ,,...Ich glaube, daß die Wirtschaftswissenschaften noch gar nicht voll verstanden hat, was Knappheit und Knappheitsbewältigung ist Was knapp ist, und was nicht knapp ist, findet die Evolution in einem Such-, Entdeckungs- und Optimierungsprozeß immer erst heraus..."14. Die eigentliche Triebfeder menschlichen Verhaltens ist sowohl aus soziobiologischer als auch ökonomischer Sicht ein Maximierungskalkül.
Die Soziobiologie geht davon aus, daß jedes Lebewesen auf den größtmöglichen Reproduktionserfolg bedacht ist. Der Fortpflanzungserfolg dient als Maßstab für die Bewertung der fitness eines Individuums, also seiner Tauglichkeit sich gegenüber der ,,feindlichen" Umwelt zu behaupten. Der Unterschied zur Darwinschen Theorie besteht nun darin15, daß die Soziobiologie nicht von der Gesamtheit der Merkmale eines Individuums spricht, sondern explizit auf die Erbanlagen, die Gene abstellt. Wenn nun die Weitergabe der eigenen Gene der entscheidende Beweggrund des Handelns ist, muß also jedes Individuum darauf bedacht sein die größtmögliche Zahl von Genen weiterzugeben, um sich den maximal erreichbaren Anteil am gesamten Genpool zu sichern. Ein Individuum wird also stets jene Handlung aus mehreren Alternativen wählen, die diesem Optimierungsziel am besten dient. Da nun aber nicht beliebig viele Nachkommen in die Welt gesetzt werden können, eben weil die natürlichen Ressourcen beschränkt sind entsteht ein Wettbewerb zwischen allen Individuen, in dem jedes egoistisch darauf bedacht ist sich durchzusetzen. Ein nahezu identisches Verhalten wird in der Ökonomie angenommen. Nicht Gene sind hier
Gegenstand der Maximierung, sondern der individuelle Nutzen. Dieser Nutzen indes ist nicht eindeutig definiert. Was und in welchem Maße etwas für einen Menschen Nutzen darstellt wird durch sogenannte Präferenzen vorgegeben. Auch hier muß also der Mensch in Anbetracht begrenzter Ressourcen seine Handlungen danach beurteilen, in wieweit sie seinem Nutzen dienen und jene Handlungsalternative wählen, die seinen Nutzen maximiert, wodurch er automatisch mit anderen Menschen in einen Wettbewerb tritt, die ja nun auch ihren Nutzen im Rahmen der Möglichkeiten maximieren wollen. Es läßt sich also festhalten: Der Mensch handelt in einer, ihn in seinem Handlungsraum einschränkenden, Umwelt stets nach einem egoistischen Optimierungskalkül. Wie können aber nun in einer von Egoisten bevölkerten Welt gesellschaftliche Zusammenschlüsse wie Familien, Unternehmen oder Staaten entstehen? Dieser Punkt scheint der Prüfstand für eine evolutorische Theorie zu sein, da eben jene Zusammenschlüsse ein entscheidender Bestandteil menschlichen Lebens sind. Mögliche Erklärungen für ein solches Verhalten sollen nun im nächsten Kapitel dargestellt werden.
4. Die Evolution von Altruismus und Kooperation
4.1 Egoismus und Altruismus
Bedenkt man nun die im letzten Kapitel dargestellten Grundannahmen erscheint ein Zusammenleben, das ja altruistisches Verhalten voraussetzt, im Widerspruch dazu zu stehen. Die Soziobiologie ist jedoch durchaus in der Lage Altruismus zu erklären. Es wurde bereits festgestellt, daß jedes Individuum eine möglichst große (im quantitativen Sinne) Verbreitung seiner Gene anstrebt. Die eigenen Gene finden sich aber nicht nur im Individuum selbst wieder, sondern auch in Verwandten des Individuums. Betrachtet man nun also den Reproduktionserfolg im Hinblick auf den Anteil der eigenen Gene am gesamten Genpool, die Gesamteignung des Individuums (inclusive fitness), kann es für ein Individuum durchaus sinnvoll erscheinen sich anderen gegenüber altruistisch zu verhalten. Die Soziobiologie bedient sich des sogenannten individualistischen Zentraltheorems, wobei sie sich einen ökonomischen Erklärungsansatzes dienstlich macht. Das Individuum wird sein Handeln danach beurteilen welche Kosten ihm dadurch entstehen, wobei Kosten als die Einbuße an Gesamteignung interpretiert werden, und welcher Nutzen ihm entsteht, also welcher Zuwachs an Gesamteignung zu erwarten ist. Bei dieser Kosten-Nutzen-Analyse wird ferner der Verwandtschaftsgrad des durch die Handlung Betroffenen in die Überlegung einbezogen. Ist das Verhältnis von Nutzen zu Kosten größer als ein aus dem Verwandtschaftsgrad abgeleiteter Vergleichswert, wird diese Handlung gewählt16. Die Weitergabe der eigenen Gene kann also unter Umständen kostengünstiger realisiert werden, wenn man verwandten Individuen hilft, weil diese sich dann ihrerseits leichter fortpflanzen können. Altruismus ist in diesem Falle also nichts anderes als eine Handlungsstrategie, die den eigenen Nutzen fördert.
Hiermit läßt sich nun auch die Bildung von Gruppen, etwa einer Familie, erklären. Die Individuen einer Gruppe genießen durch gegenseitige Unterstützung Kostenvorteile gegenüber nicht organisierten Individuen. Dieser Kostenvorteil ist nun aber wiederum nichts anders als eine Metapher für den Selektionsvorteil den die Gruppenbildung darstellt. Die Entstehung von Altruismus unter Verwandten ist unter dem Aspekt der Gesamteignung somit durchaus plausibel. Wie aber kann es zu Altruismus zwischen nicht verwandten Individuen kommen? Die Antwort hierauf liefert das Prinzip des reziproken Altruismus. Wenn ein Individuum nun die Alternativen einer Handlung abwägt, die die Interaktion mit einem nicht artverwandtem anderem beinhaltet, wird auch hier eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt. Hierbei ist dann vor allem entscheidend, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, daß beide Individuen sich nochmals in derselben Situation gegenüberstehen. Können beide Individuen aus einer Kooperation Nutzen ziehen und tritt die Situation häufig auf, werden beide Individuen die Kooperation als Handlungsstrategie wählen. Sie helfen sich gegenseitig und verschaffen sich dadurch jeweils einen Selektionsvorteil17.
In der Ökonomie gibt es ein analoges Beispiel anhand dessen das Prinzip des reziproken Altruismus näher betrachtet werden soll.
4.2 Das Entstehen von Kooperation
Robert Axelrod entwickelte einen spieltheoretischen Ansatz mit dessen Hilfe die Entstehung von Kooperation und damit Altruismus erklärt werden kann. Axelrod erstellte ein Turniersystem in dem verschiedene Strategien in mehreren Spielrunden gegeneinander antraten. Das Spiel selbst war die Situation eines Gefangenendilemmas. Nachdem das Turnier zweimal unter leicht unterschiedlichen Bedingungen gespielt wurde stellte sich heraus, daß die beste Handlungsstrategie ,,Tit for Tat" war18. Diese Handlungsstrategie ( übersetzt in etwa: Wie Du mir so ich Dir) besagt, daß zuerst immer Kooperation angestrebt werden sollte. Wird dies vom Handlungspartner ausgenutzt, reagiert Tit for Tat seinerseits mit nicht kooperativem Verhalten. Sollte jedoch die Gegenseite wieder auf kooperatives Verhalten wechseln, verhält sich auch der Tit for Tat -Spieler wieder kooperativ. Hier beginnt nun der evolutorische Ansatz Axelrods. Unter Berufung auf die evolutorische Biologie simulierte er zukünftige Generationen von Turnieren unter der Bedingung, daß die Spieler auch in Zukunft häufig miteinander interagieren werden19. Die Wahrscheinlichkeit, daß eine erfolgreiche Strategie in der nächsten Generation wieder vertreten sein wird groß ist, während weniger erfolgreiche Strategien weniger häufig als vorher gewählt werden. Die Anzahl an Kopien ( Nachwuchs ) einer Strategie verhält sich proportional zum Erfolg derselben20. Mit der Zeit wird die verschiedenen Strategien immer weiter selektiert, es findet eine natürliche Auslese statt, bis sich schließlich eine als die erfolgreichste oder am besten funktionierende herausgebildet hat. In diesem Fall war es Tit for Tat, eine Strategie die gegenseitigen ( reziproken) Altruismus belohnt. Dieser Vorgang , so Axelrod, simuliert das darwinistische Prinzip der survival of the fittest21.
Um hieraus ein evolutorisches Prinzip zu folgern, muß aber noch eine weitere Bedingung erfüllt sein. Die Entstehung von Neuem, von Mutation muß möglich sein. Tritt nun eine Mutation in Form einer neuen Strategie auf, könnte ein Individuum, das diese einsetzt den Altruismus der Anderen ausnutzen, um so seinen Nutzen zu maximieren. Wenn dieses Individuum es schafft durch den Einsatz der ,,mutierten" Strategie einen größeren Nutzen zu ziehen, als den durchschnittlich in der Population erreichten, kann diese Strategie die vorherrschende ablösen. Wird nun aber eine kooperative Strategie von einen Großteil der Bevölkerung eingesetzt ist die Auswirkung einer egoistischen Strategie als so gering anzusehen, daß sie die herrschende Strategie nicht nachhaltig beeinträchtigen kann22. Die herrschende Strategie ist dann ein evolutionsstabile Strategie.
Kooperation oder auch reziproker Altruismus können also als evolutionsstabile Strategien
menschlichen Verhaltens angesehen werden, die sich im Laufe der Zeit als Selektionsvorteil, bzw. Nutzenvorteil herausgestellt haben.
5. Schlußbemerkungen
Ist es nun möglich die Komplexität menschlichen Sozialverhaltens mit den bisher dargestellten, grundlegenden Annahmen zu erklären?
Die soziobiologische Theorie macht es sich hier relativ leicht indem sie sagt, daß jegliches menschliches Verhalten genetisch vorprogrammiert ist. Alle Anlagen zu sozialer Interaktion sind also bereits im Genotypus vorhanden. Das würde nun wiederum auch bedeuten, daß menschliche Kultur und ethische Normen rein genetisch bedingt sind. Die Problematik hierbei ist nun in erster Linie, daß dieser Sachverhalt sich nicht beweisen oder widerlegen läßt. Da die Genetik bisher noch nicht in der Lage war sämtliche im Erbgut vorhandenen Informationen zu entschlüsseln, kann auch die Soziobiologie nur Vermutungen und Hypothesen aufstellen. Mithin ist es eine unangenehme Vorstellung, daß unsere Kultur nichts weiter als ein im Reproduktionsprozeß entstandener Selektionsvorteil sein soll. Sieht sich die Soziobiologie hier vielleicht derselben Ablehnung gegenüber, die auch Darwin durch sein Werk entgegengebracht wurde?
Die Meinungen innerhalb der Soziobiologie gehen hier allerdings auseinander, so entwickelte Dawkins das Konzept der Meme. Meme sind Gedanken, Ideen, modische Vorlieben oder Know-how23. Sie breiten sich im Mem-Pool aus und sind ihrerseits einer Evolution unterworfen. Auf den ersten Blick scheinen Dawkins Meme aus der Luft gegriffen zu sein, aber vielleicht sind sie einfach nur der Versuch, nicht erklärbares Verhalten unter einem Begriff zu subsumieren. Ein Phänomen, das sich auch in ökonomischen Theorien wiederfindet.
Erinnern wir uns an die vom ökonomischen Menschen praktizierte Nutzenmaximierung. Der Nutzen wird durch Präferenzen bedingt. Was genau sind denn nun aber diese Präferenzen und wie entstehen sie? Die Präferenzen könnten der, durch Evolution gebildete, Bewertungsmaßstab einer Handlung im Bezug auf ihren Reproduktionserfolg sein. Je größer also dann der ökonomische Erfolg eines Individuums oder einer Gruppe von Individuen wäre, desto größer wäre auch ihr Reproduktionserfolg. Witt weist zurecht auf folgendes hin (1987, S. 110): ,,Tatsächlich besteht jedoch in den modernen Industriegesellschaften kein solcher Zusammenhang zwischen Verhaltensweisen bzw. -motiven, die wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Erfolg von Individuen bewirken, und der Zahl der Nachkommen. Eher scheint Kinderreichtum negativ mit wirtschaftlichem und sozialem Status korreliert."
Auch hier mag der Einwand erhoben werden, daß der Mensch mehr als eine Reproduktionsmaschine ist. Auch hier könnte man die bereits erwähnte Ablehnung gegenüber neuer Theorien als Gegenargument anbringen.
Fest steht jedoch, daß soziobiologische und ökonomische Evolutorik durch zweierlei gekennzeichnet sind.
Erstens durch die Erkenntnis, daß die Erklärung menschlichen Verhaltens zwingend erfordert die Evolution menschlichen Verhaltens zu untersuchen. Bei weiterführenden Betrachtungen sollten hier Dinge wie Lernverhalten, Innovationen und eben auch kulturelle Erbschaft im Zentrum des Interesses stehen. Da aber die Untersuchung menschlichen Sozialverhaltens sprichwörtlich vom ,,hundertsten ins tausendste" führt, wird mit jedem Schritt den die Evolutorik macht eine neuer Themenbereich aufgedeckt.
Zweitens durch die Tatsache, daß beide Disziplinen im Umgang mit Begriffen bei jeweils anderen Wissenschaften borgen. Entscheidende Begriffe und Analogien, bzw. Metaphern seien hier nochmals erwähnt: nat ü rliche Ressourcen, Selektions-, bzw. Kostenvorteile, die natürliche Auswahl, Reproduktionserfolg und Nutzenmaximierung. Problematisch bei allen diesen Begriffen ist, daß eine genaue Bedeutung des Wortes nicht festgelegt ist, daß sie manchmal einen identischen, manchmal einen unterschiedlichen Sachverhalten schildern. Warum kann sich nun die evolutorische Theorie nicht auf einen bestimmten Wortschatz einigen, so wie die Wirtschaftswissenschaften sich z.B. der Mathematik bedienen?
Der Reiz und gleichzeitig das Problem evolutorischer Theorien und Fragestellungen liegt meines Erachtens in der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeit. Wie bereits erwähnt, bezieht sich die Evolution auf alles Lebende. Möglicherweise befinden sich Soziobiologie und Ökonomie damit auf dem Weg zu einer universellen Theorie des Lebens. Dieser wünschenswerte Ansatz beinhaltet aber eben auch ein ,,darwinistisches" Problem - die Akzeptanz gegenüber einer solchen Theorie. Der Vorwurf eines Imperialismus der Ökonomie wird erhoben, die Soziobiologie wird heftig kritisiert. Dies könnte die dämmernde Erkenntnis sein, daß die Evolutorik sozusagen die ,,Mutter aller Wissenschaften" ist.
Literaturverzeichnis
Axelrod, R.; ,,The evolution of cooperation"; München; 1989
Darwin, C.; ,,On the Origin of Species by Means of Natural Selection,or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life"; Down, Bromley, Kent; 1859; Project Gutenberg; http:///www.gutenberg.net http://www.gutenberg.net; E-Text Nr. 1228; 1998 Dawkins, R.; ,,Das egoistische Gen", Berlin, 1978
Engelhardt, G.; ,,Imperialismus der Ökonomie"; in: Schäfer/Wehrt (Hrsg.): ,,Die
Ökonomisierung der Sozialwissenschaften, Sechs Wortmeldungen"; Frankfurt a.M.; 1989; S. 19-49
Frey, B.S.; ,,Möglichkeiten und Grenzen des ökonomischen Denkansatzes"; in: Schäfer/Wehrt (Hrsg.): ,,Die Ökonomisierung der Sozialwissenschaften, Sechs Wortmeldungen"; Frankfurt a.M.; 1989; S.69-102
Frey, B. S.; ,,Ökonomie ist Sozialwissenschaft: die Anwendung der Ökonomie auf neue Gebiete"; München; 1990
Hanappi, H.; ,,Evolutionary Economics: the evolutionary revolution in the social sciences"; Aldershot; 1996
Hodgson, G.M.; ,,Economics and Evolution - Bringing Life back into Economics"; Cambridge, 1994
Marten, H.-G; ,,Soziobiologismus: biologische Grundlagen der politischen Ideengeschichte"; Frankfurt a.M., New York, 1983
Müller, U.; ,,Das nächste Jahrtausend wird die Fragen neu formulieren...", in: Der Kapitalist; http://www.wiwi.uni-hannover.de/fsr-wiwi/kapitalist/mueller.htm; 1995 Tietzel, M.; ,,Ökonomie und Soziobiologie oder: Wer kann was von wem lernen?"; in:
Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften; 1983/2; S. 107-127
Wuketits, F. M.; ,,Gene, Kultur und Moral: Soziobiologie - pro und contra"; Darmstadt; 1990
[...]
1 Wuketits, F. M., 1990, S.30
2 Darwin, C.,1998, Kapitel III
3 ebenda
4 Darwin lehnt sich bei seiner Vorstellung vom Existenzkampf an das Malthussche Bevölkerungsgesetz an. Siehe hierzu Marten, H.-G., 1983, S. 69ff
5 Hanappi, H., 1994, S. 11
6 Wuketits 1990, S. 27
7 Ob hieraus auch geschlossen werden kann, daß menschliches Verhalten rein biologisch determiniert ist, ist umstritten und einer der vehementesten Kritikpunkte, der der Soziobiologie gegenüber ins Feld geführt wird.
8 Wilson, E.O., 1975, zitiert bei: Tietzel, M., 1983, S.109
9 Nicht umsonst wird und wurde die Soziobiologie grade im Hinblick auf ihre Erklärungen menschlichen Verhaltens stark kritisiert. Für eine umfassende Diskussion soziobiologischer Einflüsse auf politische Ideenbildung und gesellschaftlicher Strukturen siehe: Marten. H.-G., 1983
10 Definition entnommen aus: Gabler, 1994
11 Tietzel, M., 1983, S. 115
12 Frey, B. S., 1990, S. 7
13 Engelhardt, G., 1989, S. 24
14 Müller, U., in: Der Kapitalist, 1995
15 Darwin spricht in ,,On the Origin of Species" zumeist vom Phänotyp. Hierbei ist allerdings zu beachten, daß zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Werkes die Genetik noch in ihren Kinderschuhen steckte.
16 Tietzel, M., 1983, S. 119f
17 Wuketits, F.M., 1990, S. 53ff
18 Da der genaue Ablauf des Turniers bereits im Rahmen des Seminars behandelt wurde, erfolgt hier keine genauere Beschreibung des Spielsystems, sondern ein direkter Ansatz am Ergebnis des Turniers.
19 Axelrod, R., 1989, S. 49
20 ebenda
21 Axelrod, R., 1989, S. 50f
22 Axelrod, R., 1989, S. 56f
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Erklärung von Evolution durch soziobiologische und ökonomische Theorien und den damit verbundenen Begriffen. Sie untersucht, welche grundlegenden Annahmen diesen Theorien zugrunde liegen.
Warum wird Darwins Evolutionstheorie behandelt?
Darwins Theorie dient als Grundlage für viele neuere Evolutionstheorien. Begriffe aus Darwins Theorie finden sich häufig in evolutorischen Überlegungen wieder.
Welche Fragestellungen verfolgen Soziobiologie und Ökonomik im Kontext der Evolution?
Die Arbeit grenzt die Fragestellungen soziobiologischer und ökonomischer Evolutorik ab, indem sie deren elementare Hypothesen betrachtet und die synonyme Verwendung von Begriffen sowie die Verwendung bildhafter Sprache zur Erklärung bestimmter Sachverhalte analysiert. Die Arbeit untersucht, wie sich Verhalten in den Dimensionen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft entwickelt.
Welche gesellschaftlichen Phänomene werden untersucht?
Die Arbeit betrachtet Phänomene wie Gruppenbildung, Egoismus, Altruismus und Kooperation, da diese wesentliche Bestandteile menschlichen Verhaltens sind. Sie verwendet das individualistische Zentraltheorem und die Theorie des reziproken Altruismus sowie die Entstehung von Kooperation nach Axelrod zur Erklärung.
Was sind die gemeinsamen Rahmenbedingungen menschlichen Handelns in Soziobiologie und Ökonomik?
Beide Disziplinen betrachten das Individuum als zentralen Akteur und gehen davon aus, dass das Handeln durch begrenzte Ressourcen eingeschränkt wird. Sie nehmen an, dass Menschen nach einem Maximierungskalkül handeln, um ihren Reproduktionserfolg (Soziobiologie) oder ihren individuellen Nutzen (Ökonomik) zu optimieren.
Wie erklären Soziobiologie und Ökonomik Altruismus und Kooperation?
Die Soziobiologie erklärt Altruismus durch das individualistische Zentraltheorem und die Berücksichtigung des Verwandtschaftsgrades. Kooperation kann vorteilhaft sein, wenn sie den Genpool verwandter Individuen fördert, die die gleichen Gene haben. Das Prinzip des reziproken Altruismus erklärt Altruismus zwischen Nicht-Verwandten durch die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Interaktionen. Axelrods spieltheoretischer Ansatz zeigt, wie Kooperation durch die Strategie "Tit for Tat" entstehen kann.
Was sind Meme im Kontext der Soziobiologie?
Meme sind Ideen, Gedanken, modische Vorlieben oder Know-how, die sich im Mem-Pool ausbreiten und einer Evolution unterworfen sind. Sie sind Dawkins' Versuch, nicht vollständig erklärbares Verhalten unter einem Begriff zu subsumieren.
Was ist die Kritik an der soziobiologischen und ökonomischen Evolutorik?
Kritisiert wird, dass die Soziobiologie menschliches Verhalten als genetisch vorprogrammiert betrachtet und menschliche Kultur und ethische Normen rein genetisch bedingt sind. Weiterhin steht der Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Erfolg und Reproduktionserfolg in modernen Industriegesellschaften in Frage.
Was sind die Schlussfolgerungen der Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die Erklärung menschlichen Verhaltens zwingend die Untersuchung der Evolution menschlichen Verhaltens erfordert. Beide Disziplinen borgen sich Begriffe voneinander, was zu einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten führt, aber auch die Akzeptanz solcher Theorien erschwert.
- Arbeit zitieren
- Björn Schau (Autor:in), 2000, Metaphern und Fragestellungen soziobiologischer und ökonomischer Evolutorik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97643