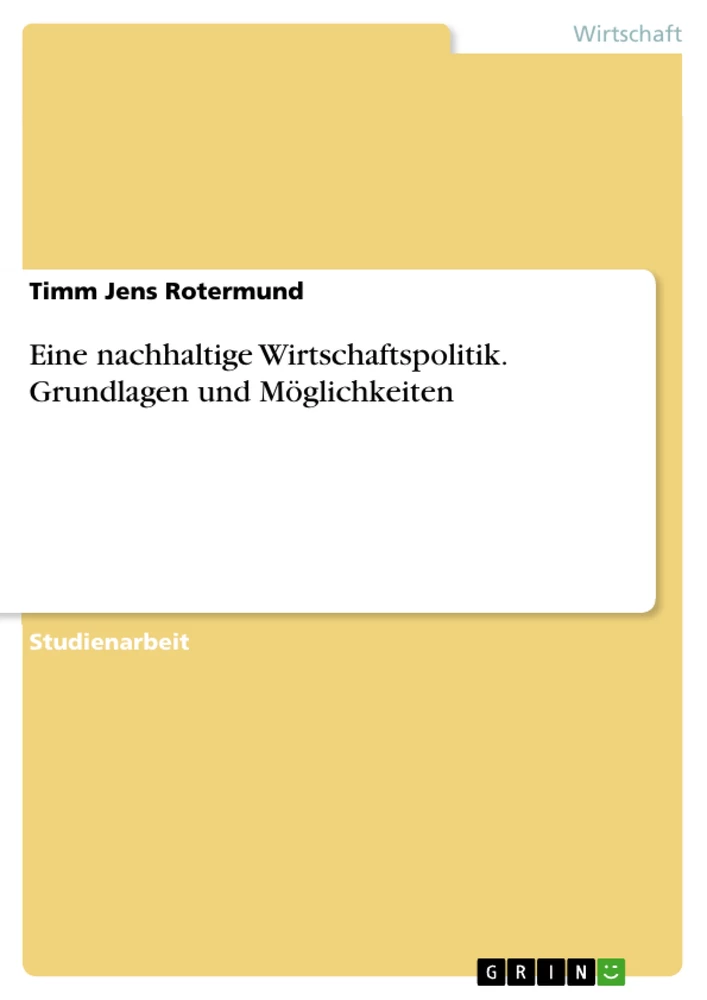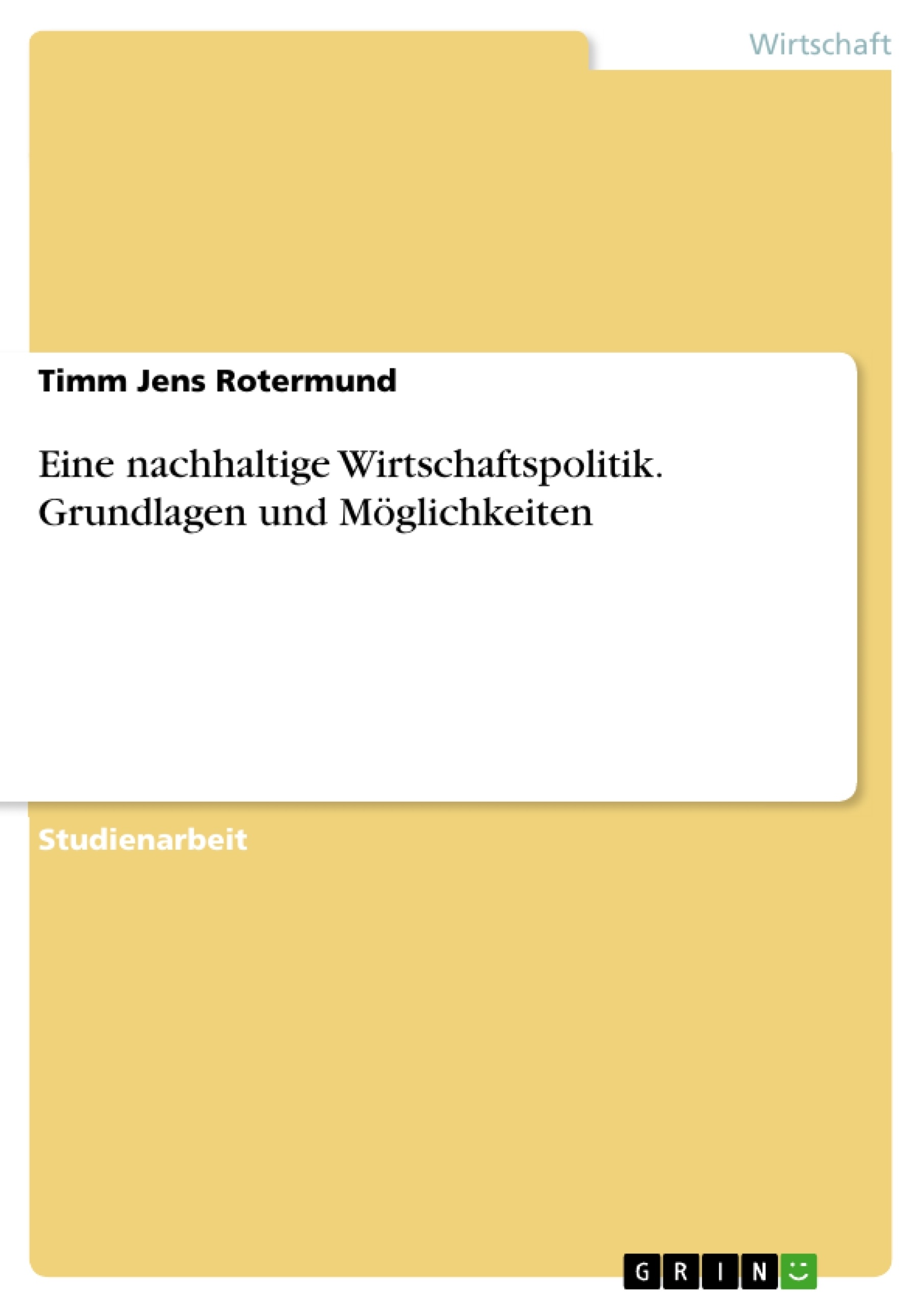Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Grundlagen der nachhaltigen Wirtschaftspolitik. Im Vorfeld ist jedoch im Einzelnen zu klären, was überhaupt Nachhaltigkeit ist, wie sie entstand und von welcher Bedeutung sie ist. Des Weiteren ist zu klären, was eigentlich eine Wirtschaftspolitik ist. Woraus besteht eine Wirtschaftspolitik? Die Arbeit geht, außerdem, auf die Gesellschaft ein, mit dem Fokus auf unser Konsumverhalten.
Unsere Welt steht vor einer Reihe von Herausforderungen, denen sich die Gesellschaft mit hoher Dringlichkeit zu stellen hat. Die weltweite wachsende Gesellschaft, die Globalisierung der Märkte, die Veränderung der demografischen Struktur, der beschleunigte technologische Fortschritt, die Urbanisierung und die steigende Bedeutung der Schwellenländer gehören zu den Megatrends, denen sich weltweite Politik und Wirtschaft gegenüberstehen.
Die globale Erwärmung und die Folgen, welche auf das Klima und Ökosystem zurückfallen sind im wesentlich auf diese und weitere Ursachen zurückzuführen. Durch die stetig steigende Nachfrage der Gesellschaft gelangen wir eines Tages an einen Punkt, an dem diese nicht mehr gesättigt werden kann, denn unsere Ressourcen sind knapp.
Es ist also ein möglichst sparsamer, umweltbewusster, langfristiger und wertbewusster Umgang mit unseren Ressourcen gefordert, um das Leben kommender Generationen mit ähnlichen Gegebenheiten zu gewähren.
Dieser Thematik stellt sich der Begriff der Nachhaltigkeit, welchen ich, neben dem Verhalten der aktuellen Wirtschaftspolitik und der Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik in meiner Facharbeit aus neutraler Sicht näher erläutern möchte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Nachhaltigkeit
- 2.1. Die Geschichte der Nachhaltigkeit und die Problemstellungen
- 2.2. Allgemeine Grundlagen der Nachhaltigkeit
- 2.3. Zielsetzungen der Nachhaltigkeit
- 2.3.1. Soziale Zielsetzung
- 2.3.2. Ökonomische Zielsetzung
- 2.3.3. Ökologische Zielsetzung
- 2.4. Modelle der Nachhaltigkeit
- 2.4.1. Ausgewogene Nachhaltigkeitsmodelle
- 2.4.2. Gewichtetes Nachhaltigkeitsmodell
- 2.5. Quantifizierung der Nachhaltigkeit
- 2.5.1. Performance Measurement
- 2.5.2. Performance Measurement System in der Praxis
- 3. Wirtschaften
- 3.1. Definition der Wirtschaft
- 3.2. Zielsetzung des Wirtschaftens
- 3.3. Die Kernproblematik
- 4. Nachhaltiges Wirtschaften (Sustainable Business)
- 4.1. Wirtschaftspolitik
- 4.2. Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik (Green Economy)
- 5. Kritik an der nachhaltigen Entwicklung
- 6. Fazit
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit untersucht die Grundlagen einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik. Sie klärt zunächst die Begriffe Nachhaltigkeit und Wirtschaftspolitik, beleuchtet das Konsumverhalten der Gesellschaft und analysiert anschließend die Entwicklung und kritische Betrachtung einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik.
- Definition und historische Entwicklung des Nachhaltigkeitsbegriffs
- Die Bedeutung von Wirtschaftspolitik im Kontext von Nachhaltigkeit
- Analyse des Konsumverhaltens und dessen Einfluss auf Nachhaltigkeit
- Grundlagen und Herausforderungen einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik
- Kritische Auseinandersetzung mit der nachhaltigen Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die globalen Herausforderungen wie Bevölkerungswachstum, Globalisierung und Klimawandel, die einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen erfordern. Sie führt den Begriff der Nachhaltigkeit ein und kündigt die Analyse der aktuellen Wirtschaftspolitik und der Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik an.
2. Nachhaltigkeit: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte des Nachhaltigkeitsbegriffs, beginnend mit Hans Carl von Carlowitz und seiner Waldbewirtschaftung. Es werden wichtige Meilensteine wie die Studie "Die Grenzen des Wachstums" des Club of Rome und die UN-Weltcharta für die Natur erläutert und die verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit (ökologisch, ökonomisch, sozial) sowie Modelle zur Quantifizierung von Nachhaltigkeit diskutiert.
3. Wirtschaften: Hier wird der Begriff "Wirtschaften" definiert und die Zielsetzung des Wirtschaftens beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Kernproblematik, die sich aus dem Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichem Wachstum und den Grenzen der natürlichen Ressourcen ergibt.
4. Nachhaltiges Wirtschaften (Sustainable Business): Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik, inklusive der Entwicklung einer Green Economy. Es untersucht Strategien und Maßnahmen, um Wirtschaft und Umwelt in Einklang zu bringen.
Schlüsselwörter
Nachhaltigkeit, Wirtschaftspolitik, Green Economy, Konsumverhalten, Ressourcenknappheit, ökologische, ökonomische und soziale Zielsetzungen, Performance Measurement, Nachhaltigkeitsmodelle.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Facharbeit: Nachhaltige Wirtschaftspolitik
Was ist der Inhalt dieser Facharbeit?
Die Facharbeit untersucht die Grundlagen einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik. Sie beleuchtet den Nachhaltigkeitsbegriff und die Wirtschaftspolitik, analysiert das Konsumverhalten und untersucht die Entwicklung und kritische Betrachtung einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu Nachhaltigkeit, Wirtschaften, nachhaltigem Wirtschaften (Sustainable Business), Kritik an nachhaltiger Entwicklung, ein Fazit und ein Literaturverzeichnis.
Welche Themen werden in der Facharbeit behandelt?
Die Facharbeit behandelt folgende Themen: Definition und historische Entwicklung des Nachhaltigkeitsbegriffs, die Bedeutung von Wirtschaftspolitik im Kontext von Nachhaltigkeit, Analyse des Konsumverhaltens und dessen Einfluss auf Nachhaltigkeit, Grundlagen und Herausforderungen einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik, kritische Auseinandersetzung mit der nachhaltigen Entwicklung, sowie verschiedene Nachhaltigkeitsmodelle und deren Quantifizierung (Performance Measurement).
Wie ist die Facharbeit strukturiert?
Die Facharbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Nachhaltigkeit (inkl. Geschichte, Grundlagen, Zielsetzungen, Modelle und Quantifizierung), Wirtschaften (inkl. Definition, Zielsetzung und Kernproblematik), Nachhaltiges Wirtschaften (Sustainable Business) mit Fokus auf Wirtschaftspolitik und Green Economy, Kritik an der nachhaltigen Entwicklung, Fazit und Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgelistet.
Welche Aspekte der Nachhaltigkeit werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die ökologischen, ökonomischen und sozialen Dimensionen der Nachhaltigkeit. Es werden verschiedene Nachhaltigkeitsmodelle (ausgewogene und gewichtete Modelle) diskutiert und Methoden zur Quantifizierung der Nachhaltigkeit (Performance Measurement) erläutert.
Welche Rolle spielt die Wirtschaftspolitik in der Facharbeit?
Die Wirtschaftspolitik spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit analysiert die Bedeutung von Wirtschaftspolitik im Kontext von Nachhaltigkeit und untersucht die Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik (Green Economy) inklusive Strategien und Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Wirtschaft und Umwelt.
Wie wird das Konsumverhalten in der Facharbeit behandelt?
Das Konsumverhalten wird analysiert und dessen Einfluss auf die Nachhaltigkeit untersucht. Es wird der Zusammenhang zwischen Konsum und den Herausforderungen einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik beleuchtet.
Welche Kritik an der nachhaltigen Entwicklung wird behandelt?
Die Facharbeit widmet ein eigenes Kapitel der kritischen Auseinandersetzung mit der nachhaltigen Entwicklung. Der genaue Inhalt der Kritik wird in der Zusammenfassung nicht detailliert dargestellt, ist aber Bestandteil der Arbeit.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Facharbeit verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Nachhaltigkeit, Wirtschaftspolitik, Green Economy, Konsumverhalten, Ressourcenknappheit, ökologische, ökonomische und soziale Zielsetzungen, Performance Measurement, Nachhaltigkeitsmodelle.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen finden sich im vollständigen Text der Facharbeit, inklusive der detaillierten Kapitelzusammenfassungen und des Literaturverzeichnisses.
- Arbeit zitieren
- Timm Jens Rotermund (Autor:in), 2019, Eine nachhaltige Wirtschaftspolitik. Grundlagen und Möglichkeiten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/976540