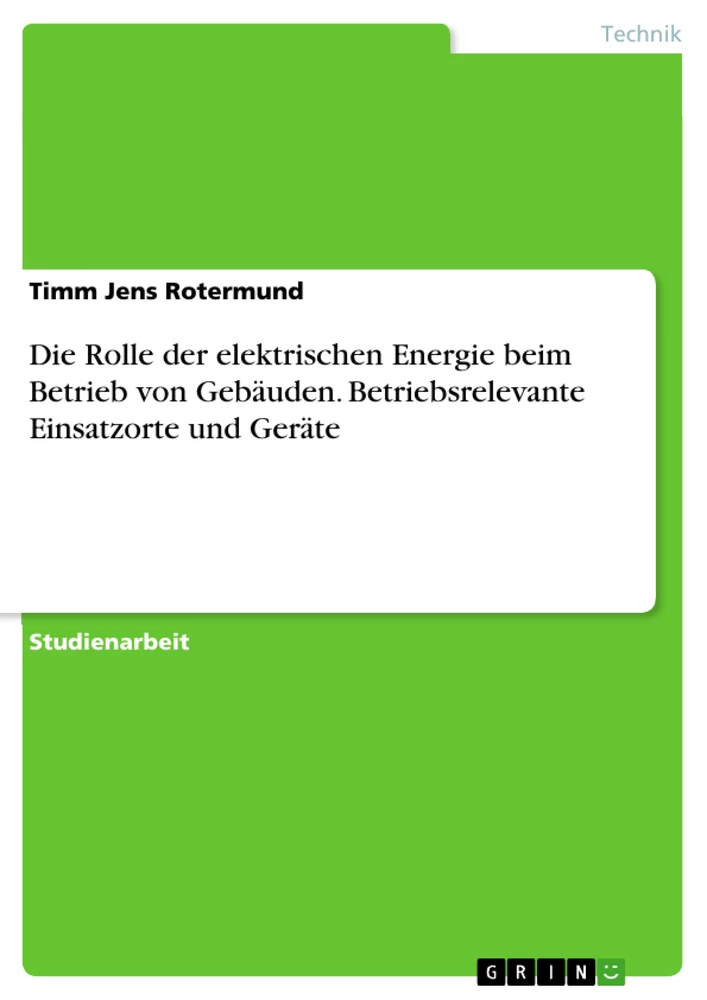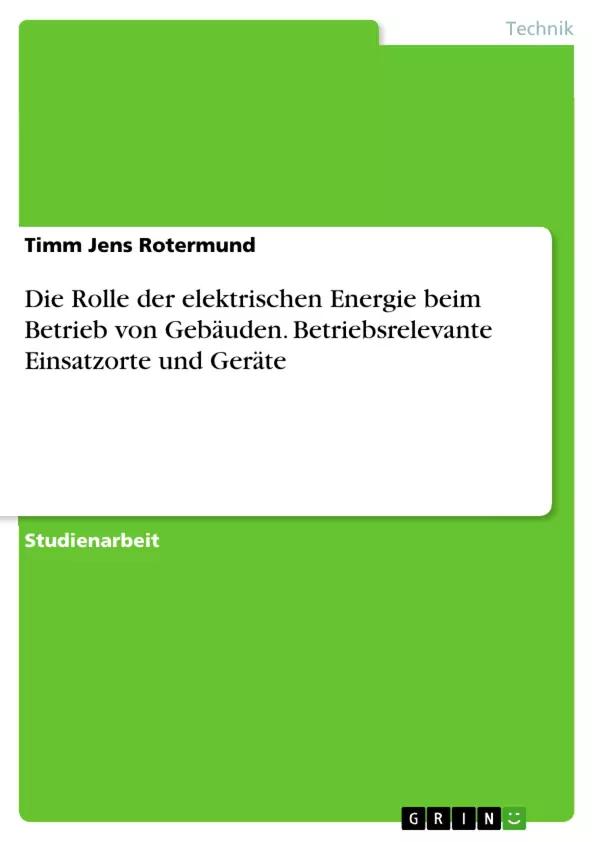In dieser Arbeit wird besonders auf die betriebsrelevanten Einsatzorte der elektrischen Energie, die betriebsrelevanten Geräte und Komponenten und Funktionsweisen eingegangen. Darüber hinaus wird auf die gebäude- und verbrauchsabhängige Leistungsaufnahme, die zeitliche Komponente sowie auf die Auslegungsparameter und Berechnungsweisen eingegangen.
Zur heutigen Zeit sind Elektroinstallationen im Gebäude ein wesentlicher Grundbaustein, ohne den ein Betrieb
unvorstellbar ist. Heute noch stellen sich nicht wenige Bauherren und Architekten unter Elektroinstallationen im Wesentlichen Steckdosen, Schalter und Leuchten, einen Sicherungskasten und einen Hausanschluss vor. Dies gehört zwar dazu, ist aber bei weitem noch nicht alles. Die Elektrotechnik ist essenziell für den Betrieb von Gebäuden. Der heutige Stand der Technik und die stetig wachsenden Möglichkeiten bieten immer mehr Möglichkeiten die Gebäudetechnik weiterzuentwickeln.
Einen bemerkenswerten Durchbruch brachte die Idee, die Energie- und Informationsversorgung physisch voneinander zu trennen. Im Vergleich zur vorherigen Installationsweise hat dies den Vorteil, dass sämtliche Ein- und Ausgabegeräte durch einen gezielten Informationsaustausch miteinander verbunden werden können. Die Elektrotechnik spielt bei vielen Fragen der Gebäudetechnik eine wichtige Rolle, wie beispielsweise bei der Gebäudeautomation und bei regenerativen Energiesystemen, deren Planung teilweise direkt mit der Gebäudeplanung verbunden ist.
In unserer modernen Industriegesellschaft werden immer mehr Abläufe und Prozesse automatisiert, auch in der Gebäudetechnik. Eine zeitgemäße Elektroinstallation in Gebäuden jeglicher Art ist die Grundlage und Be- standteil der gesamten Technik im Gebäude, insbesondere aber der Gebäudeautomation, welche in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht hat. Dies liegt einerseits den technischen Fortschritten als auch den steigenden Bedürfnissen nach Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz und Kosteneinsparung zugrunde. Für den Menschen als Anwender ist mittlerweile eine Vielzahl an automatisierten Funktionen oder im Hintergrund laufenden Geräten beinahe unbemerkt eine Selbstverständlichkeit geworden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung in die Thematik.
- Einsatzorte der elektrischen Energie im Gebäude
- Elektroinstallationen im Gebäude.
- Konventionelle Elektroinstallationen.......
- Gebäudeautomation......
- Aufbau und Funktionsweise...
- Einsatzorte und Funktionen der Gebäudeautomation
- Klassifizierung und Einsparpotentiale.
- Kostenbetrachtung der Elektroinstallationen..
- Leistungsbedarf und Anschlussleistung.
- Analyse und Bewertung des elektrischen Energieverbrauchs...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit befasst sich mit der Rolle der elektrischen Energie beim Betrieb von Gebäuden. Ziel ist es, die verschiedenen Einsatzorte und Funktionen der elektrischen Energie im Gebäude zu erläutern und deren Bedeutung für die Funktionsfähigkeit und Effizienz von Gebäuden aufzuzeigen.
- Die Bedeutung der Elektrotechnik für den Betrieb von Gebäuden
- Die Rolle der Gebäudeautomation in der modernen Gebäudetechnik
- Die Kosten und den Leistungsbedarf von Elektroinstallationen
- Die Analyse und Bewertung des elektrischen Energieverbrauchs in Gebäuden
- Die Bedeutung der elektrischen Energieversorgung für die verschiedenen Gewerke im Gebäude
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der elektrischen Energie im Gebäudekontext dar und führt die zentrale Bedeutung der Elektrotechnik für den Betrieb von Gebäuden aus.
Kapitel 2 widmet sich den verschiedenen Einsatzorten der elektrischen Energie im Gebäude und differenziert die Anforderungen an die technische Gebäudeausrüstung und die dazugehörigen Elektroinstallationen.
Kapitel 3 beleuchtet die Elektroinstallationen im Gebäude. Es werden sowohl konventionelle Elektroinstallationen als auch die Gebäudeautomation mit ihren verschiedenen Aspekten, wie Aufbau, Funktionsweise, Einsatzorten, Funktionen und Einsparpotentialen, behandelt.
Schlüsselwörter
Elektroinstallationen, Gebäudeautomation, Energieeffizienz, Kosteneinsparung, Leistungsbedarf, Energieverbrauch, technische Gebäudeausrüstung, Gewerke, Betrieb von Gebäuden, Elektrotechnik
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Elektrotechnik für moderne Gebäude essenziell?
Elektrotechnik bildet den Grundbaustein für Licht, Wärme, Sicherheit und die gesamte Automatisierung, ohne die ein moderner Gebäudebetrieb unvorstellbar wäre.
Was ist der Vorteil der Gebäudeautomation?
Gebäudeautomation trennt Energie- und Informationsversorgung, wodurch Geräte intelligent kommunizieren können, was zu mehr Komfort, Sicherheit und hoher Energieeffizienz führt.
Welche Einsparpotenziale bietet die intelligente Elektroinstallation?
Durch automatisierte Abläufe und bedarfsgerechte Steuerung (z.B. Beleuchtung und Heizung) können signifikante Energiekosten eingespart werden.
Was gehört zur konventionellen Elektroinstallation?
Dazu zählen im Wesentlichen Steckdosen, Schalter, Leuchten, der Sicherungskasten und der Hausanschluss.
Wie wird der Leistungsbedarf eines Gebäudes ermittelt?
Der Bedarf wird durch die Analyse der betriebsrelevanten Geräte, der zeitlichen Nutzungskomponente und gebäudeabhängiger Parameter berechnet.
- Quote paper
- Timm Jens Rotermund (Author), 2020, Die Rolle der elektrischen Energie beim Betrieb von Gebäuden. Betriebsrelevante Einsatzorte und Geräte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/976550