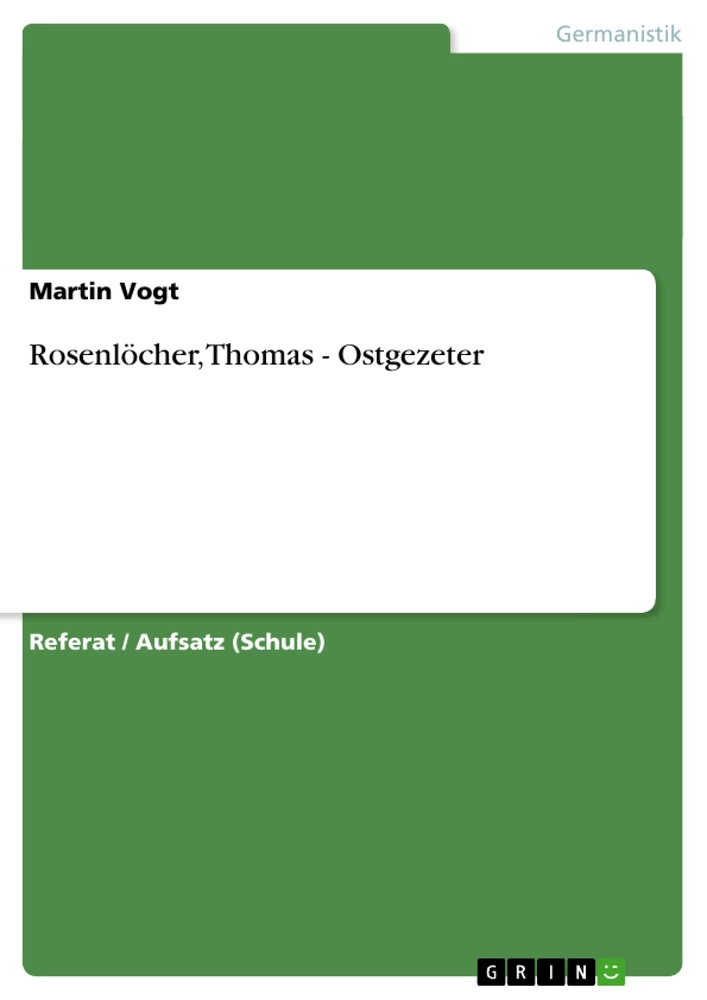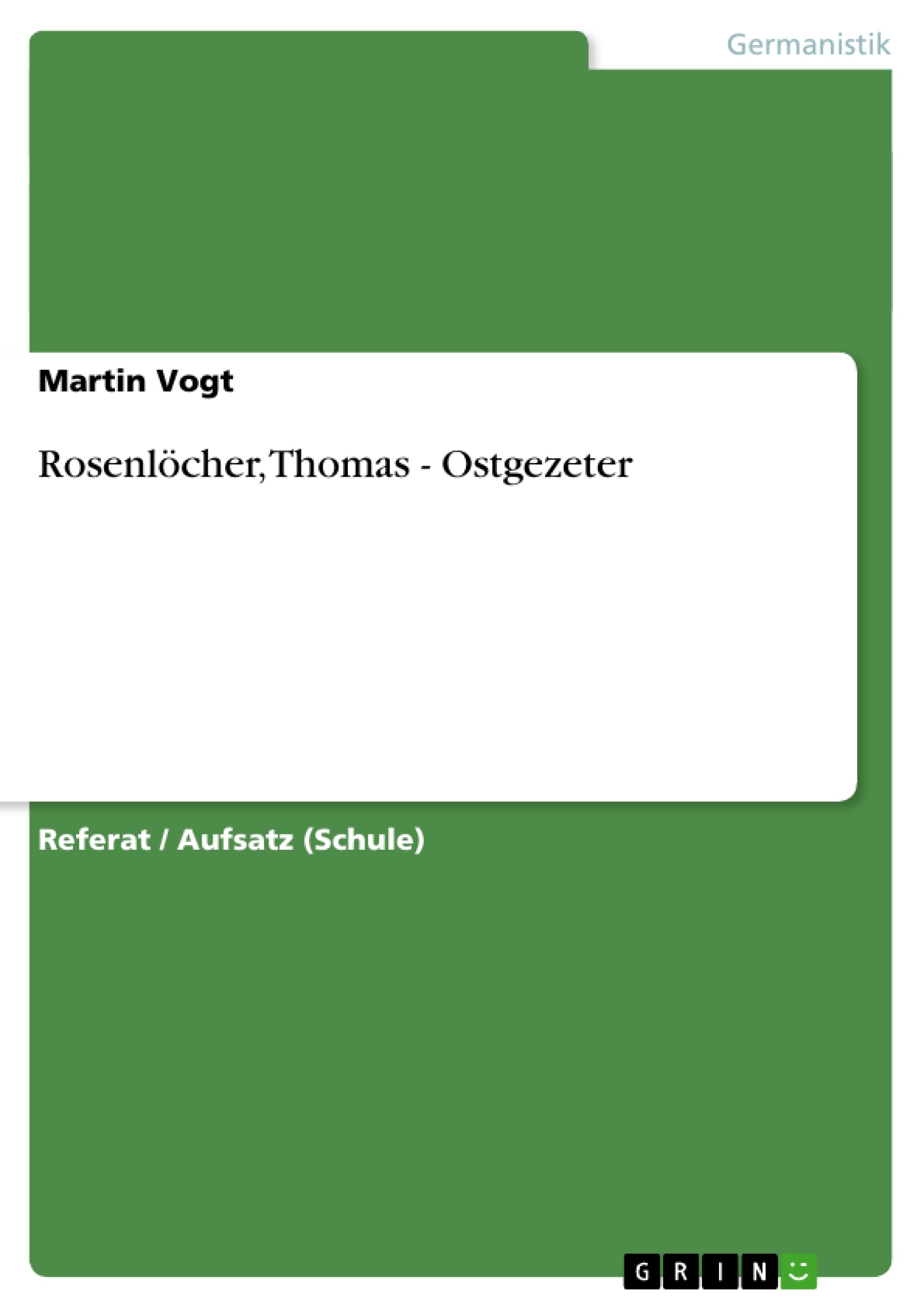Thomas Rosenlöcher ,,Ostgezeter"
Bibliographische Angaben
Das Buch ,,Ostgezeter" von Thomas Rosenlöcher ist 1997 in Frankfurt am Main beim
Suhrkamp Verlag erschienen. Es hat 190 Seiten, und ist in 5 Kapitel, welche noch weiter in Unterabschnitte aufgegliedert sind, eingeteilt. Es besitzt den Untertitel ,,Beiträge zur Schimpfkultur". Auf Seite 3 befindet sich ein Foto des Autors, auf Seite 2 eine kurze Einführung in den Inhalt des Buches.
Inhalt und Wertung
Ich betrachte das Buch als eine kritische Auseinandersetzung Thomas Rosenlöchers mit der Zeit, in der er den Großteil seines Lebens verbracht hat - der DDR. Er spiegelt seine Erinnerungen und Gedanken über diese Zeit und über die DDR in kleinen Geschichten wieder - welche unabhängig voneinander sind. Deshalb kann man dieses Buch auch nicht unter einem Roman einordnen - es ist eine kleine Sammlung oder Zusammenstellung von seinen Erlebnissen und Konfrontationen in und mit der DDR. Um dies zu widerlegen, gehe ich näher auf den Inhalt ein.
I. Kannitverstaan
Kannitverstaan. Dieses Wort stammt von einem Holländer, als er das erste mal die sächsische Sprache hört. Rosenlöcher nimmt die Probleme mit dem und durch den sächsischen Dialekt als Einstieg für sein Buch. Er bezeichnet sächsisch als Verlierersprache - und begründet dies u. a. mit der Geschicht Sachsens - in der es nicht immer als Sieger hervorging. Er erinnert sich an Worte wie: ,,Sprich anständig, Domas" oder ,,Das heißt nicht heeßt, das heeßt heißt!" und benennt Probleme, die aufgrund des Dialekts existieren. Zum Beispiel entdeckt er eine Zeitungsannonce, in der es heißt: ,,Sächsischer Dialekt in der freien Marktwirtschaft? Undenkbar! Nehmen Sie Sprechunterricht." Desweiteren beschreibt er sein verändertes Lebensgefühl, welches nach der Wende sehr plötzlich eingetreten ist. Als Beispiel nennt er das Gefühl beim Radfahren, bei dem der ,,Ossi" ständig damit beschäftigt ist nach links und rechts zu spähen, weil er nach dem Angebot in den Geschäften schaut. Der ,,Wessi" fährt statt dessen mit streng nach vorn Gerichtetem Blick und steifer Haltung die Straßen entlang.
Rosenlöcher bringt an, das ihm der Wechsel zu schnell ging, und das er sehr schnell in Vergessenheit geraten wird. Er merkt das am Beispiel der Ostfadennudelsuppe. Dieser spezifische Geschmack der einheitliche Nudelsuppe aus der DDR ist nach der Wenden nicht mehr zu finden. In einem anderen kurzen Abschnitt beschreibt er das ,,Gerenne" nach Bananen - der größten Rarität im Osten. Das Anstehen danach wird genauso beschrieben wie die Möglichkeiten, anderweitig an die heiß begehrte Ware heranzukommen. In einer wieder anderen Geschichte wird beschrieben, wie die Familie Rosenlöcher früher Westpakete bekam. Für Rosenlöcher hat der Westen einen ganz eigenen Geruch - sowohl die Westverwandten als auch die Sachen, die in den Paketen waren. Er beschreibt den Ablauf von Besuchen aus dem Westen, die er in Phasen gliedert: Ankunft, Begrüßung, Kaffetrinken und gegenseitiges schimpfen über den jeweils eigenen Staat. Zum Schluß dieses Kapitels zieht er das Fazit, daß im Allgemeinen immer weniger geschimpft wird - um so mehr freut er sich, als er einen ,,Ossi" an einem Zigarettenautomaten sieht: ,,Verdammter Griebel, du bist wie alle hier. Nehmen dust de, aber geben nischt!"
II. Dampfschiffnudeln
Im ersten Teil dieses Kapitels beschreibt er zuerst, wie man sich auf verschiedene Weise Dresden nähern kann. An dieser Stelle muß gesagt werden, daß das lyrische Ich in den Erzählungen mit der Person von Thomas Rosenlöcher gleichzusetzen ist. Er lebte in Kleinzschachwitz und beschreibt alle Details, wie zum Beispiel die Kneipe an der Kleinzschachwitzer Fähre, sehr genau. Doch zurück zum Buch. Er nennt seine Erlebnisse, sich mit verschiedenen Transportmitteln Dresden zu nähern: per Auto auf der Autobahn, mit dem Zug das Elbtal entlang, und mit den Dampfern der Weißen Flotte. Eine solche Dampferfahrt, nämlich von Meißen nach Dresden Zschachwitz, beschreibt er in diesem Kapitel näher. Die Beobachtungen, die er als Einheimischer an westdeutschen Touristen macht, sind besonders amüsant. Außerdem beschreibt er die Übergänge der Landschaften ineinander, und die Silhouette Dresdens. In im nächsten Abschnitt des Kapitels besucht Rosenlöcher das Leipziger Völkerschlachtdenkmal - welches er als das ,,Schreckensdenkmal" bezeichnet. Da er es als Kind schon einmal besucht hat, erinnert er sich bei diesem Besuch an die Eindrücke aus seiner Kindheit. Während seines Besuches dort finden gerade die jährlichen Gedenkfeiern statt, die an die Schlacht von 1813 erinnern - mit nachgestellten Kämpfen und Würstchenbuden. Der 3. Abschnitt befaßt sich mit einem Besuch des Spreewald. In einer Kneipe umgeben von Wasser ist der ,,Osten" noch besonders gut ,,erhalten". Seine Erlebnisse dort beschreibt er sehr anschaulich und humorvoll - wie zum Beispiel seine Irrfahrt in einem Mietpaddelboot. Der Titel ,,Die Spreewaldloreley" bezieht sich auf eine Fotografin, die auf einer Brücke steht und vorbeifahrende Kähne auf Zelluloid bannt. Im Letzten Abschnitt erzählt von einem Interview eines Fernsehsenders mit Thomas Rosenlöcher. Er wird früh von einem Kamerateam abgeholt, und sie entscheiden sich, das Interview nicht im Garten Rosenlöchers zu führen, weil der Aufschwung Ost in vollem Gange ist - in Form von Baggern, Kreissägen und Bohrhämmern. Also entscheiden sie sich ans Elbufer auszuweichen, wo Rosenlöcher über Dresden erzählt. Sie wechseln noch öfter die Schauplätze: nach Pillnitz, zum Blauen Wunder, in ein Café in der Neustadt und ins Stadtzentrum - an den Pirnaischen Platz und die Frauenkirche. Dort posiert Rosenlöcher vor einem echten Zeitzeugen der DDR - einem ,,Trabbi".
III. Der Nickmechanismus
Dieses Kapitel weicht von der bisherigen Form der Kapitel ab. Es ist diesmal in 69 numerierte Unterüberschriften gegliedert, in denen Rosenlöcher verschiedene Arten des Nickens - also des Kopf auf- und abbewegens - unterscheidet, gemischt mit ,,Gedankenblitzen", die kurze Erinnerungen an sein bisheriges Leben wiedergeben. Es wird deutlich, daß er bei diesen Gedankenbeschreibungen besonders auf Formen und Beispiele der Unterdrückung, und auf die eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten unter dem DDR-Regime aufmerksam machen möchte. Dies hat meiner Meinung nach den Grund, daß die DDR und alles was dazu gehört, einen tiefen Eindruck bei ihm hinterlassen hat, und ich denke er nutzt die Auseinandersetzung (beim Schreiben dieses Buches) als Aufarbeitung und Verwertung seiner Eindrücke. Möglicherweise ist für ihn auch das Mitteilen an nachfolgende Generationen - zu der auch ich gehöre - von großer Bedeutung.
IV. Schimpfprobe
Dieses Kapitel ist eine weitere Sammlung von kurzen, voneinander unabhängigen Erzählungen. Im ersten Abschnitt beantwortet er die Frage des Dreikäsehochs ,,Sind die Westdeutschen böse?" nach Erörterung einiger Beispiele (vor dem Leser, nicht vor Dreikäsehoch) mit ,,nur ein bißchen". Im 2. Abschnitt vergleicht er die Fahrt eines Westdeutschen in die DDR mit der Fahrt des Columbus seinerzeit nach Amerika. Auch hier merkt der Leser im allgemeinen, daß Rosenlöcher die ganze West-Ost-Thematik mit viel Witz und Humor betrachtet. Der 3. Abschnitt trägt den Namen ,,Schimpfprobe". Wieder einmal geht es ums Schimpfen: Zuerst, daß wegen Salat geschimpft wird - weil nie welcher da ist. Als nächstes ob überhaupt noch geschimpft wird - wenn ja, dann ohne Inhalt (natürlich nach Auffassung Rosenlöchers). Und zuletzt die Feststellung: wer im Westen zuviel schimpft muß zurück in den Osten - wahrscheinlich bei einem Besuch in Berlin-West. Der letzte Abschnitt erzählt von der Verträumtheit Rosenlöchers. Immer beim Heimwerken mit seiner Frau, bei dem er übrigens meistens 2 linke Hände hat, gerät er ins Träumen, wenn er zum Werkzeug holen in den Schuppen geht. In dieser Bretterbude kommen ihm immer Gedanken, wie er die Welt verbessern kann, und er philosophiert - solange, bis ihn seine Frau aus seinen Gedanken reißt, denn sie wartet ja auf das Werkzeug.
V. Die Straßenbahnfahrt
Das Erlebnis aus diesem Kapitel ist quasi das Synonym für den Osten. Er fährt mit der Straßenbahn, und beschreibt die Fahrgäste. Die Bahn bleibt stehen und der Fahrer geht mit seiner Tasche davon. Nach mehreren Stunden warten entschließen sich die Fahrgäste die Tür aufzudrücken. Doch - wie könnte es anders sein - sie klemmt. Es zieht Regen auf und es zieht Regen ab. Alle beobachten Den Sonnenuntergang. Langsam gehen in den Häusern die Lichter an. Viele schlafen ein. Mitten in der Nacht fährt die Bahn an - hinein ins Dunkel. Dieses Kapitel könnte eine Zusammenfassung des Buches, aber auch eine Zusammenfassung der DDR, so wie Rosenlöcher sie sieht, sein. Eben genau die Tatsache, das sehr wenig optimal im Staat funktioniert hat. Das der Bürger nicht gefragt wurde, daß er derjenige war, der einzustecken hatte. Ich denke diese Dinge will Thomas Rosenlöcher dem Leser vermitteln. Da er Teil dieses Systems war und in ihm aufgewachsen ist, ist es, so denke ich, schwer für ihn, das schnelle Ende dieser Epoche zu akzeptieren - was nicht heißen muß, das er Kommunist war (und es ihm deshalb schwerfällt).
Ich denke, daß dieses Buch ein sehr anspruchsvolles ist. Die besondere Aufgliederung und die Tatsache, daß die einzelnen Erzählungen voneinander unabhängige Inhalte enthalten, machen das Lesen dieses Werkes sehr kompliziert. Gefallen hat mir die Art, wie Thomas Rosenlöcher die DDR und alles was dazugehört (z.B. FDJ) beschreibt: mit Humor, und ein wenig distanziert. Außerdem habe ich viele neue Dinge über diese Zeit erfahren, die sonst nur in geschichtlichen Nachschlagewerken zu Finden sind, und die ich dort auch nicht gelesen hätte. Das Buch ist eine Vereinigung von Informationen über die DDR, von Ansichten Rosenlöchers über diese Zeit, und von der Schilderung authentischer Erlebnisse (aus der Sicht Rosenlöchers). Ermutigt dieses Buch zu Lesen hat mich der Gemeinsame Wohnort Zschachwitz von Herrn Rosenlöcher und mir. Es ist auch sehr hilfreich zu wissen, daß diese Erzählung nicht-fiktional, also wirklich ist. Dennoch - so interessant und informativ dieses Buch auch ist - ich würde es nicht für eine Aufnahme in den Lehrplan empfehlen. Als Hauptgrund würde ich den fehlenden Bezug der einzelnen Erzählungen untereinander angeben - was das Lesen sehr erschwert. Auch den Sinn der Erklärung der ganzen Nickarten in Kapitel III. kann ich nur teilweise, oder gar nicht nachvollziehen.
Klappentext
Da dieses Buch eine sehr eigene Gliederung besitzt und auch keiner besonderen literarischen Form zugeordnet werden kann, ist es unmöglich, den roten Faden des Buchs in einen Klappentext einzubinden. Dies wäre nur mit einer sehr allgemeinen Inhaltsangabe möglich. Da dies die eigentliche Aufgabe war, habe ich einen solchen Klappentext entworfen:
Ostgezeter - eine Auseinandersetzung Thomas Rosenlöchers mit dem Thema»Der Osten Deutschlands - in den Zeiten der DDR, und heute nach der Wende«. Der Autor erzählt in kurzen Erzählungen seine Erlebnisse mit der DDR, und seine Art, wie er heute mit dem Verschwinden dieser ganzen Epoche fertig wird. Er tippt mit Witz und Humor auf Probleme zwischen Ost und West, ohne dabei wirklich scharfe Kritik zuüben - zumal er ja selbst in der DDR aufwuchs. Ein etwas anderes Buch, für jeden empfehlenswert, der die DDR inähnlicher Weise erlebt hat, und für jeden, den diese Epoche interessiert.
Thomas Rosenlöcher, Ostgezeter[ein anderer Klappentext; Quelle: Internet]
»Bald werden wir es schwer haben, einander die DDR zu erklären« - ein fortgesetzer Erklärungsversuch, fröhlich und auf verlorenem Posten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ,,Ostgezeter" von Thomas Rosenlöcher?
,,Ostgezeter" ist ein Buch von Thomas Rosenlöcher, veröffentlicht 1997 im Suhrkamp Verlag. Es ist eine Sammlung von Beiträgen zur Schimpfkultur und eine kritische Auseinandersetzung des Autors mit der DDR-Zeit.
Welche bibliographischen Angaben sind zum Buch verfügbar?
Das Buch erschien 1997 im Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main. Es hat 190 Seiten und ist in 5 Kapitel unterteilt, die in weitere Unterabschnitte gegliedert sind. Es trägt den Untertitel ,,Beiträge zur Schimpfkultur".
Was ist der Inhalt von Kapitel I: Kannitverstaan?
In diesem Kapitel geht es um die Probleme mit dem sächsischen Dialekt und dessen Wahrnehmung. Rosenlöcher beschreibt auch das veränderte Lebensgefühl nach der Wende und Erinnerungen an die DDR, wie das Anstehen nach Bananen und Westpakete.
Was behandelt Kapitel II: Dampfschiffnudeln?
Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Annäherungen an Dresden und eine Dampferfahrt auf der Elbe. Es thematisiert auch einen Besuch des Völkerschlachtdenkmals in Leipzig und einen Ausflug in den Spreewald. Abschließend wird von einem Fernsehinterview mit Thomas Rosenlöcher über Dresden berichtet.
Was ist das Besondere an Kapitel III: Der Nickmechanismus?
Kapitel III weicht von den anderen Kapiteln ab. Es besteht aus 69 nummerierten Unterüberschriften, die verschiedene Arten des Nickens und "Gedankenblitze" über die DDR-Zeit beschreiben, wobei Unterdrückung und eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten thematisiert werden.
Welche Themen werden in Kapitel IV: Schimpfprobe behandelt?
Dieses Kapitel ist eine Sammlung kurzer Erzählungen. Es geht um die Frage, ob Westdeutsche "böse" sind, den Vergleich einer Reise in die DDR mit Columbus' Fahrt nach Amerika, und das Schimpfen an sich. Abschließend wird Rosenlöchers Verträumtheit beim Heimwerken thematisiert.
Was ist die Kernaussage von Kapitel V: Die Straßenbahnfahrt?
Dieses Kapitel beschreibt eine steckengebliebene Straßenbahnfahrt und symbolisiert damit die Probleme und Ineffizienzen in der DDR. Es fasst die Erfahrungen und Eindrücke Rosenlöchers von dieser Zeit zusammen.
Wie bewertet der Rezensent das Buch ,,Ostgezeter"?
Der Rezensent betrachtet das Buch als anspruchsvoll aufgrund der Aufgliederung und der unabhängigen Erzählungen. Er lobt Rosenlöchers humorvolle und distanzierte Art, die DDR zu beschreiben, empfiehlt es aber nicht für den Lehrplan aufgrund des fehlenden Zusammenhangs zwischen den einzelnen Erzählungen und der teilweise nicht nachvollziehbaren Erklärung der Nickarten.
Was besagt der Klappentext des Buches ,,Ostgezeter"?
Der entworfene Klappentext beschreibt das Buch als eine Auseinandersetzung mit dem Thema "Der Osten Deutschlands - in den Zeiten der DDR, und heute nach der Wende", in der Rosenlöcher seine Erlebnisse und den Umgang mit dem Verschwinden der DDR humorvoll schildert. Ein anderer Klappentext aus dem Internet betont den Erklärungsversuch der DDR und die regionale Vielstimmigkeit im geeinten Deutschland.
- Arbeit zitieren
- Martin Vogt (Autor:in), 2000, Rosenlöcher, Thomas - Ostgezeter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97726