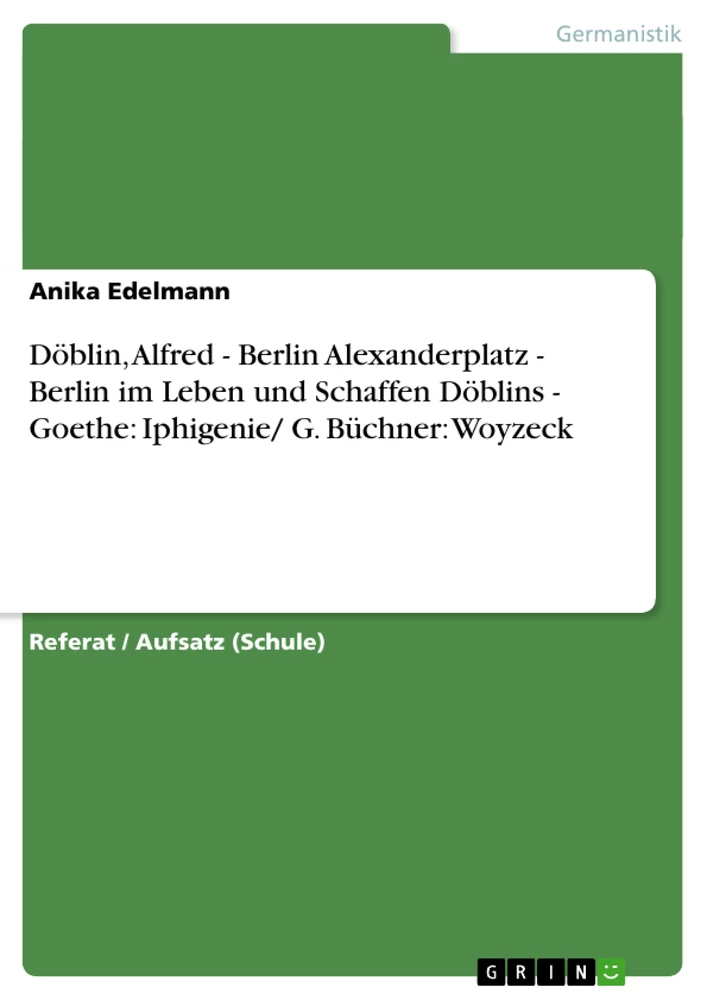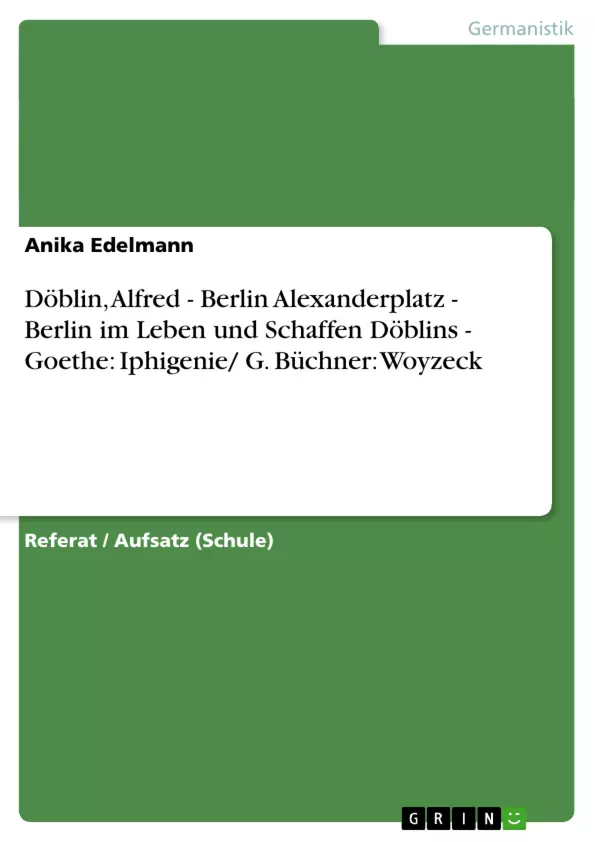Zusammenfassung von Anika Edelmann
Die Begegnung mit einer Stadt, einer Großstadt, kann sich auf viele Arten vollziehen. Solche Großstädte, die sich einer besonderen Berühmtheit erfreuen, begegnen uns oft in der Literatur. Städte wie Paris, Venedig oder Rom stehen als Kulisse bereit und haben oft genug den Dichtern als fertiges Bühnenbild ihrer agierenden Figuren gedient. Bestimmte Bilder und Vorstellungen von Großstädten wurden also oft entscheidend durch die Literatur geprägt. Dabei tritt die Stadt als Hintergrund oder auch als schicksalsweisende Größe auf. Das mächtige Paris prägt die Gesellschaft und gibt die Regeln vor. Als ein sehr bekannter Stadtroman gilt James Joyce` Ulysses. Der Roman Berlin Alexanderplatz von Alfred Döblin, erschien 1929 und von der Literaturgeschichte als bisher bedeutendster deutscher Stadtroman beschrieben, versetzt er uns ins Berlin der 20er Jahre.
Mehr als die Hälfte seines Lebens verbrachte Alfred Döblin in Berlin. Geboren wurde er jedoch in Stettin und erst ein schreckliches Kindheitserlebnis brachte ihn in diese Stadt. Sein Vater verließ die Familie wegen einer Geliebten und die nun Alleinerziehende Mutter von fünf Kindern war auf Almosen ihrer Verwandten angewiesen. Für Döblin bedeutete dies selbst einen sozialen Abstieg zugehörend zu Randgruppen und Außenseitern. Er verlor auch später nicht mehr diese Emotionen und hatte ein großes Bewußtsein für soziale Ungerechtigkeiten und Mißstände.
Später gelang ihm wieder der soziale Aufstieg. Doch sein Gefühl der Zugehörigkeit zu den niederen Ständen verlor er nicht. Dies spiegelt sich auch später in seinen Werken wieder. Als Leser findet man sich plötzlich auf dem von Menschen wimmelnden Alexanderplatz wieder- dem zentralen Ort der ganzen Handlung, an dem die von Verbrechen geschüttelte Geschichte des Protagonisten Franz Biberkopf vorbeizieht, aber auch eine Flut von einzelnen Sequenzen kurz auftauchender geschichtsloser Personen und ungeklärter Schicksale. Wie in einem Bienenstaat wird gearbeitet, gebaut, rennen Menschen in alle Himmelsrichtungen. Wer aus dem Rhythmus des mechanisch ablaufenden Getriebes der Massenbewegung herausgerät, kommt unter die Räder. Es entsteht der Eindruck, als untersuche Döblin ein Stück lebendes Fleisch, ein Stück berlinisches Fleisch, der Text, der daraus entsteht, lebt, atmet, stirbt, erwacht wie ein lebendiges Wesen. Der Leser- an die Stelle eines x-beliebigen Passanten versetzt- wird selbst zum Beobachter und erliegt dem Kunstgriff des Austors: dieser schaltet sich unmittelbar in den physiologischen Vorgang des Sehens ein. Das Bild, durch die Augenlinse auf die Netzhaut projiziert und vom Sehnerv weitergeleitet, gewinnt im Gehirn neue Gestalt. Von dort nimmt Döblin es noch unverarbeitet auf, um es direkt wiederzugeben. Schon während seiner Schulzeit verfasste er Texte in denen ein Flaneur durch die Berliner Strassen schlendert und seine Beobachtungen festhält "Modern. Ein Bild aus der Gegenwart". Und dies läßt bereits schon die Ansätze erkennen das geschäftige Treiben einer Großstadt einzufangen und es sprachlich zum Ausdruck zu bringen.
Das Thema Großstadt tritt in Döblins Frühwerken wie ,,Der schwarze Vorhang", "Die Ermordung einer Butterblume" und ,,Jagende Rosse" allerdings nur im Hintergrund auf.
Berlin selbst wird nur in wenigen Werken wie ,,die Nachtwandlerin" oder ,,Der Kaplan" zum Schauplatz öffentlichen Geschehens.
Döblins erster Berlin Roman ,,Wadzeks Kampf mit der Dampfturbine" entstand Mitte 1914 und dieses Werk gilt in mancherlei Hinsicht als Vorstufe zu Berlin Alexanderplatz indem er die Stadt lebendig werden lässt.
Was dem Roman selbst betrifft, so lag sein Erfolg wohl an der Bodenständigkeit des Themas, an dem für den Leser greifbaren Rahmen des Romangeschehens, was ihn von den anderen Werken Döblins unterschied. Diese hatten bis dahin in China, im Dreißigjährigen Krieg oder im mythischen Indien gespielt. Mit Berlin Alexanderplatz füllte Döblin treffend eine Lücke in der Literatur aus: Die Leser zollten Döblin große Anerkennung, nicht zuletzt deshalb, weil sie ihren Erfahrungsraum Stadt wiederentdeckten.
Döblins Bezug zum beschriebenen Milieu liegt auf der Hand: Im Berliner Osten aufgewachsen und als Nervenarzt eine Praxis in dieser Gegend führen, kannte er das harte Leben der Menschen- Wohnungsnot, kleine und größere Kriminalitäten. So wandte er sich im Alexanderplatz dem zu, was er täglich vor Augen hatte und nahm sich der Aufgen an, dies literarisch zu bewältigen:" Hier sah ich nun einen interessanten und noch nicht ausgeschriebenen Schlag von Menschen. Ich habe diesen Menschenschlag zu den verschiedensten Zeiten und in den verschiedensten Lagen beobachten können, und zwar in der Wiese, die die einzig wahre ist, nämlich in dem man mitlebt, mithandelt, mitleidet." Zur ersten Verfilmung bemerkte er kritisch, dass das Thema seines Romans nicht Franz Biberkopf und sein Schicksal sei, sonder der Alexanderplatz, das Leben in der Stadt und die Menschen. In seinem Essay ,,Großstadt und Großstädter" bringe Döblin seine Faszination für moderne ,,Riesenstädte" zum Ausdruck. Beeindruckt vom unaufhörlichen Erweiterungsprozeß und technischen Fortschritten der großen Metropolen, die alle ihren eigenen Charakter, ihre Geistesart verkörpern, erscheint es ihm weitaus schlimmer, dass Zehntausende von Landbewohnern noch nie eine moderne Fabrik betreten oder die versammelte Gewalt einer Häuserkolonne gesehen haben, als dass die Großstadtkinder noch nie einen Vogel haben singen hören. Sein Berlin beschreibt Döblin aber auch als Pandämonium und eigentlichen Gegenspieler des scheiternden Protagonisten Biberkopf. Ihm gelingt es nicht, den richtigen Weg durch das Labyrinth zu gehen, weil er immer wieder durch die falschen Begleiter heruntergezogen wird. Dennoch entwirft Döblin kein falsches Lebenskonzept des Individuums in der Großstadt: Angelehnt an biblische Leitmotive wie die Figur des Hiob und die Hure Babylon als Verkörperung des bedrohlichen Kapitalismus, macht er jeden Menschen zum Herren des eigenen Schicksals. Angesichts seiner ambivalenten Gefühle gegenüber dem Phänomen Großstadt stellt er diese als schrecklich anziehendes Monster in seiner ganzen faszinierenden Unergründlichkeit dar.
Was Franz Biberkopf betrifft, so gehört seine Geschichte sicherlich ins Berlin der 20er Jahre. Trotzdem, man denke daran, wieviele Biberköpfe wohl im heutigen Berlin wandeln mögen. Welche Worte hätte Döblin heute für die Riesenbaustelle Potsdamer Platz, die jährliche Techno- Tänzerinvasion einer Love- Parade oder die neue stilbewußte Café- Kultur im Osten der Stadt gefunden?
Goethe: Iphigenie/ G. Büchner: Woyzeck
1. Iphigenie stammt aus dem Geschlecht der Tantaliden, auf welchem ein Fluch der Götter liegt. Auch Iphigenies Familie wurde durch ein schreckliches Schicksal zerstört. Vor seinem Feldzug gegen Troja opfert der Vater sie Aulius. Diana entrückt sie jedoch in ihr Heiligtum bei dem Taurern, wo sie als Priesterin dient und Thaos den König der Taurer dazu veranlaßt, den uralten Brauch, jeden Fremden auf dem Altar der Diana zu opfern, abzuschaffen. Thaos der beabsichtigt Iphigenie zu heiraten ist durch die Ablehnung seines Antrags gekränkt und will das Fremdenopfer an zwei soeben an der Küste gelandeten Männern wieder vollziehen. Es handelt sich hierbei um den Bruder Iphigenies (Orest der sich aber zunächst nicht zu erkennen gibt) und dessen Freund Pylades. Von denen erfährt sie von den Bluttaten, die sich während ihrer Abwesenheit in ihrer Familie zugetragen haben: der Gattenmord und der Muttermord Orests, der seither von Erinnerungen verfolgt wird. Zur Sühne soll er "die Schwester" auf Tauris rauben. Bei Goethe ist die Weisung Apolls jedoch von delphischer Doppeldeutigkeit: ,,die Schwester" deutet Orest vordergründig als das Standbild der Diana (Apolls Schwester), da er nicht weiß dass seine eigene auf Tauris weilt. Im dritten Akt gibt sich Orest zu erkennen. Akzeptiert die Opferung als unausweichliche Folge des Fluchs und verfällt in einen Heilschlaf der ihn von seinen Erinnerungen befreit.
Iphigenie ist zunächst bereit mit den beiden zu fliehen. Sie erkennt aber bald in dem Vorhaben die Fortsetzung der alten Kette von Täuschung und Betrug, denn Thaos vertraut ihr. Im Konflikt zwischen Vertrauensbruch und Rettung des Bruders offenbart sie sich schließlich dem König, der durch ihren Appell an seine Humanität veranlaßt wird, die Heimfahrt zu gewähren.
In Woyzeck jedoch kommt es zu keinem Happy End. Die Enttäuschung von den politischen Realitäten, die Unfähigkeit an Gott zu glauben, und trotzdem in der Welt zu bestehen, prägen den tragischen Pessimismus in Büchners Werk. Er sieht den Menschen als eine Marionette, die von einem blinden Schicksal bewegt wird. Er erhofft sich eine Veränderung der als brutal empfundenen Wirklichkeit und bringt dies durch seinen passiven Helden zum Ausdruck. In diesem Werk stellt Büchner die menschliche Undurchschaubarkeit und Verzweiflung dar indem er den passiven Helden Woyzeck in seiner leidenden Abhängigkeit von Herkunft und Umwelt in Szene setzt. Seine eigene Umwelt hat ihn also letztendlich zu seinem Handeln gezwungen. Er ersticht seine Frau Marie die ihn verlassen hat als er sie außerhalb der Stadt antrifft. Woyzeck der im Wirtshaus versucht seine Tat zu vergessen spricht Käthe an, welche das Blut an seinen Händen entdeckt und er flieht. Die Tatwaffe wirft er in einen Teich. Beim Rückweg trifft er auf Maries Kind welches erschrocken davon läuft. Büchner veranschaulicht welchen inneren und äußeren Zwängen die arme doch gute Kreatur Woyzeck unterlag.
2.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.Woyzeck als Drama der offenen Bauform
Büchners Woyzeck gilt als Paradebeispiel für ein offenes Drama. Hier einige Eigenschaften des Werks, die es zu einem offenen Drama machen:
Gliederung
Die klassische Gliederung eines Dramas in Akte und Szenen fehlt bei Woyzeck. Die
Einzelszene ist bei ihm das primäre Bauelement, nicht etwa der einzelne Akt. Es gibt in dem Fragment keine Szenen, welchen man die Funktion der Exposition zuweisen könnte. Auch fehlt ihm ein Schlußteil. Auch die Handlung hält sich nicht an die Bauform eines klassischen Dramas: Sie ist zerstückelt in viele Einzelhandlungen, die sich nicht zu einer einzigen Haupthandlung zusammenfügen lassen.
Einheit der Zeit
Da die Szenen im Woyzeck nicht unmittelbar von einander abhängen, ja zum Teil sogar austauschbar sind, besteht keine Einheit der Zeit. Der Zeitpunkt der Einzelszene wie auch die Zeitabstände der Szenen untereinander spielen eher eine untergeordnete Rolle. Es besteht kein Verlangen nach einer raschen Szenenabfolge. Die Szenen sind vielmehr kurze Ausschnitte aus der Gesamthandlung, deren zeitliche Position im ganzen nicht zu bestimmen ist. Einheit des Ortes Die fehlende Einheit der Zeit bedingt fast das Fehlen der Einheit des Ortes. Büchner benutzt in seinem Werk- für ein Drama sehr atypisch- viele verschiedene Orte. Nur wenige benutzt er mehrmals (Maries Kammer, Wirtshaus, Waldweg).
Im Gegensatz zur Zeit hat aber der Ort eine wichtige Funktion im Drama. Der gewählte Ort gibt jeder Szene ihre eigene Atmosphäre: Maries kleine Kammer zeigt deren Ausgeschlossenheit von der Gesellschaft und das Freie Feld lässt Woyzeck das Unheimliche der Natur fühlen. Büchner spielt dabei auch mir der Größe des Raumes, wenn er zwischen Räumen der Intimität und solchen der Öffentlichkeit wechselt.
Auftretende Personen
Relativ zur Länge des Dramas hat Büchner viele Personen verwendet. Sie haben zwar alle einen gewissen Einfluss auf die Geschickte, doch sind sie fast alle ohne Identität. Sie haben keinen Namen und keine Vorgeschichte und treten meinst nur einmal auf. Sogar der Tamburmajor und Andres bleiben Personen Fragmente. Es gibt in diesem Stück außer Marie und Woyzeck keine Charakteren mit Tiefe, also auch keinen Gegenspieler für die Hauptfigur Woyzeck, wie es in den meisten Dramen der Fall ist. Büchner liegt mehr dran, durch die Fülle der Personen ein gesellschaftliches System aufzubauen.
Iphigenie als Drama der geschlossenen Bauform:
Goethes Iphigenie auf Tauris ist ein geschlossenes Drama. Das Gegenstück zum offenen Dramenaufbau.
Einheit der Zeit
In dem Drama kommt es zu einem kontinuierlichen Zeitfluß. Die Zeit ist eine Einheit. Einheit und Geschlossenheit des Raumes.
Eine sehr geringe Anzahl an auftretenden Personen, welche meist einen hohen gesellschaftlichen Stand besitzen (Iphigenie) und unabhängig von Umwelteinflüssen und Milieubedingungen sind.
4.Iphigenie gilt als das klassische deutsche Drama!
Iphigenie auf Tauris (1779)
Humanitätsdrama mit antikem Griechenland als Schauplatz, gilt neben Lessings »Nathan der Weise« als Muster des Humanitätsdramas Die Forderung des ,,Sturm und Drang", der Einzelne müsse sich in organischer Entwicklung zu einer harmonischen Individualität entfalten, greift die Klassik auf. Zugleich aber erkennt sie eine gesellschaftliche Ordnung an. Daher versucht sie harmonische Individualität und harmonisches Zusammenleben miteinander zu verbinden. Einerseits ist es dazu aber erforderlich, dass der einzelne Mensch nicht unterdrückt und verformt wird, andererseits aber auch, dass er Maß und Grenzen freiwillig anerkennt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema der Zusammenfassung von Anika Edelmann?
Die Zusammenfassung behandelt die Darstellung von Großstädten in der Literatur, insbesondere am Beispiel von Alfred Döblins Roman "Berlin Alexanderplatz". Sie analysiert, wie Städte als Kulisse, Schicksalsgeber oder Spiegel der Gesellschaft fungieren.
Welche Rolle spielt Berlin in Döblins Werk?
Berlin ist nicht nur Schauplatz, sondern auch ein zentrales Thema in Döblins Werk. Die Zusammenfassung hebt hervor, wie Döblin die Stadt als ein lebendiges, atmendes Wesen darstellt und die sozialen Ungerechtigkeiten und das Leben der Menschen in Berlin der 1920er Jahre einfängt.
Wie wird Franz Biberkopf im Kontext von Berlin dargestellt?
Franz Biberkopf wird als ein Individuum dargestellt, das in der Großstadt Berlin scheitert. Die Stadt wird als Labyrinth und Gegenspieler Biberkopfs beschrieben, der immer wieder durch falsche Begleiter heruntergezogen wird.
Was wird über Goethes "Iphigenie auf Tauris" gesagt?
Die Zusammenfassung stellt "Iphigenie auf Tauris" als ein Humanitätsdrama dar, das die Versöhnung von Individualität und gesellschaftlicher Ordnung thematisiert. Iphigenie wird als Beispiel für einen innerlich freien Menschen dargestellt, der in Harmonie von Körper und Geist lebt.
Was wird über Büchners "Woyzeck" gesagt?
"Woyzeck" wird als Gegenbeispiel zu "Iphigenie" dargestellt, als ein offenes Drama, das den tragischen Pessimismus und die menschliche Undurchschaubarkeit thematisiert. Woyzeck wird als Marionette des Schicksals dargestellt, dessen Handlungen durch seine Umwelt und soziale Umstände determiniert sind.
Was sind die Unterschiede zwischen einem offenen und einem geschlossenen Drama, wie sie in der Zusammenfassung anhand von "Woyzeck" und "Iphigenie" erläutert werden?
Ein offenes Drama, wie "Woyzeck", zeichnet sich durch eine fragmentierte Handlung, fehlende Einteilung in Akte und Szenen, viele verschiedene Orte und eine große Anzahl von Personen ohne tiefe Charakterentwicklung aus. Ein geschlossenes Drama, wie "Iphigenie", hingegen weist eine kontinuierliche Zeitabfolge, eine geringe Anzahl an auftretenden Personen und eine klare Struktur auf.
Welche Bedeutung hat der Humanitätsbegriff im Zusammenhang mit "Iphigenie"?
Die Zusammenfassung unterstreicht, dass "Iphigenie" als Muster eines Humanitätsdramas gilt. Die Klassik greift die Forderung des "Sturm und Drang" nach der Entfaltung einer harmonischen Individualität auf, erkennt aber gleichzeitig eine gesellschaftliche Ordnung an. Die Versöhnung von Individualität und harmonischem Zusammenleben steht im Vordergrund.
- Arbeit zitieren
- Anika Edelmann (Autor:in), 2000, Döblin, Alfred - Berlin Alexanderplatz - Berlin im Leben und Schaffen Döblins - Goethe: Iphigenie/ G. Büchner: Woyzeck , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97757