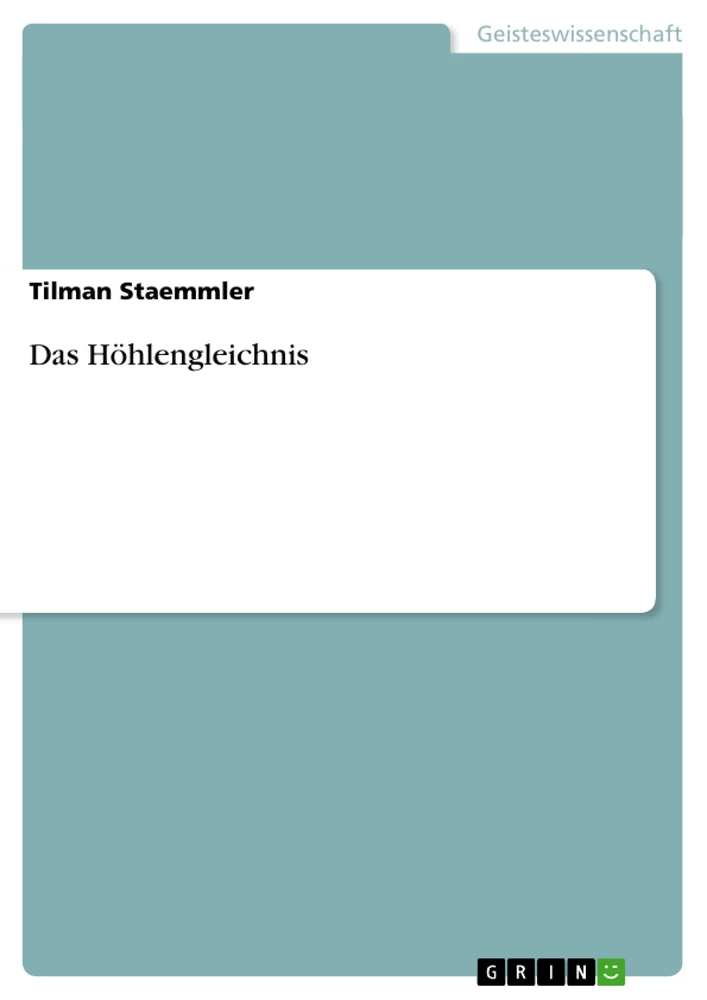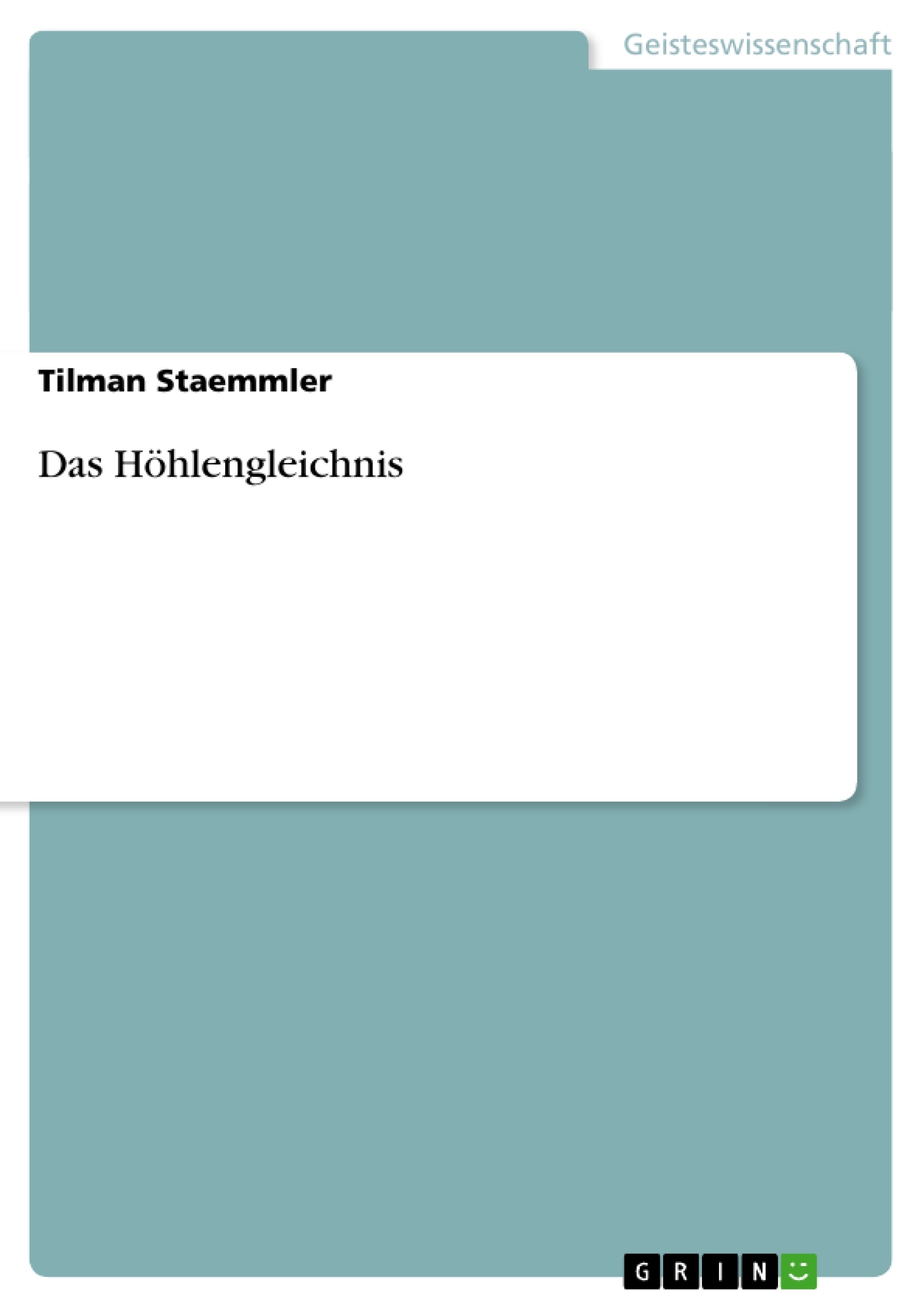1. Der Mythos von Orpheus
Als Heimatort des Orpheus gilt Thrakien. Manchmal wird auch Macedonien angegeben um ihn in der Nähe des Olymp wohnen zu lassen. Dies gilt durch „... the knowledge we are speaking of him as he was conceived to be by every normal Greek or Roman from the 5th century b.c. onwards.“1 Die Zeit in der er lebte soll einige Generationen vor Homer gelegen haben, andere zeugen von der Verwandtschaft zu Homer; was wenig verwundert, wird Orpheus doch als „... Father of Lays...“2 betrachtet.
Geboren wurde er von Kalliope, einer der Musen und Oiagros, einem thrakischen Flußgott. Auch hier gehen die Meinungen auseinander; manche Zeugnisse erwähnen Apollon als den Vater. Wo Orpheus geboren wurde ist nicht überliefert abgesehen von einer Stelle in den orphischen Argonautica: „... I entered the far-famed cave, where my mother conceived me on the bed of great-hearted Oiagros.“3 Im ganzen ist die Überlieferung zum Mythos Orpheus eher rar, die ausformulierten Stellen handeln vom „... death of Eurydike, and his jorney to the shades to fetch her, the slender tradition of a sojourn in Egypt, the voyage of the Argonauts, and the various accounts to the events which led to his death and the miraculous events which followed it.“4
Während der Argonautenfahrt soll er nach verschiedenen Überlieferungen die Argo, nachdem die Bemühungen der Besatzung fehlgeschlagen waren, mit seinen Liedern dazu gebracht haben, aus eige- ner Kraft ins Wasser zu gleiten. Die See soll er während eines Sturmes beruhigt und die ständig kolli- dierenden Felsen zum Stillstand gebracht haben - alles dies mit der Kraft seiner Musik. In den orphi- schen Argonautika ist er zudem eingeweiht in die Mysterien der Dioskuren und vollzieht priesterliche Opferhandlungen, unter anderen auch im Tainaron, wo sich der Eingang zum Hades befindet.
Durch diesen steigt er hinab in das Schattenreich, seine Frau Eurydike, die auf der Flucht vor Aristaeus von einer Schlange gebissen wurde und starb, wieder zurückzuholen. Durch seinen vom Spiel der Lyra begleiteten Gesang betört er Kerberos und die Eumenieden, das Rad Ixions steht still. Die Götter des Hades bewilligen ihm seine Bitte unter der Bedingung, daß er beim Aufstieg nicht zurückschauen, sich nicht nach Eurydike umsehen dürfe. Orpheus jedoch dreht sich herum und Eurydike verschwindet auf ewig im Schattenreich.
Darauf kehrt sich Orpheus von seinem bisherigen Glauben an Dionysos ab und wird zum Verehrer Apollons, den er allmorgendlich auf dem Berg Pangaion anbetet. Weiter wird berichtet, daß Orpheus sich nunmehr vom Verkehr mit Frauen fernhielt und zum Initiator der Knabenliebe wurde.5 Der Abstieg des Orpheus bezeichnet eine zentraler Stelle für den orphischen Mysterienglauben. Hier wird während des Mythos eine Unsterblichkeit der Seele eingeführt.6 Wichtiger als Eurydike ist nach Guthrie jedoch, daß Orpheus „... could tell his followers what the fate of their souls would be, and how they should behave to make it the best possible. He had shown himself capable of melting the hearts of the powers below, and might be expected to intercede again on their own behalf if they lived the pure life according to his precepts.“ Das Ergebnis des Abstiegs ist also, daß „... this purely personal errand magnified into a reason for knowing all about the realms of the dead and possessing peculiar powers as adviser and intercessor.“7 Das stellt den mystischen Charakter des orphischen Glaubens noch eher heraus als die versinnbildlichte Darstellung: „Most of them, however, like Polygnotes, show an Or- pheus who might well be supposed to be at home in the underworld, without the necissity of any con- jugal errand to account for his presence.“8
Gestorben sei Orpheus durch die Hände der Maenaden, der rasenden Frauen des Dionysos, die ihn in Stücke rissen. Dionysos habe diese aus Wut auf Orpheus gehetzt, weil dieser nun Apollon diente und nicht mehr ihm. Andere Gründe, die zum Tod des Orpheus durch die Maenaden führten sind zum einen die Angst der Frauen, er würde ihnen die Ehemänner abspenstig machen, also aus Eifersucht und zum anderen, daß er ihnen verweigerte, sie in seine Mysterien einzuweihen. Eine andere Überlieferung läßt Orpheus durch den Blitz des Göttervaters Zeus sterben, da er, ähnlich Prometheus, „...in his mysteries [...] taught men things unknown to them before.“9
Begraben wurde Orpheus in der Nähe Leibethras von seiner Mutter und ihren Schwestern, den übri- gen Musen in einer Höhle. Ein dionysisches Orakel soll das Ende der Stadt prophezeit haben, würden die Gebeine des Orpheus ans Tageslicht kommen. Irgendwann, die Gebeine wurden vom Tageslicht getroffen, wurde die Stadt durch Überschwemmung zerstört. Die Bewohner der Nachbarstadt Dion sammelten die Gebeine ein und bestatteten sie erneut. Die in der Antike bekanntere Version sagt, daß was von Orpheus übriggeblieben, darunter die mit einem Nagel am Kopfe befestigte Lyra, in den Fluß Hebros geworfen, noch immer singend, zur Insel Lesbos gelangte und dort von den Einwohnern be- stattet wurde. Auf dem Grab sei ein Tempel zu Ehren Dionysos erbaut, die Lyra aber im Tempel des Zeus aufbewahrt worden. Auf Lesbos, nach anderer Überlieferung, prophezeite der Kopf und lockte so die Kundschaft sämtlicher anderer Orakel zu sich, worauf Apollon persönlich den Kopf zum schwei- gen brachte. Anders die Version, der Kopf sei an der Mündung des Flusses Meles bei Smyrna an Land geholt und bestattet worden. Dort hätte er unter Ausschluß der Frauen göttliche Ehren erhalten.10
Was heute als Mythos bezeichnet wird muß für die Zeit, in der diese umliefen, als Religion betrachtet werden: „Any argument which implies that Orphism was a primitive form of religion is condemned to falsity from the outset.“11 Orpheus ist der Begründer einer Religion, die sich aus dem wilden Diony- soskult herausentwickelte. Orpheus selbst ist mit den Mysterien des Dionysos vertraut, sein Vater Oi- agros gab sie an ihn weiter. Dieser wiederum erhielt sie von seinem Vater, der von Dionysos persön- lich eingeweiht worden war. Die Religion des Orpheus war ein mit der griechischen Kultur zusammen weitverbreiteter Glaube und wurde zum Ende der hellenistischen Zeit von den Neuplatonikern gegen das Christentum als Argument genutzt. Aus den Zitaten der neuplatonischen Schriften weiß die For- schung von 3 Theogonien, die Orpheus zugeschrieben werden.12 Einheitlich, so Guthrie, wird ange- nommen, „... that the Neoplatonists read into the Orphic poems ideas which were their own, and had in reality nothing to do with Orphism.“13
2. Boethius Verwendung des Mythos
Innerhalb der Antike wurde der Mythos von Orpheus Abstieg in den Hades, der im Gedicht der Consolatio Philosophiae 14 als einziges Element der überlieferten Mythen verarbeitet wird, gedeutet auf (1) rationalistische Weise z.B. bei Pausanias. Für ihn gilt der Abstieg als Besuch im Nekyomanteion, „...der Verlust der Eurydike, den Orpheus selbst durch sein Zurückschauen verschuldet hat, [ist] nichts anderes als die ihn vernichtende Erkenntnis, getäuscht worden zu sein.“15 Fulgentius deutete den Mythos auf (2) allegorische Weise, „...indem er aus jedem Namen und aus jedem einzelnen Zug der Geschichte einen musikalischen Begriff herausinterpretiert.“16
Boethius Darstellung des Mythos vom Abstieg in den Hades beinhaltet 3 wesentliche Bestandteile:
(1) die Bezauberung der Natur wird erzählt in den Versen 8-13. Darauf folgt der Abstieg und die Be- zauberung der Unterweltgötter in den Versen 19-39 die kulminiert in dem Zugeständnis: „vincimur“. Orpheus bekommt Eurydike zurück, beginnt den Aufstieg und verliert Eurydike, nachdem er die Be- dingung, sich nicht umschauen zu dürfen, gebrochen hat in den Versen 40-51. Als Quellen für den Mythos, wie Boethius ihn verwendet sind zu erkennen: Simonides, Euripides, Aischylos, Apollonios Rhodos, Horaz, Vergil, Ovid und Homer. Eingeschlossen wird das Gedicht von interpretierenden Ver- sen, am Anfang Verse 1-4 und am Ende 52-58. Unvergleichlich, so Scheible, sei die Komposition des Gedichtes, die auf alle 3 Bestandteile gleichermaßen Gewicht legt, „...wie es ihm gelingt, die traditio- nellen Bestandteile der Orpheussage zu einem neuen, einheitlichen Ganzen zusammenzufügen.“17
Es muß Scheible zugestimmt werden, daß „Die Deutung, die Boethius gibt [...] die Orpheussage als Gleichnis [behandelt].“ Das Verständnis wird gegeben durch jene „... die Einleitungs- und Schlußverse ausfüllenden Motive [...]. Denn über den gemeinsamen Begriff des Lichtes tritt die leuchtende Quelle des Guten schon rein äußerlich in nächste Nähe zur konkreten Vorstellung des Tageslidirdischen Fesseln jedenfalls seit Platon mit dem Bild der dunklen Höhle verbunden sind (3-4 und 55-56).“18
3. Plotin
In platonischer Tradition also ist der Orpheusmythos bei Boethius zu verstehen. Am bedeutendsten weiterentwickelt hat das platonische Denken Plotin (203-270), wobei er durchaus als selbständig gelten muß. Bei ihm findet sich eine Art Anleitung zum glückseligen Leben, der die Lehre von den Hypostasen zu Grunde liegt. Diese Lehre teilt die Welt ein in:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Figur 1
Die Seele, hier die Weltseele, entäußert sich auch im Menschen, dieser ist also mit der Einzelseele der Weltseele teilhaftig. Nur ist das Spezifikum der Einzelseele, daß sie in einem materiellen Körper gefangen ist: der Mensch.
Durch die Unterscheidung von sinnlicher und intelligibler Welt und der Teilhaftigkeit des Menschen an beiden stehen zwei Wege offen: entweder kann der Mensch sich mit den sinnlichen Dingen befas- sen, was einem sich selbst nicht beherrschenden also fremdbestimmten Leben entspricht, oder er strebt nach Einigung mit dem Einen, an dem er teilhat durch die Unterordnung des Einzelnen in das Ganze, in dem alles, was Sein hat, aus dem selbst über allem Seienden Einen hervorgegangen, emaniert ist, ohne daß dieses dadurch geteilt oder sonst irgendwie verringert worden wäre. Diese zweite Möglich- keit zeigt die Einzelseele zum Einen strebend, indem sie die Ideen des Geistes schaut. Es ist der Weg zur Schau des Guten, Einen. „Voraussetzung einer solchen letzten Erfüllung ist die Befreiung [...] des Geistes aus allen irdischen Bindungen und beschwerenden Fesseln...“19, also ein tugendhaftes Leben.
Entsprechend sind den verschiedenen Sphären des Seins verschiedene Denkarten zugeteilt. Die Be- schäftigung der Seele mit der Natur, dem sinnlichen Bereich also, entspricht, relational zu den anderen Stufen, eine Befangenheit, aus der die Philosophie Boethius geleitet mittels eines diskursiven Den- kens.
Der Geist, als eigentliches Sein, schaut die Einzelideen, die selbst Geist und damit eigentliches Sein sind. Die vielen Einzelideen sind selbst Geist und sie sind in dem einen Geist. Da der Geist in sich nicht geteilt ist, ist der Geist Einheit und Vielheit zugleich. Daraus folgt, sind Denken und Gedachtes eines, daß der Geist sich selber denkt. Diese Reflexivität, zu der noch eine Verschiedenheit nötig ist, wird im Einen aufgehoben.
Dieses kann nicht mehr erkannt werden, ist es doch das Absoluteste, in dem alles stattfindet. Würde es erkannt werden, müßte eine Größe sein, die über das Eine hinaus, von diesem getrennt, dieses kategorisieren könnte. Dies aber widerspricht der Formlosigkeit des Einen. Das Eine ist also ein über allen Formen, in dem Sinne, daß es keine Form gibt, die über das Eine hinausgeht: das Eine ist die Form aller Formen ohne selbst Form zu sein. Der Mensch, die Einzelseele kann nur daran teilhaben, niemals jedoch denkend erfassen was das Eine ist.
Der Aufstieg der Seele besteht nun darin, sich mit diesem Schauen der Ideen zu beschäftigen, nach dem Einen zu streben. Aus dieser Perspektive gilt es nunmehr das Höhlengleichnis Platons zu betrach- ten.
4. Platon
Platon selbst erinnert seinen Leser im H ö hlengleichnis 20 daran, daß „Dieses ganze Bild nun [...] mit dem früher Gesagten...“21 verbunden und verglichen werden muß. Verbunden werden die drei Gleichnisse durch das Aufsteigen „...von den Seinsstufen über die Erkenntnisstufen bis hin zu [den] Stufen des Lebens.“22 Dem sei hier gefolgt und die beiden vor dem Bild der Höhle dargestellten Gleichnisse, das Sonnengleichnis 23 und das Liniengleichnis 24 kurz erläutert.
I. Das Sonnengleichnis:25
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Figur 2
Die zugrunde liegende Unterscheidung in diesem Gleichnis ist die zwischen sinnlicher, sichtbarer Welt und dem Reich der Ideen, dem ein eigenes Sein zugesprochen, dieses hier aber nur angedeutet wird. Der Bereich der Ideen ist gekennzeichnet dadurch, daß er einsehbar ist: „...von jenem vielen sagen wir, daß es gesehen werde, aber nicht gedacht; von den Ideen hingegen, daß sie gedacht werden, aber nicht gesehen.“26 Durch die Parallelität der beiden Bereiche wird mittels des sinnlichen Bereiches die Welt der Ideen veranschaulicht. Grundlegend für das Gleichnis ist wohl das Verhältnis von (1) GESICHT—LICHT—GESEHENES in der Entsprechung zu (2) GEIST—DAS GUTE—IDEE. Je- doch kann Platon „... trotz seiner strikten Trennung der beiden Bereiche [...] [kein] ontologischer Dua- lismus...“ angelastet werden, da auch die Sonne das Gute zu ihrem Ursprung hat.27 Demnach gibt es im Sonnengleichnis mehrere, durch die Idee des Guten miteinander verbundene Ebenen. Auf der A- Ebene werden, was durch Trennung erst möglich, sinnliche und intelligible Welt miteinander vergli- chen: „... so daß, wie jenes [das Gute] selbst in dem Gebiet des Denkbaren zu dem Denken und dem Gedachten sich verhält [Verhältnis 2] , so diese [die Sonne] in dem des Sichtbaren zu dem Gesicht und dem Gesehenen [Verhältnis 1].“28 Auf der B-Ebene wird die Parallelität innerhalb des Vergleiches aufgehoben, indem die Glieder der A-Ebene, als jeweils aus dem Guten hervorgegangen, insgesamt unter dieses subsumiert gedacht werden.
II. Das Liniengleichnis:29
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Leser wird aufgerufen, die Unterscheidung von sinnlicher, sichtbarer Welt und intelligibler Welt auch hier zu machen, es wird also die Lehre vom Sein aus dem Sonnengleichnis vorausgesetzt. Im sichtbaren Bereich wird nun als Ursprung der Spiegelbilder und Schatten (a) auf glatten Oberflächen der Bereich der Dinge (b) genannt. Entscheidend ist hier der Übergang vom Urbild zum Abbild, von
(d) zu (c) zu (b) zu (a). Aus diesem Verhältnis geht hervor, daß die sinnliche Welt nicht mehr allego- risch und parallel zur intelligiblen Welt gedacht wird; sie ist nunmehr ein Abbild der intelligiblen
Welt; (b) wird dem Bereich (c), dem Bereich des diskursiven, kategorisierenden Denkens untergeord- net, dieser wiederum dem Bereich der Ideen (d) als dessen Abbild.
Dieses stufenähnliche Aufsteigen von (a) zu (d) zeigt sich als ein Zunehmen der Qualität. Das jedem Abbild vorangehende Urbild repräsentiert im Übergang ein Zunehmen an Klarheit durch abnehmen des Verunreinigenden.
Die Vernunft durchdenkt die Vielheit der Dinge (b) auf ihr Gemeinsames (c) hin. Als Anschauungs- material werden diese Dinge auch angeführt, aber eigentlich gemeint sind sie nicht. Sie dienen als eine Art Vorführhilfe. Wesentlich charakterisiert ist dieser Bereich (c) durch Vorraussetzungen, die nicht weiter hinterfragt werden. Platon stellt fest, daß jenes, „... was vermittels der dialektischen Wissen- schaft von dem Seienden und Denkbaren geschaut [...] [wird], [...] deutlicher [...] [ist] als was von den gewöhnlich so genannten Wissenschaften, denen die Voraussetzungen Anfänge sind.“30 Rational dis- kursives Denken entspricht also einem Annehmen der Voraussetzungen, innerhalb derer die Gedan- kenoperation zu ihrem Ziel führt, es ist ein axiomatisches Denken, das nicht auf sich selbst reflektiert.
Im Bereich des Geistes (d) gelangt das Denken auf seine Spitze. Hier ist jede Art von Abbild verbannt oder hat nur noch die Funktion, überschritten zu werden. Innerhalb dieses Bereiches der Ideen bewegt sich das Denken also in reinen Begriffen, die nicht mehr durch sinnlich wahrgenommene Materie verunreinigt ist. Die kognitive Funktion ist die Dialektik, doch ist es kein eigentliches Denken von Ideen als vielmehr ein Schauen, ein teilhaftig werden.
Auch in diesem Gleichnis erscheinen mehrere differenzierbare Ebenen. Als A-Ebene kann die auch schon im Sonnengleichnis gemachte Unterscheidung zwischen sinnlicher und intelligibler Welt ge- nannt werden. Hier wären (a) und (b) sowie (c) und (d) zusammenzuzählen. Diese Voraussetzung verläßt Platon schnell und begibt sich auf die B-Ebene, auf der die vorliegenden Unterscheidungen gemacht sind. Hier wäre innerhalb des Gleichnisses ein Aspekt zu nennen, der das Verhältnis Abbild
(a) zu Urbild (b) wie Abbild (c) zu Urbild (d) bezeichnet. Dieses hebt sich im Folgenden sogleich auf, wenn die sinnliche Welt der Dinge als Abbild der ersten Stufe des Geistes dargestellt wird. Deutlich höher ist in diesem Gleichnis der Grad der Abstraktion im Vergleich zum Sonnengleichnis; wurden dort neben den Begriffen auch Bilder verwendet, sind die Bilder im Liniengleichnis bis auf die geometrische Figur verschwunden, und selbst dieses wird von Platon in Begriffen gegeben. Das Gleichnis vergleicht sich darum wohl auch dann am ehesten mit sich selbst, wenn der Gehalt for- mal und inhaltlich gleichgestaltet gegeben wird. Das Gleichnis fällt unter die für den Bereich (c) im Gleichnis gemachten Aussagen.
III. Das Höhlegleichnis
„Dieses ganze Bild nun [...] mußt du mit dem früher Gesagten verbinden, die durch das Gesicht uns erscheinende Region der Wohnung im Gefängnisse gleichsetzen und den Schein von dem Feuer darin der Kraft der Sonne; und wenn du nun das Hinaufsteigen und die Beschauung der oberen Dinge setzt als den Aufschwung der Seele in die Region der Erkenntnis, so wird dir nicht entgehen, was mein Glaube ist ... “31 Es wird also die Unterscheidung von sinnlicher und intelligibler Welt sowie die Un- terscheidung des jeweiligen Verhältnisses von Urbild und Abbild vorausgesetzt. Was aber fügt das Höhlengleichnis dem bisher gesagten noch hinzu? Nach Dietz ist allen drei Gleichnissen gemein der Aufschwung. Im Sonnengleichnis ist es also der Aufschwung oder die Steigerung von der sinnlichen Welt zur intelligiblen, im zweiten ist die Steigerung die vom Schein zum Wesen, wobei einem jeden folgenden ein höherer Grad an Wahrheit zugesprochen wird, und im Höhlengleichnis ist es, unter dem Thema der paideia, der Mensch oder um nicht die physische Beschaffenheit des Leibes zu kreuzen - der Aufschwung der Seele mit Rücksicht auf das einzelmenschliche Dasein.32
Innerhalb des Gleichnisses ist zwischen verschiedenen Stufen zu differenzieren. Der Sukzession fol- gend ist in der Höhle die erste Stufe jene, zu der die Menschen „... von Kindheit an gefesselt an Hals und Schenkeln [immer] [...] auf demselben Fleck bleiben und auch nur nach vorne hin sehen, den Kopf aber herumzudrehen [sie] der Fessel wegen nicht vermögend sind.33 Wie sich sogleich zeigt, handelt es sich um ein Betrachten von Dingen, die mit dem Begriff Schatten gezeichnet sind. Diese wahrzunehmen benötigt der Mensch seine Sinne, was sich am Begriff sehen deutlich zeigt. Wird diese Situation mit Sonnen- und Liniengleichnis im Gedächtnis verstanden, ergibt sich das Beschäftigen des Menschen mit Dingen, die im sinnlichen Bereich liegen und zudem noch die unterste Stufe des sinnli- chen Bereiches ausmachen. Begrifflich ergibt sich durch das Gefesseltsein nicht nur der Zwang die Dinge bzw. Schatten, also Abbilder, anzuschauen sondern auch ein Von-Ihnen-Besessen-Sein; ein Affekt im psychologischen Sinne des Wortes. Interessant scheint mir die (an dieser Stelle noch nicht verfehlte) bildliche Vorstellung der Menschen im gefesselten Zustand. Diese sind nicht nur nicht in der Lage, die Dinge selbst zu sehen; sie sind auch nicht befähigt von den Schatten ihrer selbst auf sich selbst zu schauen. Im Sinne des gnwJi seauton muß diese durch das in der Höhle auf die Leinwand des antiken Overheadprojektors Fixiertsein charakterisierte Stufe als verfehlt gelten.
Die zweite Stufe berichtet über die „...Lösung und Heilung von ihren Banden und ihrem Unverstan- de...“34 Wichtig ist, das hier ein kritisches Moment eingeräumt wird, welches sich ausdrückt in der „... M ö glichkeit (Hervorhebung von mir) [...], die vordem hinter ihnen vorbeigetragenen Dinge selbst zu sehen.“35 Diese Möglichkeit meint, sich als nunmehr erkennender Mensch den Dingen selbst zuzu- wenden oder, „...er werde ganz verwirrt sein und glauben, was er damals gesehen, sei doch wirkli- cher...“36 Der entfesselte Mensch aber ist geblendet vom Licht, welches die Lampe des antiken Over- headprojektors ausstrahlt, und das so stark, zumal er sich noch nicht von den Schmerzen des gefesselt Seins erholt hat, daß er eine weit größere Neigung zum Altgewohnten denn zum unsicheren Neuen auch wenn es, wie Heidegger sagt, alhJestera (das Entborgenere) ist, verspüren dürfte.
Dieses ist die Orpheussituation im Gedicht des Boethius, die er mit den Versen Wer zur H ö hle des Tartarus / Seine Blicke hinunter beugt, / Was er K ö stliches mit sich f ü hret, / Schwindet, sieht er die Schattenwelt. (Verse 55-58) zeichnet. Unter Berücksichtigung des Endes (Vers 51), daß Orpheus Eu- rydike verliert, ist hier also das sich zurückwenden zum Zustand der Gefesselten gemeint. Bleibt aber die Frage, warum der Orpheus des Boethius nicht siegt, warum er nicht, wie es die Überlieferung sagt, trotzdem er Eurydike verliert, an das Licht des Tages zurückgelangt. Werden die verschiedenen Meta- phern übertragen auf die des Höhlengleichnisses zeigt sich, wird der Aufschwung der Seele, was mehr als nahe liegt, als wesentlicher Gehalt vorausgesetzt, daß ein erreichen des Tageslichtes des boethi- schen Orpheus unmöglich ist. Mit dem Blick in die Höhle, dem Hinwenden zu den sinnlichen Dingen, bei Boethius Macht, Ehre, Ruhm, Reichtum, wird die Vernunft, die Ratio im pervertierten Sinne ge- braucht, geblendet durch den schönen Schein. Die Vernunft muß hier als untergeordnet betrachtet werden, was in diesem Sinne dem Begriff Affekt eine Umschreibung ist. Darum ist Orpheus „... in some sense a type of the fallen or descended soul, captivated by the lower, and failing to achieve as- cent towards the light of truth. Boethius‘ Orpheus is an Orph é e moralis é.“37
Damit ist ebenso deutlich, was die Stellung des Gedichtes im Buch betrifft. Zum einen ist allgemein die Rede vom Aufschwung der Seele. Zum anderen, so meine These, ist die gesamte Consolatio eine literarische Ausarbeitung des Höhlengleichnisses; mit dem Vorbehalt, daß dieses den Menschen in seinem Dasein meint. Dies mag auch interessant sein für die Frage, ob Boethius Consolatio unvollen- det ist oder, wird das Buch im erwähnten Sinne verstanden und erinnert, daß eben dieses Buch auch zu seinem eigenen Trost entstanden den Aufschwung der Seele selbst vollzieht. Dafür spricht auch die Anordnung der Bücher, der Gehalt, der sich, vom Selbstmitleid ausgehend, immer mehr zu einer me- taphysischen Spekulation entwickelt und dadurch formal die Freiheit der Vernunft darstellt.
Doch an der Stelle, da Orpheus metaphorisch den Affekten verfällt, ist das Höhlengleichnis noch nicht zu Ende, auch ist zum genaueren Verständnis der Stellung und der Verwendung des Gedichtes ein Blick auf den weiteren Verlauf der Situation zu werfen.
Auch wenn die Methode fragwürdig scheint - der Mensch, nunmehr gewaltsam ins Freie gebracht, erkennt „...die Dinge selbst [...] in der Bündigkeit und Verbindlichkeit ihres eigenen Aussehens.“38 Hier müssen nun wieder die vorangegangenen Gleichnisse erinnert sein. Der entfesselte Mensch be- findet sich jetzt außerhalb der Höhle, der Geist ist von seinen endlichen Fesseln befreit und schaut die Ideen. Dieser Zustand ist wieder ein Schritt zur Wahrheit, „...ist alhJesteron, noch unverborgener als die künstlich beleuchteten Dinge innerhalb der Höhle in ihrem Unterschied zu den Schatten.“39 Was hier geschaut wird ist das höchste für den Geist faßbare, ist ta alhJestata, das Unverborgens- te. Es sind die ewigen Ideen die der Geist schaut. Schaut er diese, so wird der Mensch, da am Tages- licht, also im Geiste mit den Ideen befasst, „...auch die Sonne selbst, nicht Bilder von ihr im Wasser oder anderwärts, sondern sie als sie selbst an ihrer eigenen Stelle anzusehen und zu betrachten im Stande sein. [...] Und dann wird er schon herausbringen von ihr, daß sie es ist, die alle Zeiten und Jah- re schafft und alles ordnet in dem sichtbaren Raume und auch von dem, was sie dort sahen, gewisser- maßen die Ursache ist.“40 Schaut der Mensch die Ideen, so ist er in nächster Nähe zur ‚Sonne‘. Diese hier erwähnte Sonne ist nicht zu vergleichen mit der aus dem Sonnengleichnis, vielmehr ist zu beach- ten, das die Seele mit dem Bereich der intelligiblen Welt befaßt ist. Durch das Bild der Sonne soll symbolisiert werden, was den Ideen zugrunde liegt, was die Idee der Ideen ist.
Nun ist der, welcher dem Reich der Ideen und dem diesem zur Ursache liegenden teilhaftig geworden ist, besinnlich und steigt in die Höhle hinab zu den Gefährten, die diesen Weg nicht gegangen sind. Dieser Abstieg ist nicht als Abfall der Seele zu betrachten sondern als die Notwendigkeit, irgendwo zu leben, zu schlafen, zu essen und zu trinken. Dies geschieht in Begleitung derer, die eine solche ‚Er- leuchtung‘ nicht erfahren haben. Was hier die Seele am Verweilen im Reich der Ideen hindert, ist ihre Verkörperung in der Endlichkeit. Es ist also von einer vierten Stufe zu sprechen, in der dieser Mensch zurückkehrt in das Reich des ‚Alltags‘. Hier kommt er kaum noch zurecht und ist eher mißgestimmt über das Verhalten derer, die ihrer Position entsprechend sich für die Repräsentanten der Wahrheit halten ohne von einer weiteren, über der ihren liegenden Wahrheit zu wissen oder eine solche auch nur für möglich zu halten.
Platon beendet das Bild mit einem sehr konkreten Beispiel für einen Menschen, der von der Wahrheit wußte und diese zu verwirklichen versuchte, daran aber scheiterte und, für Platon, zu einer Art Märtyrer der Wahrheit wurde: Sokrates, der ohngeachtet der Gefahren die scheinbare Welt hinter sich gelassen und die Menschen gemahnt hatte, diesen Weg der Erkenntnis zu gehen.
Innerhalb der Consolatio hat Boethius offenbar eine Möglichkeit gefunden, die durch Sinnentrug verblendete Seele zum Reich der Ideen zu führen, indem er den Weg des Erkennens, nicht ganz so gewaltsam wie es Platon fordert, nachzeichnet. Das Gedicht ist also pädagogisch sehr geschickt eingeschoben an einer Stelle, zu der die Überlegungen zum einen für den Rezipienten recht anstrengend werden, und zum anderen als eine Art ‚Erbauung‘ für Boethius selbst, um sich des rechten Weges zu versichern, zumal er in einer brisanteren Situation steckte als wir.
[...]
1 Guthrie, W.K.C., Orpheus And Greek Religion, A Study Of The Orphic Movement, London 1952 2, S. 26
2 Ebenda, S. 26
3 zitiert nach Ebenda, S. 27
4 Ebenda, S. 27
5 Vgl. Ziegler, Konrat, Orpheus, Pauly Band 35/1, S. 1287
6 Über griechischen Glauben und Seelenwanderung vgl. Alm, Bert, Ü ber die Seele, Münster 1996, S.42 ff.
7 Guthrie, Orpheus..., S. 29
8 Ebenda, S. 30
9 Ebenda, S. 32
10 Vgl. Ziegler, Orpheus, S.1294
11 Guthrie, Orpheus..., S. 128
12 Vgl. Ebenda, S. 69 ff.
13 Ebenda, S. 127
14 Boethius, Trost der Philosophie, übersetzt und hg. v. E. Gegenschatz u. O. Gigon, München 1991, S. 145 ff.
15 Scheible, Helga, Die Gedichte in der Consolatio Philosophiae des Boethius, Heidelberg 1972, S. 122
16 Ebenda, S. 122
17 Ebenda, S. 120
18 Ebenda, S. 122
19 Ebenda, S. 123
20 Platon, Politeia, in: Sämtliche Werke Band 2, übersetzt v. F. Schleiermacher, neu hg. v. U. Wolf, Reinbek bei Hamburg 1994, 514 a - 519 b
21 Ebenda, 517 b
22 Dietz, Karl-Martin, Metamorphosen des Geistes II, Das Erwachen des europ ä ischen Denkens, in: Beitr ä ge zur Bewusstseinsgeschichte, Band 5, Stuttgart 1989, S.154
23 Platon, Politeia, 507 b - 509 b
24 Ebenda, 509 d - 511 e
25 Figur nach: Dietz, Metamorphosen..., S. 116
26 Platon, Politeia, 507 b
27 Dietz, Metamorphosen..., S. 115
28 Platon, Politeia, 508 c
29 Figur nach: Ebenda, S. 132
30 Platon, Politeia, 511 c
31 Ebenda, 517 b
32 zum Begriff paideia vgl. Heidegger, Martin, Platons Lehre von der Wahrheit, Frankfurt a.M. 1997 4, S. 24 f.
33 Platon, Politeia, 514 a
34 Ebenda, 515 c
35 Heidegger, Platons Lehre..., S. 21 f.
36 Platon, Politeia, 515 d
37 O’Daly, Gerard James Patrick, The poetry of Boethius, London 1991, S. 191
38 Heidegger, Platons Lehre..., S. 23
39 Ebenda, S. 23
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Mythos von Orpheus?
Der Mythos von Orpheus erzählt von einem thrakischen Sänger und Lyriker, dessen Musik übernatürliche Kräfte besaß. Er stieg in die Unterwelt hinab, um seine verstorbene Frau Eurydike zurückzuholen, scheiterte aber an der Bedingung, sich beim Aufstieg nicht umzusehen.
Wer war Orpheus?
Orpheus war laut der Mythologie der Sohn der Muse Kalliope und entweder des Flussgottes Oiagros oder des Gottes Apollon. Er galt als Begründer einer religiösen Bewegung (Orphismus) und wurde oft als "Vater der Lieder" bezeichnet.
Welche Rolle spielte Orpheus bei der Argonautenfahrt?
Während der Argonautenfahrt soll Orpheus mit seiner Musik das Schiff Argo aus eigener Kraft ins Wasser gleiten lassen, Stürme beruhigt und Felsen zum Stillstand gebracht haben. Er war auch in Mysterien eingeweiht und vollzog priesterliche Handlungen.
Warum stieg Orpheus in die Unterwelt hinab?
Orpheus stieg in die Unterwelt hinab, um seine Frau Eurydike, die durch einen Schlangenbiss gestorben war, zurückzuholen. Er bezauberte die Unterweltgötter mit seiner Musik, erhielt Eurydike aber nur unter der Bedingung, sich beim Aufstieg nicht umzusehen. Als er sich umdrehte, verschwand Eurydike für immer im Schattenreich.
Wie starb Orpheus?
Es gibt verschiedene Versionen des Todes von Orpheus. Eine besagt, dass er von den Maenaden, den rasenden Anhängerinnen des Dionysos, zerrissen wurde, entweder aus Wut des Dionysos oder aus Eifersucht der Frauen. Eine andere Version besagt, dass er durch den Blitz des Zeus starb, weil er den Menschen in seinen Mysterien zuvor unbekannte Dinge lehrte.
Was geschah mit dem Leichnam von Orpheus?
Nach seinem Tod wurden die Überreste von Orpheus entweder in der Nähe von Leibethras bestattet oder, einer anderen Überlieferung zufolge, in den Fluss Hebros geworfen und gelangten nach Lesbos. Sein Kopf, an dem die Lyra befestigt war, soll noch gesungen haben.
Was ist der Orphismus?
Der Orphismus war eine religiöse Bewegung, die sich aus dem Dionysoskult entwickelte und Orpheus als ihren Begründer verehrte. Der Orphismus beinhaltete den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele.
Wie nutzte Boethius den Mythos von Orpheus?
Boethius verwendete den Mythos von Orpheus' Abstieg in die Unterwelt in seinem Werk "Consolatio Philosophiae" (Trost der Philosophie) als Gleichnis für die Suche nach dem Guten und die Gefahren, sich dem Irdischen zuzuwenden.
Welche Bedeutung hat der Mythos von Orpheus bei Plotin?
Plotin verwendete den Mythos nicht direkt, aber seine Philosophie, die eine Anleitung zum glückseligen Leben durch die Lehre von den Hypostasen beinhaltet, bietet einen Rahmen für das Verständnis des Aufstiegs und Abstiegs der Seele, was im Kontext des Orpheusmythos relevant ist.
Wie wird das Höhlengleichnis von Platon im Bezug zum Mythos von Orpheus gesehen?
Das Höhlengleichnis von Platon wird als eine Darstellung des Aufstiegs der Seele aus der Dunkelheit der Unwissenheit zum Licht der Erkenntnis betrachtet. Der Absturz des Orpheus wird als das Versagen der Seele verstanden, die Wahrheit zu erreichen.
- Quote paper
- Tilman Staemmler (Author), 1998, Das Höhlengleichnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97781