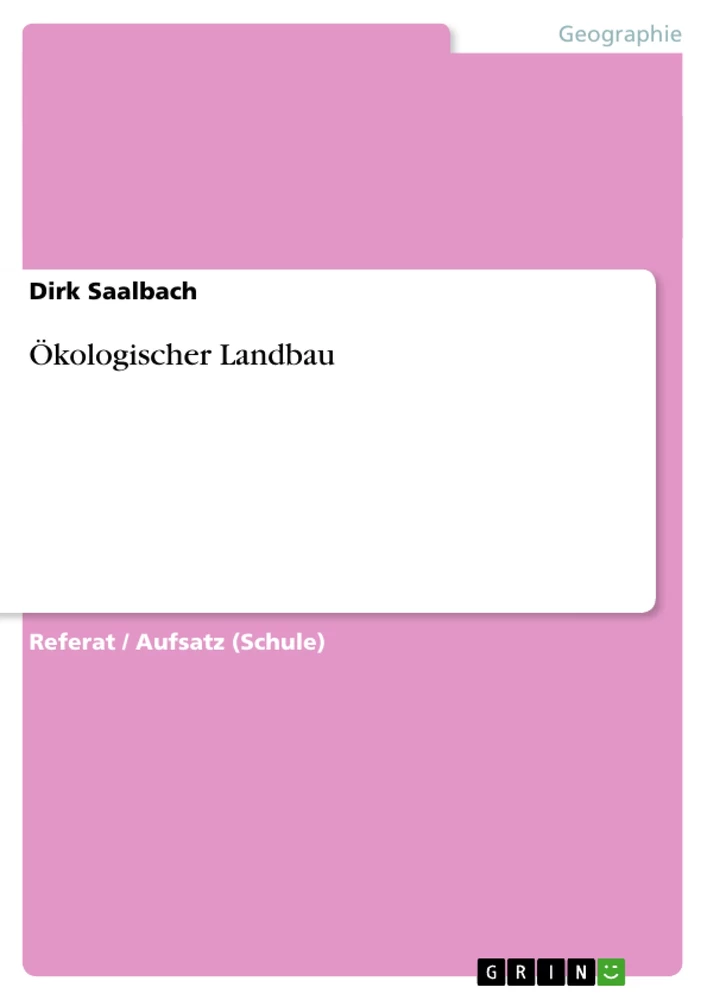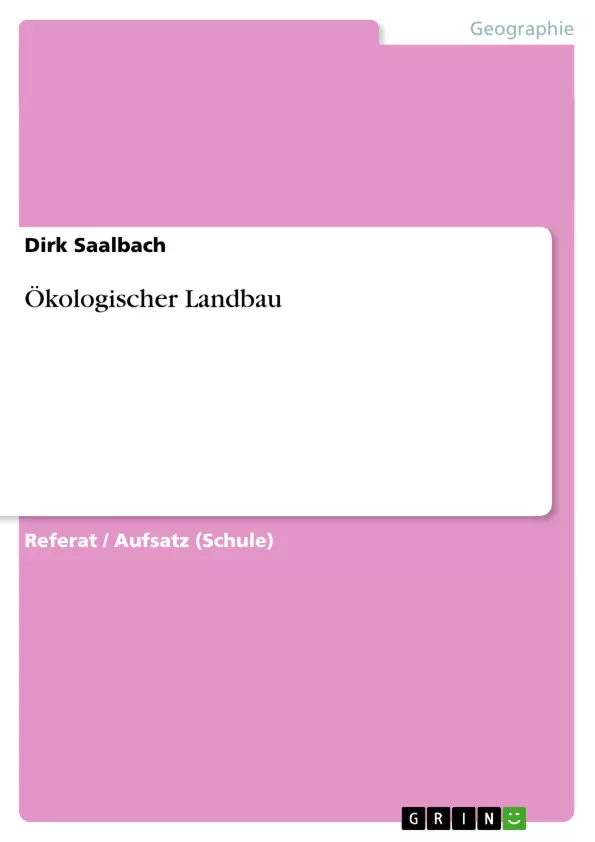1. Definition:
- seit 1942
- nach verbindlichen Richtlinien arbeitende Gruppen von Landwirten und Gärtnern, die ganz ohne mineralische Düngemittel und chemische Pflanzenschutzmittel wirtschaften
- EU-Verordnung regelt die Grundregeln für Ökologischen Landbau und Tierhaltung
- erfreut sich steigender Beliebtheit, zumal die Nachfrage nach deren (teureren, weil höherer Arbeitseinsatz nötig) ,,Öko-Produkten"
2. Ziele:
- einen möglichst geschlossenen betrieblichen Nährstoffkreislauf erreichen
- Futter- und Nährstoffgrundlage soll der eigene Betrieb sein
- die Bodenfruchtbarkeit erhalten und mehren
- Tiere besonders artgemäß halten
- Förderung bewährter Kultursorten und Zuchtrassen, besonders im Bezug auf Schädlingsresistenz und Tiergesundheit
3. Maßnahmen:
- kein Pflanzenschutz mit chemisch-synthetischen Mitteln, Anbau wenig anfälliger Sorten in geeigneten Fruchtfolgen, Einsatz von Nützlingen, mechanische Unkraut- Bekämpfungsmaßnahmen (Hacken und Abflammen)
- keine Verwendung leicht löslicher mineralischer Düngemittel, Ausbringen von organisch gebundenem Stickstoff in Form von Mist oder Mistkompost, Grunddüngung durch Stickstoff sammelnde Pflanzen (Leguminosen) und Einsatz langsam wirkender natürlicher Düngestoffe
- Pflege der Bodenfruchtbarkeit durch ausgeprägte Humuswirtschaft
- abwechslungsreiche, weite Fruchtfolgen mit vielen Fruchtfolgegliedern und Zwischenfrüchten
- keine Verwendung chemisch-synthetischer Wachstumsregulatoren oder Hormone
- begrenzter, streng an die Fläche gebundener Viehbesatz
- Fütterung der Tiere möglichst mit hofeigenem Futter, wenig Zukauf von Futtermitteln, keine Futterzusatzstoffe, Anwendung geeigneter Zuchtmethoden
- Mist - großflächige Anwendung, wenig Gülle
4. Voraussetzungen für Expansion des Öko-Landbaus
- ökol. Bewußtsein und entsprechendes Kaufverhalten der Verbraucher
- großes Engagement von Lebensmittelketten und potenten Verarbeitungsunternehmen
- flächendeckendes Angebot von Öko-Erzeugnissen und durch Reduzierung von
Distributionsgebühren geringere und damit nachfragestimulierende Verbraucherpreise
- staatliche Förderung der Erzeugung und Vermarktung
- effiziente Organisation der berufsständischen Vertretung und ihre Kooperationsfähigkeit mit Wirtschaftspartnern
- ideelle Unterstützung durch Politik, Institutionen und Personen des öffentlichen Lebens
- einheitliches und unverwechselbares Erscheinungsbild der Öko-Produkte, unterstützt durch ein einheitliches Öko-Zeichen
5. Auswirkungen auf Umwelt Bodenschutz
- Förderung von Humusbildung und Bodenleben
- Feldern und Wiesen der Ökobauern - Biomasse, mikrobiologische Aktivität höher als im konventionellen Landbau, natürl. Bodenfruchtbarkeit steigt an
- Krumenverluste durch Erosion werden weitgehend vermieden. Gewässerschutz
- Belastung des Grund- und Oberflächenwassers mit Nährstoffen (z. B. Nitrate) geringer
- Verzicht auf chemisch-synthetische Mittel schließt Kontaminationen mit Pflanzenschutzmitteln aus
- da Viehhaltung an Fläche gebunden, fallen meist nicht mehr Nährstoffe durch Mist und Gülle an, als den Pflanzen auf den hofeigenen Flächen problemlos zugeführt werden kann
Artenschutz
- Förderung der Vielfalt des Tier- und Pflanzenlebens durch Verzicht auf chemischsynthetische Pflanzenschutzmittel und das niedrige Düngeniveau
- häufig mehr Arten als auf den konventionell bewirtschafteten Flächen.
6. Situation in Deutschland
- relativ starke Position (Skandinavien, Griechenland und Österreich wirtschaften mehr ökologischer Landbau)
- Deutschland hat zweitgrößten Öko-Flächenanteil in der EU
- 1998 Umsatz ,,Öko-Produkte" 4 Mrd. DM (2% des Gesamtumsatzes von Lebensmitteln)
- 1/3 der ,,Öko-Produkte" in Lebensmittelmärkten verkauft,2/3 direkt ab Hof, Naturkostfachgeschäfte
- Österreich-70%, Dänemark-90%, Großbritannien-67% in Lebensmittelmärkten
- 1998 rund. 9.200 Betriebe auf 416.500 ha = 1,8 % der Betriebe auf etwa 2,4 % der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche
- 1997 ca. 8200 Betriebe (+12,6 %) auf 26.800 ha (+6,9 %)
- Organisation dieser Betriebe in Verbänden (Dachverband = Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau mit den Verbände Demeter-Bund, Bioland, Naturland, Biokreis Ostbayern, Arbeitsgemeinschaft Naturnaher Obst- und Gemüsebau (ANOG), Bundesverband Ökologischer Weinbau (BÖW), Gäa, Ökosiegel und Biopar
- Richtlinien der AGÖL-Verbände strenger als die EG-Öko-Verordnung:
- mindestens 95 % der Zutaten aus ökologischem Anbau stammen (EG-Öko-Verordnung) schon bei 70 %
- EG-Öko-Verordnung teilweise Umstellung eines Betriebes auf ökologischen Landbau
- bei den AGÖL-Mitgliedsverbänden Umstellung immer den gesamten Betrieb notwendig
- seit 1999: Ökozeichen, um Vermarktung und Handel von Öko-Produkten zu verbessern der
- seit Juni 1999: Öko-Prüfzeichen GmbH macht das Zeichen bekannt und unterstützt damit die Vermarktung gekennzeichneter Produkte in Zusammenarbeit mit dem Handel
7. Vor- und Nachteile
Nachteile:
- geringeres Ertragsniveau
- höherer Arbeits- und Zeitaufwand
- höheres Risiko für die Marktqualität
- höhere Verkaufspreise
- nährstoffanspruchsvolle und pflanzenschutzintensive Kulturen (z.B.: Mais, Zuckerrüben, Sonderkulturen wie Kern- und Steinobst, Wein, Hopfen) nicht oder nur im geringerem Umfang angebaut werden
- setzt ökol. Bewusstsein bei Käufern vorraus
Vorteile:
- umweltverträglich
- schont die Ressourcen und trägt zur Entlastung der Agrarmärkte bei Überschusserzeugnissen bei
8. Vergleich von ökologischem und konventionellen Landbau im Bezug auf:
a)Preise
- alternativ erzeugte Produkt teuerer
- 100 l Milch ökologisch: 79 DM konventionell: 62 DM
- Doppelzentner Weizen ökologisch: 98 DM konventionell: 41 DM
- Doppelzentner Kartoffeln ökologisch: 52 DM konventionell: 20 DM
- Jahreseinkommen je Familienarbeitskraft: ökologisch: 26025 DM konventionell: 23487 DM
b)Aufwand
- Düngemittel (DM je ha): ökologisch: 31 DM konventionell: 261 DM
- Pflanzenschutz (DM je ha) ökologisch: 2 DM konventionell: 65 DM
- Futtermittel (DM je ha) ökologisch: 420 DM konventionell: 600 DM
c)Erträge
- Milch (l je Kuh) ökologisch: 3714 konventionell: 4373
- Weizen (Doppelzentner je ha) ökologisch: 37 konventionell: 54
- Kartoffeln (Doppelzentner je ha) ökologisch: 190 konventionell: 282
9. Förderung des ökologischen Landbaus
- Einstieg schwierig, da erst nach Umstellungszeit von zwei bis drei Jahren Öko-Ware verkaufen dürfen
- erst nach mindestens zwölf Monaten in Umstellung dürfen die Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs als Umstellungsware vermarktet werden
- in Deutschland seit1989 Umstellung auf ÖL mit öffentlichen Mitteln gefördert
- bis 1992 geschah dies in einer Variante des Extensivierungsprogramms der EU - im gesamten Betrieb keine Mineraldünger und Pflanzenschutzmittel, Tierhaltung den Grundregeln des ökologischen Landbaus entsprechen
- Förderungsdauer - 5 Jahre
- Finanzierung teilen sich die EU, Bund und Länder
- Alte Bundesländer EU trägt 50 %, in neuen Ländern 75 %
- nationalen Anteil zahlt entweder das jeweilige Bundesland allein oder er gemeinsam von Bund und Ländern (Verhältnis von 60 : 40)
- 1997 130 Millionen DM unterstützt, Forschung auf diesem Gebiet in den Bundesforschungsanstalten und Universitäten gefördert
- Vermarktung wird vom Staat ebenfalls unterstützt
- 1997 ca. 129 Mio Förderungen (EU-, Bund-, Ländermittel)
- 15.800 DM für jeden geförderten Betrieb bzw. 330 DM / ha
- in Österreich über 600 DM / ha bei Umstellung und Beibehaltung
Quellen:
- Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (AGÖL)
- Stiftung Ökologie und Landbau (SÖL)
Häufig gestellte Fragen
Was ist ökologischer Landbau?
Ökologischer Landbau ist eine seit 1942 praktizierte Form der Landwirtschaft, bei der Gruppen von Landwirten und Gärtnern nach verbindlichen Richtlinien wirtschaften, ohne mineralische Düngemittel und chemische Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Die EU-Verordnung regelt die Grundregeln für ökologischen Landbau und Tierhaltung.
Welche Ziele verfolgt der ökologische Landbau?
Die Ziele umfassen unter anderem:
- Einen möglichst geschlossenen betrieblichen Nährstoffkreislauf zu erreichen.
- Die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und zu mehren.
- Tiere besonders artgemäß zu halten.
- Förderung bewährter Kultursorten und Zuchtrassen, besonders im Bezug auf Schädlingsresistenz und Tiergesundheit.
Welche Maßnahmen werden im ökologischen Landbau angewendet?
Es werden verschiedene Maßnahmen eingesetzt, wie:
- Kein Pflanzenschutz mit chemisch-synthetischen Mitteln.
- Keine Verwendung leicht löslicher mineralischer Düngemittel.
- Pflege der Bodenfruchtbarkeit durch ausgeprägte Humuswirtschaft.
- Abwechslungsreiche, weite Fruchtfolgen.
- Begrenzter Viehbesatz.
- Fütterung der Tiere möglichst mit hofeigenem Futter.
Welche Voraussetzungen sind für die Expansion des Öko-Landbaus notwendig?
Dazu gehören:
- Ökologisches Bewusstsein und entsprechendes Kaufverhalten der Verbraucher.
- Großes Engagement von Lebensmittelketten und Verarbeitungsunternehmen.
- Flächendeckendes Angebot von Öko-Erzeugnissen.
- Staatliche Förderung der Erzeugung und Vermarktung.
- Effiziente Organisation der berufsständischen Vertretung.
- Einheitliches Erscheinungsbild der Öko-Produkte.
Welche Auswirkungen hat der ökologische Landbau auf die Umwelt und den Bodenschutz?
Der ökologische Landbau fördert Humusbildung und Bodenleben, vermeidet Krumenverluste durch Erosion, reduziert die Belastung des Grund- und Oberflächenwassers und fördert die Vielfalt des Tier- und Pflanzenlebens.
Wie ist die Situation des ökologischen Landbaus in Deutschland?
Deutschland hat einen relativ starken Markt, aber andere Länder sind stärker auf ökologischen Landbau ausgerichtet. Es gibt eine Vielzahl von Betrieben, die in Verbänden organisiert sind, deren Richtlinien oft strenger sind als die EG-Öko-Verordnung.
Welche Vor- und Nachteile hat der ökologische Landbau?
Nachteile sind geringere Erträge, höherer Arbeitsaufwand, höhere Verkaufspreise und die Notwendigkeit eines ökologischen Bewusstseins bei den Käufern. Vorteile sind Umweltverträglichkeit, Ressourcenschonung und die Entlastung der Agrarmärkte.
Wie schneidet der ökologische Landbau im Vergleich zum konventionellen Landbau ab?
Ökologische Produkte sind in der Regel teurer, aber der Aufwand für Düngemittel und Pflanzenschutz ist geringer. Die Erträge sind jedoch auch geringer.
Wie wird der ökologische Landbau gefördert?
Der Umstieg auf ökologischen Landbau wird durch öffentliche Mittel gefördert. Die Finanzierung teilen sich die EU, der Bund und die Länder. Auch Forschung und Vermarktung werden staatlich unterstützt.
Wo kann ich weitere Informationen zum ökologischen Landbau finden?
Informationen erhalten Sie bei der Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (AGÖL), der Stiftung Ökologie und Landbau (SÖL) und der Öko-Prüfzeichen GmbH.
- Citar trabajo
- Dirk Saalbach (Autor), 2000, Ökologischer Landbau, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97786