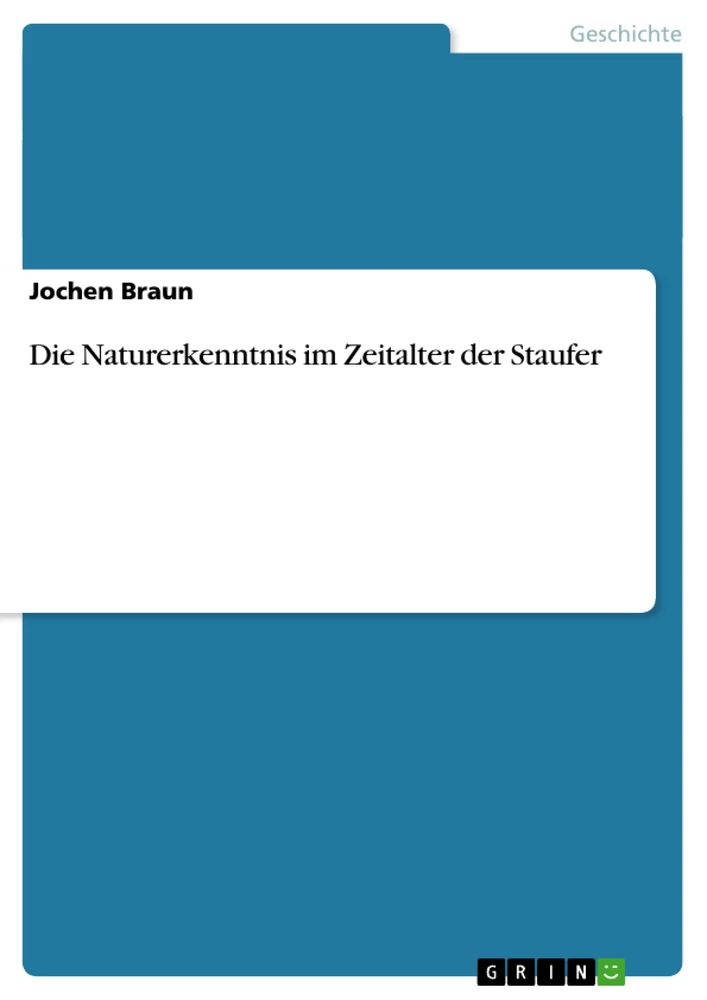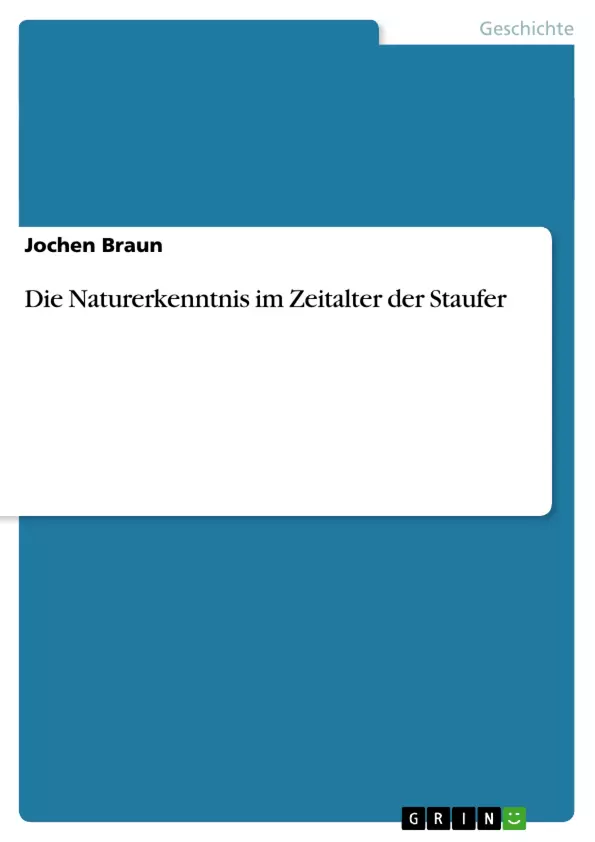I. Der Stellenwert der Naturwissenschaften
Mit entscheidend für das Weltbild und somit auch für das Handeln von Menschen in Politik und Gesellschaft sind auch immer die Erkenntnisse der Naturwissenschaften. Daher hängen Naturwissenschaftliche Sichtweisen und Modelle auch mit Geschichte, auch mit der der Stau- ferzeit zusammen - sie können weitere Erklärungen für das damalige Denken und Handeln liefern.
Heute herrscht ein pluralistisches Weltbild vor, jeder kann und darf innerhalb gewisser Grenzen denken was er möchte und sich sein eigenes Weltbild mehr oder weniger zusammen- stellen. Man kann dabei für sich einzelne Ansichten und auch Naturwissenschaftliche Er- kenntnisse annehmen oder ablehnen. Deshalb sind neue Erkenntnisse auch nicht von der Tragweite für das vorherrschende Weltbild als sie es teilweise zu früheren Zeiten waren.
Im Gegensatz dazu, bestand zur Stauferzeit und auch später noch ein gewisser Druck, einen Konsens in der Weltanschauung herzustellen. Die enge Verknüpfung Naturwissenschaftlicher Erklärungsmodelle mit den Ansichten über Gesellschaft und Gesellschaftsordnung war jedoch nicht absichtlich von den Mächtigen oder den Forschern herbeigeführt. Sie versuchten nicht Bewußt darauf Einfluß zu nehmen, weil sie dadurch ihre Position erhalten oder ideologisch stärken wollten, es war mehr Teil des Selbstverständnisses der damaligen Zeit.
Anfangs des 12. Jahrhunderts herrschte unter den Naturwissenschaftlern eine Art Aufbruchsstimmung. Es hat sich die Meinung durchgesetzt, daß „ständige und wiederholte Fragen“ der „erste Schlüssel der Weisheit“ seien. Für Adelard von Bath stand der eigene Verstand im Vordergrund und die Autorität älterer, etablierter Wissenschaftler sollte nur im Zweifelsfalle hinzugezogen werden - Ziel war es, die Ding so zu sehen, „wie sie sind“.
Der Charakter der Forschungen bestand darin, sich ein Erklärungsmodell für die Welt und der darin ablaufenden Vorgänge zurechtzulegen, daher auch der wichtige Stellenwert der Fragen. Das Ergebnis der Forschungen waren daher auch nicht in erster Linie neue Erfindungen und Techniken, sondern neue Anschauungsmodelle oder Erklärungen.
Die Erkenntnisse waren aber nicht das Ergebnis völlig wertfreier Betrachtungen. Wie bei der näheren Beschreibung von Naturerkenntnis bzw. Naturverständnis noch deutlich wird, kann man die Tendenz der Forscher erkennen, das herrschende Selbstverständnis der Menschen und das Verständnis von Gesellschaft mit den, in der Natur beobachteten Phänomenen in Einklang zu bringen. Man nahm das bereits Bekannte als Ausgangspunkt um die Natur darin einzuordnen. Bekannt waren die soziale Ordnung und religiöse Ansichten.
Das mit den Erkenntnissen der verbundene Weltbild war aber immer auch an die Religion gekoppelt. Bei all ihren Überlegungen versuchten die Wissenschaftler immer auch die Erkenntnisse in Bezug mit der Religion zu setzen. Eine wichtige Frage war immer: „Welche Rolle spielt Gott innerhalb des Erklärungsmodells?“. Ihn völlig außen vor zu lassen kam nach dem damaligen Verständnis nicht in Frage.
II. Regionale und Zeitliche Einordnung
Zur Zeit der Staufer gab es zwei Strömungen in der Naturwissenschaft, die sich ein wenig unterschieden, sich jedoch nicht generell widersprachen, sie folgten auch zeitlich aufeinander. Der Hauptsächliche Unterschied zwischen beiden Lehren bestand in der Ursache oder dem Anlaß von Bewegungen, doch dazu später mehr.
Die erste Strömung war während der frühen Stauferzeit vorherrschend. Vertreter dieser Richtung waren Adelard von Bath, Thierry von Chartres, Wilhelm von Conches, Bernhardus Silvestris, Urso von Salerno und aus Deutschland Hildegard von Bingen. Sie orientierten sich auch an den Lehren Platos.
Die zweite Strömung, vertreten von Robert Grosseteste, Wilhelm von Auvergne, Thomas von Aquin, Siger von Brabant und Albertus Magnus, setzte sich gegen Ende der Stauferzeit durch und berief sich auf die Lehren von Aristoteles. Eine Ursache für die Verbindung beider Lehren mit den antiken Wissenschaftlern war wohl das vermehrte Aufkommen und Bekannt- werden von Übersetzungen ihrer Werke in dieser Zeit. Der Einsatz der Erkenntnisse der anti- ken Forscher war dann auch gemäß dessen, war Adeladt von Bath propagierte. Deren Werke wurden häufig nur zur Untermauerung eigener Ansichten herangezogen wo sie diesen entge- genstanden wurde das ignoriert.
Bemerkenswert ist auch die Herkunft der Wissenschaftler. Abgesehen von Hildegard von Bingen und Albertus Magnus1 stammen sie alle aus England, Frankreich und Italien. Deut- sche Wissenschaftler beschäftigten sich hauptsächlich mit Geschichte, dabei verwendeten Die Naturerkenntnis im Zeitalter der Staufer 3 Jochen Braun diese aber für die dort ablaufenden Prozesse dieselben Erklärungsmuster wie die Naturwissenschaftler bei ihren Modellen der Natur.
Eine weitere Neuerung der Zeit war die beginnende Trennung der Naturwissenschaften Biologie und Physik von der Medizin. Im Folgenden wird die besondere Verknüpfung der Physik und dem vorherrschenden Weltbild besonders beleuchtet, es wird aber auch deutlich, daß die verschiedenen Forschungsdisziplinen noch nicht stark voneinander isoliert sind.
III. Grundlagen der naturwissenschaftlichen Weltanschauung zur Zeit der Staufer
1. Gegenstand der Forschungen in der Physik
Die Gelehrten der Stauferzeit beschäftigten sich auf dem Sektor der Physik hauptsächlich mit Bewegungen. Wofür sie sich interessierten unterschied sich aber von dem, was später Newton und Gallilei beschäftigte. Nicht die Geschwindigkeit einer Bewegung, oder ob sie gleichför- mig oder beschleunigt war stand im Mittelpunkt des Interesses: die Forscher beider Lehren interessierten sich in erster Linie für die (vertikale) Bewegungsrichtung, also ob sie nach oben oder unten verlief und für die Art der Bewegung - war sie geradlinig, rund oder kreisförmig?
Die Vorgehensweise der Forscher beruhte auf Beobachtung von Bewegungen und Vorgängen in der Natur. Diese Vorgänge versuchte man sich dann modellhaft zu erklären.
2. Die Grundlagen der Betrachtungen von Bewegungen
Beide Sichtweisen gehen von denselben Grundannahmen aus, die nun kurz dargelegt werden sollen. In vorstaufischer Zeit, beispielsweise noch zur Zeit der Ottonen ging man im europäischen Raum davon aus, daß Gott für jede einzelne Bewegung direkt verantwortlich sei - er schob gewissermaßen alles an und war überall direkt beteiligt.
Nun setzte sich aber mehr und mehr die Ansicht durch, die Bewegungen beruhten auf Kräften, die sich innerhalb der Körper selbst befänden. Das heißt nicht, daß Gott hier keine Rolle spielt. Gott hat ja alles erschaffen und ist somit auch für die Kräfte verantwortlich.
a. Die Elementenlehre
® Die Zusammensetzung
Man ging davon aus, daß die Gesamte stoffliche Schöpfung, also die unbelebte (Erde, Steine…) und die belebte Natur (Pflanzen, Lebewesen) aus Substanzen bestünde. Alle faßbaren Dinge in der Natur bezeichnete man als Körper. Verantwortlich für deren Eigenschaften im Bezug auf ihre Bewegungen machte man besondere Substanzen, die Teil eines jeden Körpers waren, die Elemente. Sie wurden als die Kräfte angesehen, die für die charakteristischen Bewegungen der Körper verantwortlich waren. Sie sollten die Bewegungen hervorrufen und auch deren Richtung bestimmen.
® Die Eigenschaften der Elemente
Als Elemente sah man Feuer, Luft, Wasser und Erde an. Die Eigenschaften, die die jeweiligen Elemente dem Körper verliehen, wurden abgeleitet von den realen Eigenschaften von Feuer, Luft, Wasser und Erde. Leichtigkeit wurde Feuer und Luft zugeschrieben, für Schwere machte man Wasser und Erde verantwortlich - das waren die sogenannten substantiellen Qualitäten. Nach der Beobachtung des Verhaltes eines Körpers erfolgte die Zuordnung der substanziellen Qualitäten, dann der Rückschluß auf die möglicherweise darin enthaltenen Anteile der einzelnen Elemente (halbquantitativ).
Viele Phänomene ließen sich allein aufgrund der substantiellen Qualitäten alleine aber nicht erklären. Man schrieb den Elementen daher auch noch weitere Eigenschaften zu und ging wiederum von den realen Eigenschaften von Feuer, Luft, Wasser und Erde aus. Feuer ist ja nicht nur leicht, sondern unter anderem auch warm, beweglich, hell und rein. Diese erweiter- ten Eigenschaften nannte man akzidentielle Qualitäten. Man ging davon aus, daß sie sich, wie die substantiellen Qualitäten der Elemente, ebenfalls auf den Körper auswirken würden, der einen Anteil der Elemente enthielt.
Damit erweiterte sich die Anzahl der mit diesem Modell erklärbaren Vorgänge beträchtlich und schloß auch komplexere Vorgänge ein. In dieser Hinsicht ist vor allem Urso von Salerno zu nennen, er erklärte beispielsweise den Hunger von Lebewesen mit einem Anteil der Elemente Feuer und Erde - durch Wärme und Trockenheit wird die Nahrung „angezogen“. Als generelles Gesetz für alle Beobachtungen und Bewertungen galt:
Gleiche/ähnliche Wirkung è gleiche/ähnliche Zusammensetzung
b. Die Ordnung der Körper
® Räumliche Anordnung
Dem damaligen Verständnis entsprach es wohl, daß es immer eine gewisse Ordnung geben müsse. Nachdem man die Eigenschaften der Elemente und deren Auswirkungen auf die Kör- per isoliert betrachtet hatte ist der logisch nächste Schritt, diese Eigenschaften auch im Blick auf die räumliche Anordnung der Körper heranzuziehen. Für die vertikale Anordnung ist die Übertragung recht einfach: Wie es auch dem damaligen geozentrischen Weltbild und auch den bereits festgestellten Elementeigenschaften entspricht ist das Element Erde im Zentrum des Weltalls (unten) angesiedelt, und das Feuer am Rand (oben). Die Elemente waren also auch verantwortlich für die räumliche Anordnung oder Konfiguration der Körper:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
® Die „Seelen“ und ihr Stellenwert innerhalb des Erklärungsmodells
Beobachtet man aber nun Lebewesen wie etwa Tiere oder Menschen, so haben sie häufig keine erkennbare bevorzugte Bewegungsrichtung. Sie können sich nach oben oder unten, vorwärts oder rückwärts, gerade oder kreisförmig bewegen. Will man innerhalb des beschriebenen Erklärungsmusters mit den Elementeigenschaften auch bei der Erklärung dieser Bewegungen bleiben, muß nun eine weitere Komponente in die Vorstellung einfließen.
Die Forscher machten für das Phänomen besondere Substanzen verantwortlich, die sie See- len nannten. Nach ihren Vorstellungen waren Seelen ein Teil des Körpers, der ausschließlich aus Elementen zusammengesetzt war. Ihm war es möglich, den restlichen, ebenfalls Elemente enthaltenden Körper in alle Richtungen zu bewegen.
® Die Ordnung der Körper untereinander
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Hier deutet sich bereits bei der Beschreibung der Seelen eine Hierarchie der Substanzen an: einige scheinen stärker als andere und somit war es den Stärkeren möglich die (substantiellen und akzidentiellen) Eigenschaften der Schwächeren zu „unterdrücken“ bzw. diese zu „über- stimmen“.
Man ging davon aus, daß alle Substanzen miteinander in einer Art Wettkampf stünden. Jede versuchte dabei „ihre“ Bewegungsrichtung durchzusetzen.
Den Elementen wurde auch die Eigenschaft zugeschrieben, auseinanderzustreben. Hierfür könnte man die substantiellen Eigenschaften, die auch für die Anordnung der Körper im Raum sorgen verantwortlich machen. Die Seelen hingegen wirkten dem entgegen. Ihnen sollte die Neigung zu eigen sein, das Auseinanderstreben der Elemente und den damit verbundenen Zerfall aufzuhalten, diese also in die (bestehende) harmonische Ordnung gegen deren „Wunsch“ zu zwingen, indem sie deren Widerstand überwanden.
® Gleichheit
Als gleich oder ähnlich sah man Körper an, die eine gleiche oder ähnliche Zusammensetzung aufwiesen, also auch ähnliche Eigenschaften. Man war auch der Ansicht, daß Gleiches sich anzieht und Ungleiches sich abstößt.
c. Warum bewegen sich Körpe r ? Teil 1
Die Beantwortung dieser Fragestellung unterscheidet beide naturwissenschaftliche Strömungen voneinander. Nach dem bisher beschriebenen Naturverständnis, das dem der Vertreter der ersten Lehre aus der frühen Stauferzeit (zur Zeit Friedrich Barbarossas) entspricht, gibt es für Bewegungen immer eine Ursache, die die Bewegung auslöst bzw. dafür Verantwortlich ist. Die Ursache hängt mit den jeweiligen Eigenschaften der Körper zusammen, sie kommt aus den im Körper enthaltenen Kräften:
Elemente und Seelen versuchen sich gegeneinander durchzusetzen und den Körper in „ih- re“ Bewegungsrichtung zu bringen. Das Ergebnis dieser Auseinandersetzung hängt mit den jeweiligen Eigenschaften der Substanzen zusammen und steht daher nicht generell fest, es kann aber anhand der Eigenschaften abgeschätzt werden.
3. Erweiterung der Ansichten durch die Vertreter der neueren Lehre
Von dem dargestellten Modell gingen die nachfolgenden Gelehrten aus, gaben ihm aber eine weitere Dimension, die erneut die Anzahl der damit zu erklärenden Phänomene erhöhte und außerdem teilweise eine andere Erklärung und andere Schlußfolgerungen mit sich brachte. Die Bestandteile des vorigen Modells, wie etwa die Zusammensetzung der Körper aus Sub- stanzen und Elementen, werden nicht nochmals dargestellt, alle Änderungen oder Erweite- rungen hingegen schon.
a. Warum bewegen sich Körper? Teil 2
Neben den Eigenschaften von Elementen und Seelen als ursächliche Kraft, die am Ausgangspunkt der Bewegung wirkte hatten die Vertreter der neuen Richtung den Endpunkt von Vorgängen im Blick. Beobachtet man die Natur unter diesem Gesichtspunkt ist das auch nachvollziehbar. Besondere Bewegungen wie das Wachstum von Pflanzen und Tieren hören irgendwann auf. Mit der alten Theorie ist das nicht ohne weiteres zu erklären. Wenn man das Wachstum von Pflanzen nach oben auf einen Anteil von Feuer und Luft in ihrer Substanz zurückführt, käme als Grund für das Ende des Wachstums nur eine Veränderung der Substanz in Frage - Feuer oder Luft müßten weniger werden oder Erde und Wasser mehr. Doch die damaligen Überlegungen gingen in eine andere Richtung.
® Das Ziel einer Bewegung als anziehende Kraft
Man ging davon aus, daß der Endpunkt der Bewegungen - das Ziel - auch eine Rolle spielen müsse. Die Forscher nahmen an, daß jedem Körper ein „Mangel“ oder auch eine „Beraubung“ als Teil der Substanz beigemischt ist. Sie bewirkt, daß der sich Körper zu einem Vorgegebe- nen Ziel hin entwickelt oder bewegt. Das Ziel entsprach der „Vollkommenheit“ des jeweili- gen Körpers, die einwirkende Kraft wurde zurückgeführt auf die vom Mangel bewirkte „Sehnsucht“, den Zustand der Vollkommenheit zu erreichen. Das ganze ist auch wieder mit dem Hintergrund zu sehen, daß die Wissenschaftler davon ausgingen, alles sei von Gott erschaffen und geplant.
Das führte zu Erklärungen, die Gott wieder wie zuvor, zur Zeit der Ottonen, direkter in das Geschehen einbezogen. Wilhelm von Auvergne meinte Gottes Vollkommenheit steuere auch Lebewesen insbesondere Tiere direkt hin zu deren Vollkommenheit.
Thomas von Aquin und Albertus Magnus gingen von einer Kombination aus direkter Steuerung durch Gott und Bewegung aufgrund des, jedem Lebewesens innewohnenden Mangels aus - hin zur Vollkommenheit.
b. Die Ordnung der Körper
® Räumliche Anordnung
Die Einführung von Zielen als Anlaß für Bewegungen und das allen Körpern gemeinsame Ziel der Vollkommenheit führte auch zu einer neuen Konfiguration der Körper im Raum. Waren bisher die Elementeigenschaften das Kriterium für die räumliche Anordnung (Erde: unten; Feuer: oben), so ist nun der Grad der Vollkommenheit mit entscheidend. Auch der Raum selbst hat sich geändert: wo zuvor alles räumlich eingeordnet wurde, aufgrund der Elementeigenschaften, laufen nun alle Bewegungen zwischen Mangel und Vollkommenheit ab:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die neue Vorstellung vom Raumes wirkte sich auch auf die vom Wettbewerb der Substanzen untereinander aus. Die Annahme, daß es ein Ziel untergeordneter Körper sei, den über ihnen stehenden zu dienen, machte die gesamte Ordnung in dieser Hinsicht auch ein wenig starrer, löste die Wettbewerbsvorstellung aber nicht vollkommen auf.
® Der Stellenwert der Seelen
Es kam zu einer stärkeren Trennung von Seele und Elementen. Jedes Wesen bestand zum einen aus der Materie (Substanzen und Elemente) und der Seele. Die Seele wurde als vollkommenerer Teil angesehen, und man stellte sie sich nicht mehr wie zuvor zusammengesetzt aus den Elementen vor, die Materie war im Gegensatz dazu unvollkommener.
Auch hier bestimmt die Seele über den Körper (Materie) doch nicht nur im Hinblick auf Bewegung: sie formt das unvollkommenere auch, soweit es in ihren Möglichkeiten liegt. Das geht über die zuvor angenommene Bewahrung der Ordnung noch hinaus: die Seele versucht den Widerstand, den ihr die Elemente entgegensetzen zu überwinden und sie nach ihrem Bild zu formen.
® Gleichheit
Die Betrachtung des Ziels im diesem Zusammenhang brachte auch was die Gleichheit oder Ähnlichkeit von Körpern eine Neuerung mit sich. Nun war nicht mehr gleich, was aufgrund gleicher Eigenschaften auch gleiche Anteile der verschiedenen Elemente besaß. Körper mit gleichem oder ähnlichem Ziel galten nun als gleich. Das heißt alle Menschen sind einander ähnlich, alle Tiere und alle Pflanzen. Die Ähnlichkeit ließ sich auch graduell einteilen: so wa- ren Pferde beispielsweise den Eichhörnchen ähnlich, weil beide unter die Kategorie „Tiere“ fallen. Bei Pferden untereinander war die Ähnlichkeit natürlich größer, da sie derselben Art angehörten.
Man ging aber weiterhin davon aus, daß Gleiches sich anzieht und Ungleiches sich abstößt.
IV. Parallelen von Naturerkenntnis und Gesellschaft
1. Die frühen Staufer
Anders als bei den späten Staufern (Friedrich II. / Manfred) interessierten sich die frühen Staufer (Friedrich Barbarossa) nicht für die Naturwissenschaften, dafür umso mehr für die Geschichtswissenschaften. Interessant ist aber, daß sich die Naturerkenntnisse auf die damalige Gesellschaft übertragen lassen. Das wird deutlicher, wenn man auf die in der Gesellschaft herrschenden Verhaltensmuster und deren Erklärung blickt:
a. Eigenschaften
Man ging davon aus, daß das Verhalten von Menschen auf gewissen Eigenschaften beruhte, die Eigenschaften waren die Ursache für das Verhalten - wie die Kräfte der Elemente, als Eigenschaft, für die Bewegungen der Körper verantwortlich war.
Wie auch den verschiedenen Körpern wurden den verschiedenen Menschen (Fürsten, Ritter, Bauern, Stadtbewohner) charakteristische Eigenschaften zugeschrieben, die auch noch in po- sitive und negative unterschieden wurden. Die Art der Eigenschaften unterschied sich von der, wie man heute zum Teil Menschen Charakterisiert, in der Hinsicht, daß nur Eigenschaf- ten betrachtet wurden, die direkt mit einem bestimmten Verhalten im Zusammenhang standen wie z.B.:
Mutig è kämpft gegen seine Feinde Maßvoll è weiß, sich zu zügeln
Mit Charakterisierungen wie „egoistisch“ oder „kreativ“ wurde nicht hantiert, sie waren dem damaligen Menschenbild, wie es auch bisher beschrieben wurde fremd.
b. Ordnung
Fürsten, Ritter, Bauern, Handwerker und Städter waren nach den damaligen Ansichten, wie die Elemente im Raum, schon von Grund auf räumlich getrennt. Ihre Unterschiedlichen Beru- fe und ihr unterschiedlicher Stellenwert begründete sich aus ihren Eigenschaften. Jeder Mensch versucht nun, das seinen Eigenschaften gemäße Verhalten gegenüber den Anderen zu behaupten.
c. Seelen /Fürsten
Die Fähigkeit der Fürsten zu regieren entsprang also auch ihren Eigenschaften, sie konnten, wie in der Natur die Seelen, ihre Untergebenen dazu veranlassen, auch Dinge zu tun, die nicht in dieselbe Richtung zielten wie die ihrer Eigenschaften. Fürsten hatten die Freiheit, sich im gesellschaftlichen Raum in alle Richtungen zu bewegen, sie konnten sowohl gut als auch böse sein.
Auch die Tendenz der Seelen zur Aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung wird auf die Fürsten übertragen. Auch sie versuchen dem Auseinanderstreben (ihrer Untertanen) entge- genzuwirken. So erhalten Vorgänge, wie etwa der Kampf Friedrich Barbarossas gegen die Oberitalienischen Städte und der Versuch, den Landfrieden zu etablieren einen weiteren As- pekt, abgesehen vom rationalen, machtpolitischen, wenn man die herrschenden Vorstellungen von der Ordnung als Teil dessen Entscheidungsgrundlage annimmt.
2. Die späten Staufer
Sie interessierten sich für die Naturwissenschaften und beschäftigten sich auch damit, anders als ihre Vorgänger. Friedrich II. schrieb sogar ein naturwissenschaftliches Buch: „Über die Kunst, mit Vögeln zu jagen“, hier zeigt sich, daß sich die neue Lehre bei ihm nicht vollständig durchgesetzt hat. Er kommt in seinem Buch gewissermaßen zu einer eigenen Version, die beide Strömungen miteinander verbindet:
® Er geht zwar auch auf Bewegungsvorgänge (Raubvögel) ein, läßt aber die Elemente außen vor. Bei der Frage, ob Raubvögel nun gut oder böse seien, kommt er zum Schluß, daß sich das aus der Form der Organe ableiten läßt. Wenn ein Vogel Klauen hat schlägt er andere, wenn er einen Schnabel hat, der zum Kampf gemacht ist, wird er kämpfen, die Gestalt als Ursache für das Verhalten.2 Das führt nicht direkt zu einer Antwort über gut und böse, erklärt aber das Verhalten der Raubvögel und zeitgt, daß er keine andere Wahl hat als zu jagen. Da er hier die Ursache nicht im Zusammenhang mit dem Ziel (Vollkommenheit) sieht folgt er in diesem Punkt der alten Lehre.
® Auf der anderen Seite billigt er dem Falkner zu, durch die Dressur auf das Verhalten des Raubvogels nicht nur zeitweise oder ständig Einfluß zu nehmen, sondern ihn auch verän- dern zu können. Das geht über die reine Bewahrung der Ordnung hinaus, denn die sieht für den Raubvogel vor, daß er zu seiner Ernährung und der seiner Nachkommen jagt und nicht für den Menschen. Die Natur des Vogels kann also dauerhaft umgeformt werden.
Das kann man auch in seiner Politik beobachten: er versucht die Ordnung des Reiches auf- rechtzuerhalten und Selbständigkeitsbestrebungen entgegenzuwirken, wie seine Vorgänger. Auf der anderen Seite versucht er die Menschen zu beeinflussen indem er Gesetze erläßt und versucht, die wirtschaftlichen Grundlagen zu verbessern. Basis dieses Verhaltens ist die An- sicht, daß die Menschen dazu neigen böses zu tun und es die Aufgabe der Fürsten ist, diese im positiven Sinne zu beeinflussen.
Generell läßt sich das Hervortreten der Zieldimension als Anlaß für das Verhalten von Menschen auch in der übrigen Gesellschaft beobachten. Das Gemeinsame Ziel verband die Menschen dann auch (è Gleichheit), was sich in vermehrtem Zusammenschluß zu Interessengruppen beobachten läßt, wie später die der Handwerker in Zünfte.
[...]
1 Albertus Magnus hat seine Ausbildung in Paris absolviert.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Stellenwert der Naturwissenschaften zur Zeit der Staufer?
Die Erkenntnisse der Naturwissenschaften beeinflussten das Weltbild und das Handeln der Menschen in Politik und Gesellschaft. Naturwissenschaftliche Sichtweisen und Modelle stehen im Zusammenhang mit der Geschichte, einschließlich der Stauferzeit, und können weitere Erklärungen für das damalige Denken und Handeln liefern. Im Gegensatz zu heute, wo ein pluralistisches Weltbild vorherrscht, gab es zur Stauferzeit einen gewissen Druck, einen Konsens in der Weltanschauung herzustellen. Es herrschte eine Art Aufbruchsstimmung unter den Naturwissenschaftlern, wobei "ständige und wiederholte Fragen" als "erster Schlüssel der Weisheit" galten. Die Forschung konzentrierte sich auf die Entwicklung von Erklärungsmodellen für die Welt und ihre Abläufe, weniger auf Erfindungen und Techniken. Die Erkenntnisse waren jedoch nicht völlig wertfrei, da die Forscher versuchten, das herrschende Selbstverständnis und das Gesellschaftsverständnis mit den in der Natur beobachteten Phänomenen in Einklang zu bringen. Das Weltbild war eng mit der Religion verbunden, und die Rolle Gottes wurde immer berücksichtigt.
Welche regionalen und zeitlichen Einordnungen gab es in den Naturwissenschaften zur Zeit der Staufer?
Zur Zeit der Staufer gab es zwei Strömungen in der Naturwissenschaft, die sich etwas unterschieden, aber nicht grundsätzlich widersprachen und zeitlich aufeinander folgten. Der Hauptunterschied lag in der Ursache oder dem Anlass von Bewegungen. Die erste Strömung war während der frühen Stauferzeit vorherrschend, mit Vertretern wie Adelard von Bath und Hildegard von Bingen. Sie orientierten sich an den Lehren Platos. Die zweite Strömung, vertreten von Robert Grosseteste und Albertus Magnus, setzte sich gegen Ende der Stauferzeit durch und berief sich auf Aristoteles. Die vermehrte Übersetzung antiker Werke trug zur Verbindung beider Lehren mit den antiken Wissenschaftlern bei. Bemerkenswert ist auch die Herkunft der Wissenschaftler, die hauptsächlich aus England, Frankreich und Italien stammten. Eine weitere Neuerung war die beginnende Trennung der Naturwissenschaften Biologie und Physik von der Medizin.
Was waren die Grundlagen der naturwissenschaftlichen Weltanschauung zur Zeit der Staufer?
Die Gelehrten der Stauferzeit beschäftigten sich hauptsächlich mit Bewegungen, insbesondere mit der Bewegungsrichtung (vertikal) und der Art der Bewegung (geradlinig, rund, kreisförmig). Sie beobachteten Bewegungen und Vorgänge in der Natur und versuchten, diese modellhaft zu erklären. Es setzte sich die Ansicht durch, dass Bewegungen auf Kräften beruhten, die sich innerhalb der Körper selbst befanden, wobei Gott als Schöpfer alles Verantwortlich blieb. Die stoffliche Schöpfung bestand aus Substanzen, wobei die Elemente Feuer, Luft, Wasser und Erde für die Eigenschaften der Körper im Bezug auf ihre Bewegungen verantwortlich gemacht wurden. Die Elemente wurden substanzielle (Leichtigkeit/Schwere) und akzidentielle (Wärme, Beweglichkeit usw.) Qualitäten zugeschrieben. Die räumliche Anordnung der Körper entsprach dem geozentrischen Weltbild, mit der Erde im Zentrum und dem Feuer am Rand. Lebewesen wurden durch "Seelen" charakterisiert, die in der Lage waren, den Körper in alle Richtungen zu bewegen. Es herrschte eine Hierarchie der Substanzen, wobei Stärkere die Eigenschaften der Schwächeren "unterdrücken" konnten. Die Elemente strebten auseinander, während die Seelen dem Zerfall entgegenwirkten. Körper mit gleicher oder ähnlicher Zusammensetzung galten als gleich und zogen sich an.
Wie unterschieden sich die Ansichten über die Ursache von Bewegungen in den verschiedenen Strömungen der Naturwissenschaft zur Zeit der Staufer?
Nach dem Naturverständnis der frühen Stauferzeit gab es für Bewegungen immer eine Ursache, die mit den Eigenschaften der Körper zusammenhing. Elemente und Seelen versuchten sich gegeneinander durchzusetzen und den Körper in "ihre" Bewegungsrichtung zu bringen. Die Vertreter der neueren Lehre sahen neben den Eigenschaften von Elementen und Seelen auch den Endpunkt von Vorgängen als entscheidend an. Sie nahmen an, dass jedem Körper ein "Mangel" oder eine "Beraubung" beigemischt ist, der/die bewirkt, dass der sich Körper zu einem vorgegebenen Ziel hin entwickelt oder bewegt. Das Ziel entsprach der "Vollkommenheit" des jeweiligen Körpers, die einwirkende Kraft wurde zurückgeführt auf die vom Mangel bewirkte "Sehnsucht", den Zustand der Vollkommenheit zu erreichen. Die Einführung von Zielen als Anlass für Bewegungen führte zu einer neuen Konfiguration der Körper im Raum, wobei der Grad der Vollkommenheit mitentscheidend war.
Welche Parallelen gab es zwischen der Naturerkenntnis und der Gesellschaft zur Zeit der Staufer?
Anders als bei den späten Staufern (Friedrich II. / Manfred) interessierten sich die frühen Staufer (Friedrich Barbarossa) nicht für die Naturwissenschaften, dafür umso mehr für die Geschichtswissenschaften. Interessant ist aber, daß sich die Naturerkenntnisse auf die damalige Gesellschaft übertragen lassen. Das Verhalten von Menschen beruhte auf Eigenschaften, die die Ursache für ihr Verhalten waren. Wie auch den verschiedenen Körpern wurden den verschiedenen Menschen (Fürsten, Ritter, Bauern, Stadtbewohner) charakteristische Eigenschaften zugeschrieben. Fürsten, Ritter, Bauern, Handwerker und Städter waren nach den damaligen Ansichten, wie die Elemente im Raum, schon von Grund auf räumlich getrennt. Die Fähigkeit der Fürsten zu regieren entsprang ihren Eigenschaften, und sie konnten, wie in der Natur die Seelen, ihre Untergebenen dazu veranlassen, Dinge zu tun, die nicht in dieselbe Richtung zielten wie die ihrer Eigenschaften. Auch die Tendenz der Seelen zur Aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung wird auf die Fürsten übertragen. Die späten Staufer interessierten sich für die Naturwissenschaften und beschäftigten sich auch damit. Friedrich II. schrieb sogar ein naturwissenschaftliches Buch. Das Hervortreten der Zieldimension als Anlaß für das Verhalten von Menschen ließ sich auch in der übrigen Gesellschaft beobachten, was sich in vermehrtem Zusammenschluß zu Interessengruppen beobachten ließ.
- Quote paper
- Jochen Braun (Author), 2000, Die Naturerkenntnis im Zeitalter der Staufer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97807