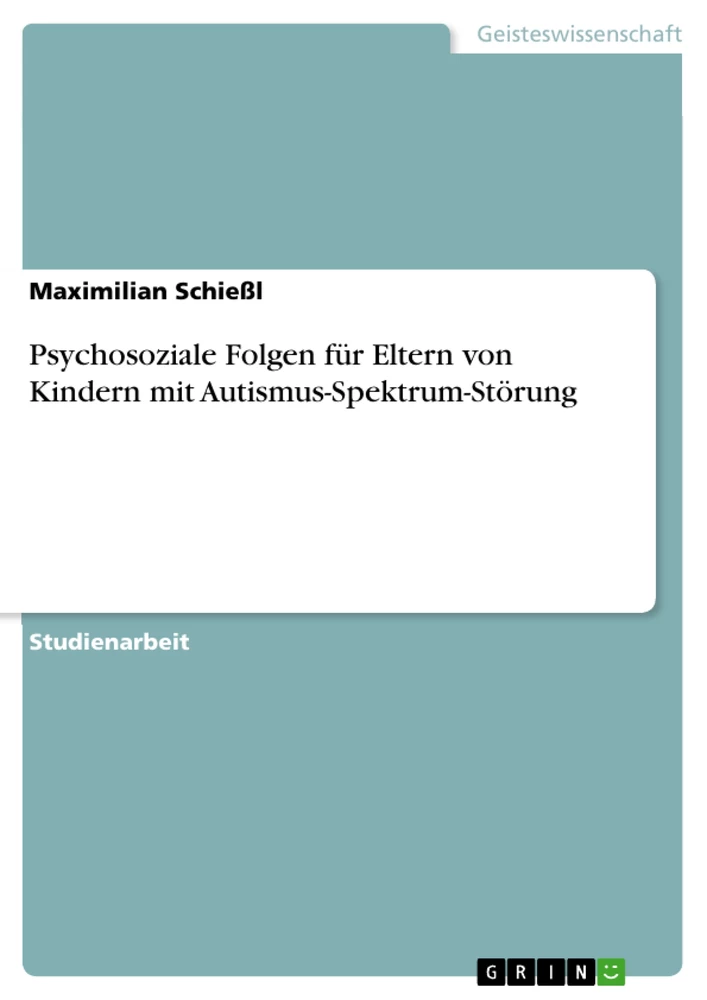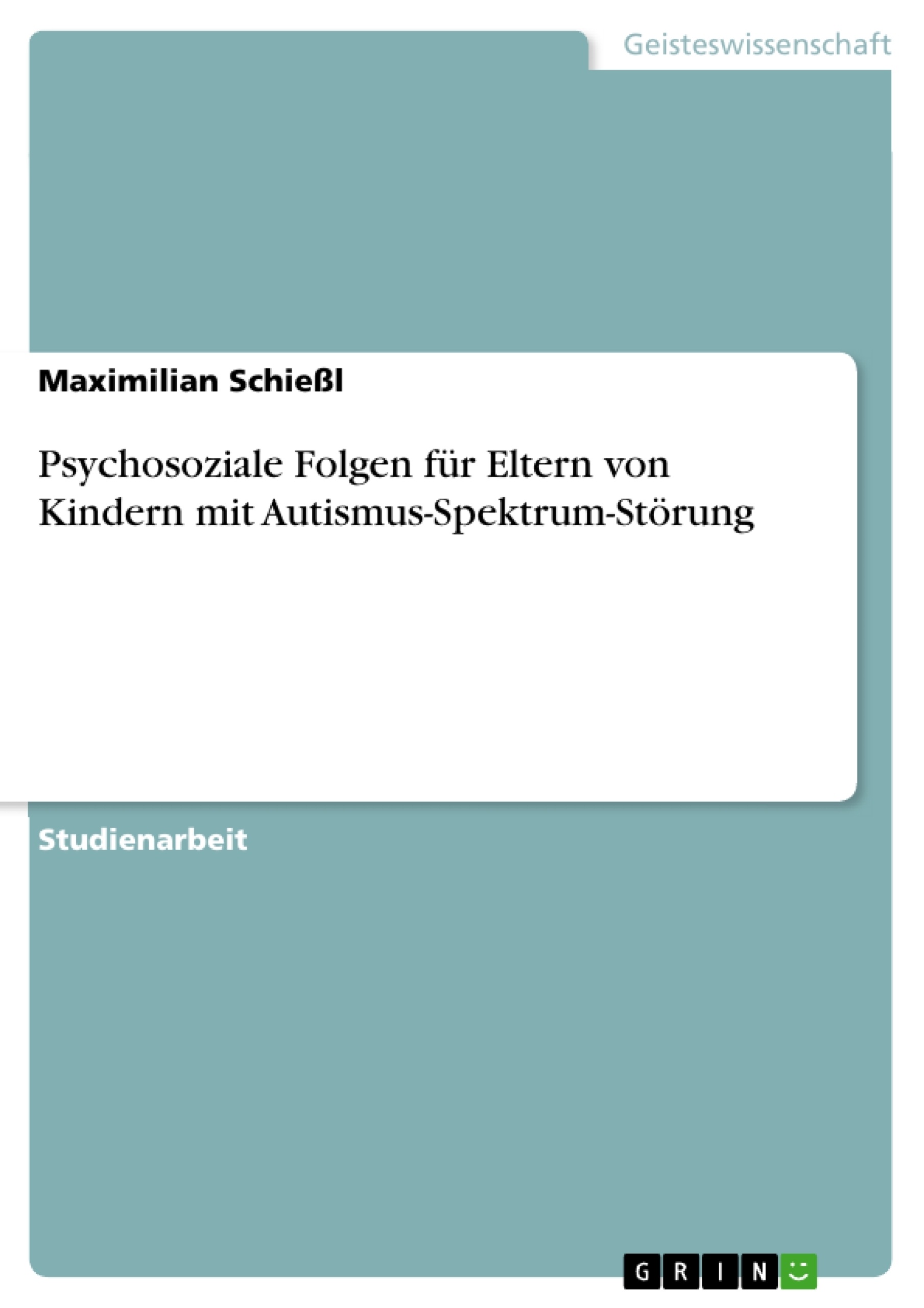Die Erziehung eines Kindes ist für fast alle Eltern eine Erfahrung, die mit Freude und Erfolgen, aber zugleich auch mit Herausforderungen und Stress verbunden ist. Allerdings scheinen Eltern von Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) ein besonders hohes Maß an parental stress zu erleben. Eltern von Kindern mit ASS sind, aufgrund der Störung ihres Kindes, mit immensen Herausforderungen konfrontiert. Die Folgen, die sich für die Eltern daraus ergeben schlagen sich sowohl auf psychischer als auch auf sozialer Ebene nieder. In der Gesamtschau zeigt sich, dass Eltern von Kindern mit ASS höheres Stress- und Depressionslevel sowie eine geringere Lebensqualität aufweisen, als Eltern von Kindern mit einer anderen Entwicklungsstörung oder Eltern von Kindern, die sich typischweise entwickeln. Dieser Umstand ist auf einen erhöhten Betreuungsbedarf/-aufwand und challenging behaviors des Kindes, sowie daraus resultierende Einbußen sozialer Ressourcen zurückzuführen. Obwohl es umfangreiche Literatur hinsichtlich der starken psychischen und sozialen Belastungen von Eltern von Kindern mit ASS gibt, gibt es kaum Betreuungsangebote, die sich explizit an die Eltern und deren Belastungen richten. Für die Zukunft erscheint es daher von besonderer Bedeutung einen Praxistransfer des vorhandenen Wissens anzustreben und zu forcieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Definition: Autismus-Spektrum-Störung
- 2.2 Psychosoziale Herausforderungen und Folgen für Eltern von Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung
- 2.2.1 Psychische Folgen für Eltern von Kindern mit einer ASS
- 2.2.2 Soziale Folgen für Eltern von Kindern mit einer ASS
- 2.3 Gesamtschau: Die psychosozialen Folgen für Eltern von Kindern mit einer ASS
- 3. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, die psychosozialen Folgen für Eltern von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) aufzuzeigen und die Bedeutung von Unterstützung für diese Eltern zu betonen. Die Arbeit untersucht die Herausforderungen, denen Eltern von Kindern mit ASS gegenüberstehen, und deren Auswirkungen auf die psychische und soziale Gesundheit der Eltern.
- Definition und Charakteristika von Autismus-Spektrum-Störungen
- Psychische Belastungen von Eltern von Kindern mit ASS (z.B. Stress, Depression)
- Soziale Herausforderungen und Auswirkungen auf das soziale Leben der Eltern
- Gesamteinschätzung der psychosozialen Folgen für betroffene Eltern
- Mangelnde Unterstützung und Hilfsangebote für Eltern von Kindern mit ASS
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den hohen Grad an parentalem Stress, den Eltern von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) erleben. Sie hebt die immensen Herausforderungen hervor, mit denen diese Eltern aufgrund der Erkrankung ihrer Kinder konfrontiert sind, und betont den Mangel an spezifischen Hilfsangeboten für diese Eltern, obwohl umfangreiche Literatur die starken psychischen und sozialen Belastungen belegt. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die psychosozialen Folgen für die Eltern aufzuzeigen und auf diese aufmerksam zu machen.
2. Hauptteil: Dieser Abschnitt befasst sich eingehend mit der Definition von ASS, basierend auf ICD-10 und DSM-5, und analysiert detailliert die psychosozialen Herausforderungen und Folgen für betroffene Eltern. Es werden sowohl psychische (wie Stress und Depression) als auch soziale Folgen (wie soziale Isolation und Einschränkungen im Alltag) untersucht und im Kontext des erhöhten Betreuungsaufwandes und des Verhaltens der Kinder mit ASS eingeordnet. Der Teil gipfelt in einer umfassenden Betrachtung der Gesamtwirkung dieser Belastungen auf das Wohlbefinden der Eltern.
Schlüsselwörter
Autismus-Spektrum-Störung (ASS), Eltern, psychosoziale Folgen, Stress, Depression, soziale Isolation, Betreuungsaufwand, Hilfsangebote, ICD-10, DSM-5, parentaler Stress, Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Psychosoziale Folgen für Eltern von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die psychosozialen Folgen für Eltern von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Sie beinhaltet eine Einleitung, einen Hauptteil mit Definition von ASS und detaillierter Analyse der psychischen und sozialen Herausforderungen für die Eltern, sowie eine abschließende Diskussion. Die Arbeit beleuchtet den erhöhten Betreuungsaufwand, Stress, Depressionen, soziale Isolation und den Mangel an Unterstützung für betroffene Eltern.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Charakteristika von ASS, psychische Belastungen der Eltern (Stress, Depressionen), soziale Herausforderungen und Auswirkungen auf das soziale Leben der Eltern, Gesamteinschätzung der psychosozialen Folgen, sowie der Mangel an Unterstützung und Hilfsangeboten für betroffene Eltern. Die Klassifizierung von ASS nach ICD-10 und DSM-5 wird ebenfalls berücksichtigt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und eine Diskussion. Der Hauptteil beinhaltet die Definition von Autismus-Spektrum-Störung, die Analyse der psychosozialen Herausforderungen und Folgen für die Eltern (aufgeteilt in psychische und soziale Folgen), und eine Gesamtschau der psychosozialen Folgen. Die Einleitung führt in die Thematik ein und hebt den hohen Grad an parentalem Stress hervor. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die psychosozialen Folgen für Eltern von Kindern mit ASS aufzuzeigen und die Bedeutung von Unterstützung für diese Eltern zu betonen. Sie möchte die Herausforderungen, denen Eltern gegenüberstehen, und deren Auswirkungen auf die psychische und soziale Gesundheit der Eltern beleuchten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Autismus-Spektrum-Störung (ASS), Eltern, psychosoziale Folgen, Stress, Depression, soziale Isolation, Betreuungsaufwand, Hilfsangebote, ICD-10, DSM-5, parentaler Stress, Herausforderungen.
Welche konkreten psychischen und sozialen Folgen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht sowohl die psychischen Folgen wie Stress und Depressionen als auch die sozialen Folgen wie soziale Isolation und Einschränkungen im Alltag für die Eltern von Kindern mit ASS. Diese Folgen werden im Kontext des erhöhten Betreuungsaufwandes und des Verhaltens der Kinder mit ASS betrachtet.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der Einleitung und des Hauptteils. Die Einleitung beschreibt den hohen Grad an parentalem Stress und den Mangel an Hilfsangeboten. Der Hauptteil beschreibt die detaillierte Analyse der psychosozialen Herausforderungen und Folgen für die Eltern.
- Citar trabajo
- Maximilian Schießl (Autor), 2020, Psychosoziale Folgen für Eltern von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/978252