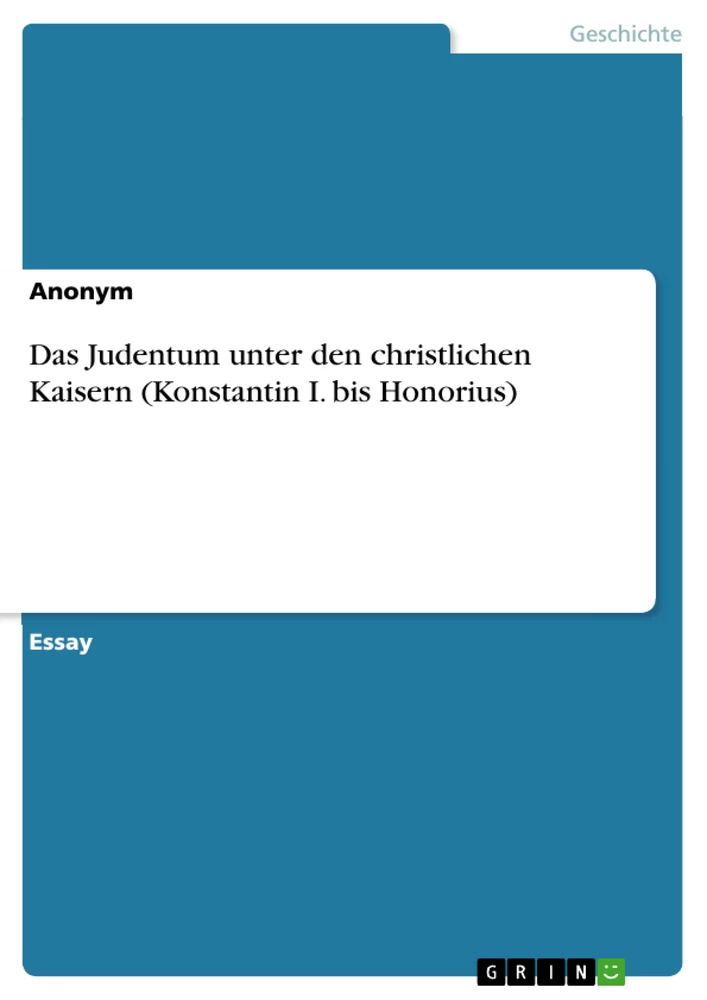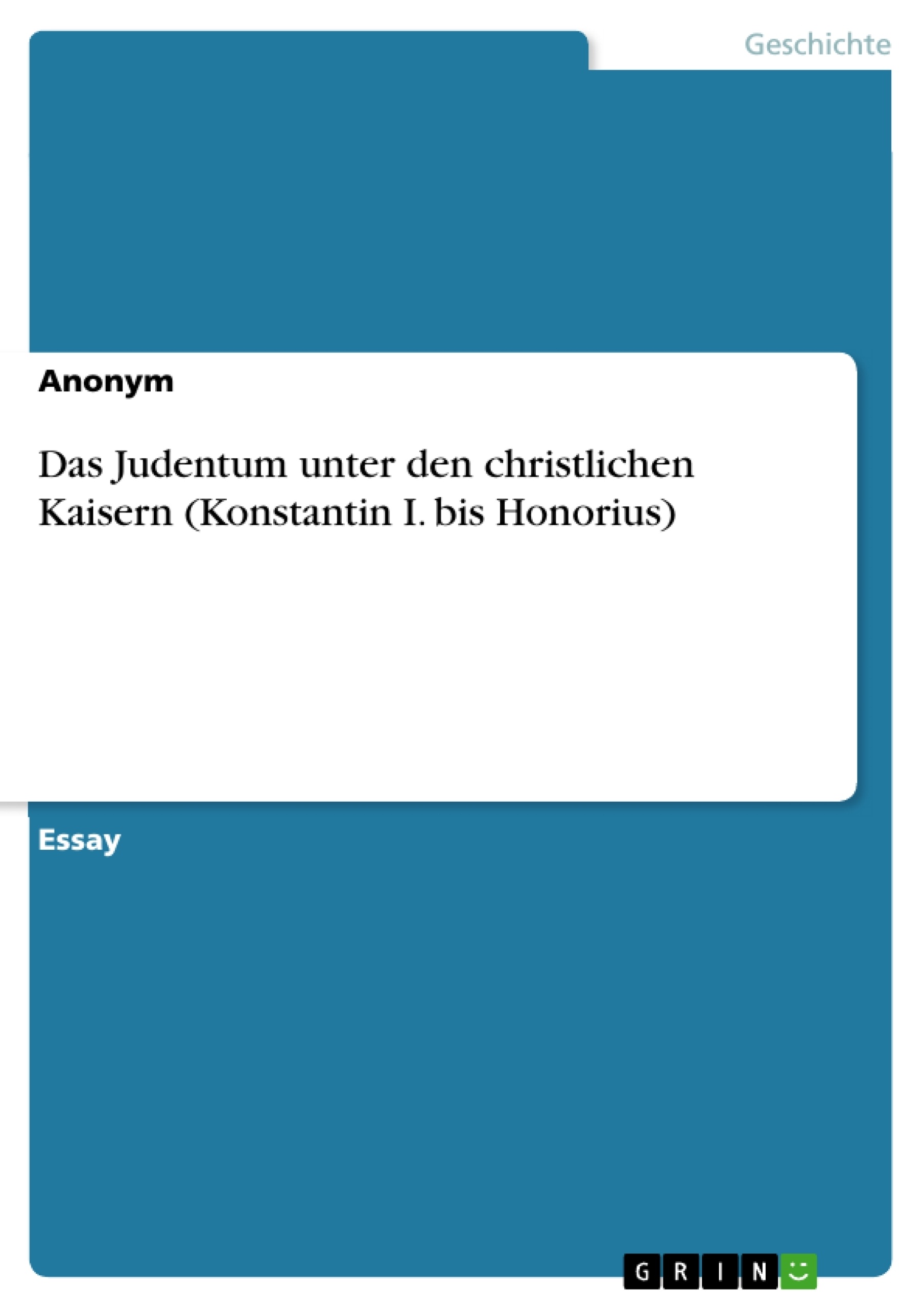Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, wie sich der rechtliche Status der Juden während des vierten und der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts im (West-)Römischen Reich entwickelte. Die Betrachtung wichtiger Bestimmungen unter Konstantin I. bis Honorius wird zeigen, dass sie nicht ausschließlich eine Verschlechterung des jüdischen Rechtsstatus bewirkten. Die staatliche Religionspolitik ging also nicht mit einem gezielten oder konsequenten Antisemitismus einher.
Das vierte Jahrhundert markierte den Beginn des religiösen Strukturwandels im Römischen Reich: Die jahrhundertlangen Christenverfolgungen fanden mit der als Toleranzedikt bekannten Regelung des Kaisers Galerius im Jahre 311 ein Ende, wonach „sie von neuem Christen sein und ihre Versammlungsorte wieder errichten können, zumindest so, dass sie nichts gegen die Staatsordnung unternehmen“. Die nachfolgenden Kaiser setzten mit ihren Konstitutionen die Förderung des Christentums als religio licta fort. Nur unter Julian, dem „Abtrünnigen“ (Apostata), fand eine kurze Phase der Repaganisierung statt. Sein Restaurationsversuch des Paganen konnte aber den christlichen Glauben nicht zurückdrängen, sodass das Christentum schließlich 380 unter Kaiser Theodosius I. den Charakter einer Staatsreligion bekam.
Im engen Zusammenhang mit dieser religiösen Neuregelung des Reiches stand der Umgang mit anderen, als heidnisch angesehenen Religionen. Eine besondere Rolle spielte dabei das Judentum, was die vielen den jüdischen Glauben betreffenden Gesetzgebungen der christlichen Kaiser verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Fragestellung, Gliederung und Quellen
- Das Judentum unter den christlichen Kaisern
- Konstantin I. (306/7-337)
- Konstantin II. (337-340), Constans (337-350) und Constantius II. (337-361)
- Julian, „Apostata“ (361-363)
- Valentinian I. (364-375), Valens (364-378) und Gratian (367-383)
- Theodosius I. (378-395)
- Honorius (393-423)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die rechtliche Situation des Judentums im Römischen Reich unter den christlichen Kaisern des 4. und frühen 5. Jahrhunderts. Sie verfolgt das Ziel, die Entwicklung des Rechtsstatus der Juden in diesem Zeitraum zu untersuchen und die Auswirkungen der staatlichen Religionspolitik auf ihre Lebensbedingungen zu beleuchten.
- Entwicklung des rechtlichen Status der Juden im (West-)Römischen Reich unter den christlichen Kaisern
- Einfluss der staatlichen Religionspolitik auf die jüdische Bevölkerung
- Analyse der kaiserlichen Erlasse und Dekrete, die sich auf das Judentum beziehen
- Untersuchung der Konvertierung zum Judentum und deren rechtliche Konsequenzen
- Beurteilung der Rolle des Antisemitismus in der römischen Gesetzgebung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Fragestellung der Arbeit, die Gliederung des Themas und die relevanten Quellen. Es werden wichtige Zusammenhänge zwischen der rechtlichen Situation des Judentums und der Entstehung des Christentums als Staatsreligion hergestellt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Judentum unter den christlichen Kaisern, beginnend mit Konstantin I. und seinem Edikt von Mailand. Die Kapitel behandeln die Entwicklung der Judengesetzgebung unter den verschiedenen Kaisern des 4. Jahrhunderts und analysieren deren Auswirkungen auf die Lebensbedingungen der jüdischen Bevölkerung. Es werden auch die Gründe für die Bevorzugung des Christentums und die Folgen für das Judentum beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen wie Judentum, Christentum, Römisches Reich, Religionspolitik, Rechtsstatus, Konvertierung, Antisemitismus, Kaiserliche Erlasse, Codex Theodosianus, Beschneidung, Mischehe.
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickelte sich der Rechtsstatus der Juden im 4. Jahrhundert?
Der Status war einem Wandel unterworfen. Während das Christentum zur Staatsreligion aufstieg, blieb das Judentum oft eine erlaubte Religion (religio licita), war jedoch zunehmend Einschränkungen durch kaiserliche Erlasse ausgesetzt.
Welche Rolle spielte Kaiser Konstantin I. für das Judentum?
Unter Konstantin I. begann die Förderung des Christentums, was den rechtlichen Rahmen für andere Religionen, einschließlich des Judentums, langfristig veränderte.
Was änderte sich unter Kaiser Theodosius I. für die Religionen im Reich?
Unter Theodosius I. wurde das Christentum im Jahr 380 zur Staatsreligion erhoben, was den Druck auf heidnische Kulte und das Judentum erhöhte.
Gab es unter den christlichen Kaisern einen konsequenten Antisemitismus?
Die Arbeit zeigt, dass die kaiserlichen Bestimmungen nicht ausschließlich eine Verschlechterung bewirkten; die Politik war nicht immer von einem gezielten oder konsequenten Antisemitismus geprägt.
Welche Bedeutung hat der Codex Theodosianus für dieses Thema?
Der Codex Theodosianus ist eine zentrale Quelle, da er viele kaiserliche Erlasse enthält, die den rechtlichen Umgang mit Juden, Mischehen und Konvertierungen regeln.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Das Judentum unter den christlichen Kaisern (Konstantin I. bis Honorius), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/978274