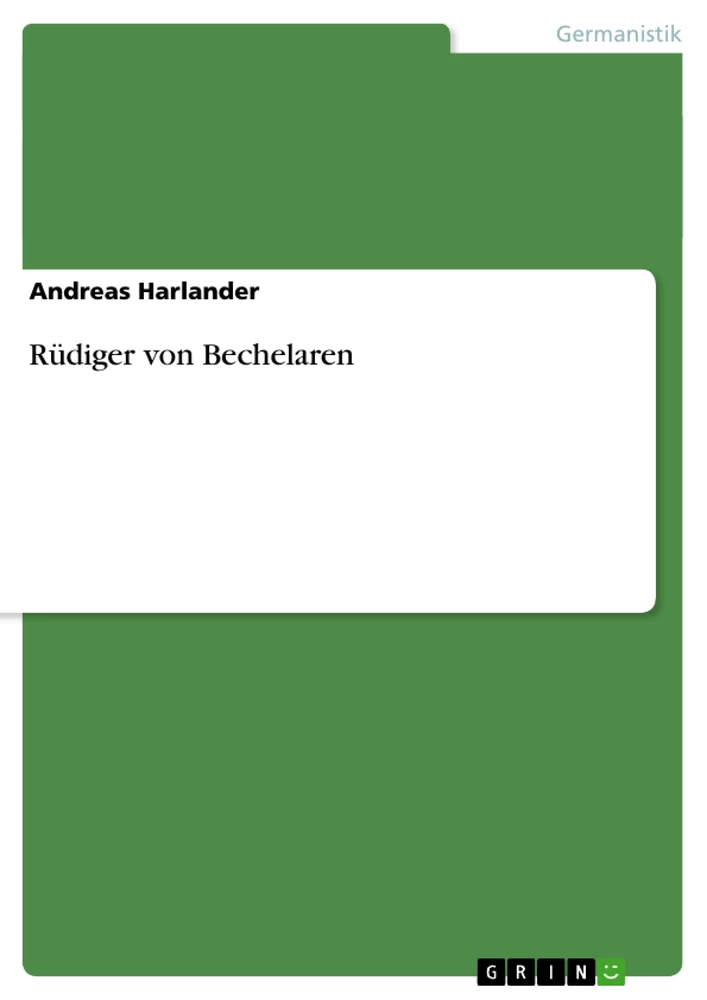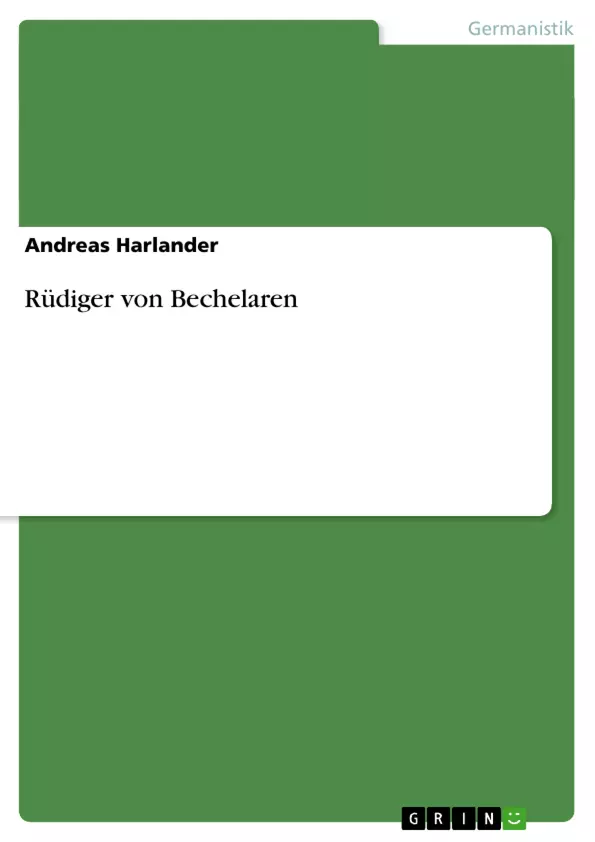Rüdiger von Bechelaren ist eine der tragischen Figuren im Nibelungenlied, die sich durch ihre Bindung an beide Konfliktparteien in eine aussichtslose Lage manövriert. Um genauer zu durchleuchten, wie es überhaupt zu dieser Entwicklung kommen kann, soll im Folgenden auf die Ausgangssituation, d. h. auf das Verhältnis Rüdigers zu Etzel bzw. zu den Nibelungen, eingegangen werden.
Inhalt
1. Ausgangssituation
1.1 Rüdigers Verhältnis zu Etzel
1.2 Rüdigers Verhältnis zu den Burgunden
2. Parteibindungen
2.1 Bindung an Kriemhild
2.2 Bindung an die Burgunden
3. Gewissenskonflikte
3.1 Schlichtungsversuche
3.2 Rüdiger gegen Etzel und Kriemhild
3.3 Rüdiger gegen die Burgunden
3.4 Konfliktlösung
4. Rüdigers Tod
5. Literaturverzeichnis
5.1 Primärliteratur
5.2 Sekundärliteratur
1. Ausgangssituation
Rüdiger von Bechelaren ist eine der tragischen Figuren im Nibelungenlied, die sich durch ihre Bindung an beide Konfliktparteien in eine aussichtslose Lage manövriert. Um genauer zu durchleuchten, wie es überhaupt zu dieser Entwicklung kommen kann, soll im Folgenden auf die Ausgangssituation, d. h. auf das Verhältnis Rüdigers zu Etzel bzw. zu den Nibelungen, eingegangen werden.
1.1 Rüdigers Verhältnis zu Etzel
Markgraf Rüdiger von Bechelaren tritt zum ersten Mal zu Beginn der zweiten Hälfte des Nibelungenliedes auf, also in der 20. Aventiure. Schauplatz des Geschehens ist der Hof König Etzels in Wien, wo sich Rüdiger als Flüchtling - er bezeichnet sich und seine Frau als ellende1 - zum Lehnsdienst unter Etzel verpflichtet hat.2 In dieser ersten relevanten Szene fungiert der Markgraf als Etzels Berater: Der König will sich nach Helches Tod eine neue Frau suchen und wird von seinen Freunden auf Kriemhild aufmerksam gemacht. Auf die Frage, wem denn ,,bî Rîne die liute und ouch daz lant"3 bekannt seien, schaltet sich nun Rüdiger ein: er kenne ,,die edelen künige hêr"4 von Kindheit an. Damit wird er für Etzel zum potentiellen Brautwerber. Zwar äußert Rüdiger noch Bedenken, Kriemhild könne wegen ihrer Liebe zu Siegfried Etzels Werbung abweisen, doch lässt sich Etzel davon nicht beirren:
,,was si des recken wîp,
sô was wol alsô tiure des edelen fürsten lîp, daz ich niht versmâhen die küneginne sol."5
Hier kommt es zu einem Missverständnis zwischen dem König und seinem Vasallen:
Während der König Rüdigers Bemerkung eher als eine Warnung vor einer nicht standesgemäßen Hochzeit auffasst, spielt dieser auf eine mögliche Zurückweisung Etzels durch Kriemhild an.6 Dadurch kommt sowohl die Sorge des Markgrafen um Etzels Ehre zum Ausdruck als auch die innige Bindung zwischen Lehnsherrn und Gefolgsmann, die auch durch die Aussprüche ,,vriunt"7 und ,,sô wirb ez, Rüedegêr, als liep als ich dir sî."8 deutlich wird.
1.2 Rüdigers Verhältnis zu den Burgunden
Anders verhält es sich mit Rüdigers Beziehung zu den Burgunden: Hier liegt keine rechtliche Verpflichtung vor wie zwischen Lehnsherrn und Lehnsmann, sondern eine auf der langen Bekanntschaft ,,von kinde"9 beruhende, tiefe Freundschaft und ein tiefes Vertrauensverhältnis. Dies zeigt sich schon bei der Begrüßung Rüdigers in Worms, bei der Ortwin von Metz sagt, die Burgunden hätten ,,in aller wîle mêre nie gesehen geste hie sô gerne".10 Zwar erkennt Gunther die Männer aus Bechelaren nicht sofort und ist auf Hagens Wissen angewiesen, doch ist dies für ihn kein Hinderungsgrund, Rüdiger alle Ehren zukommen zu lassen, die es für einen Gast am Hofe nur geben kann: Er nimmt ihn an der Hand und ,,brâht'in zuo dem sedele, dâ er selbe saz",11 bietet ihm also den Ehrenplatz neben dem König an. Auch die Bereitschaft, Rüdigers Anliegen ,,âne vriunde rât"12, ohne vorhergehende Beratung mit den königlichen Vertrauten, anzuhören, lässt auf einen großen Vetrauensvorschuss schließen, als könne der Markgraf gar keine schlechten Nachrichten überbringen.13
Auch Kriemhild macht schließlich deutlich, wieviel sie von Etzels Vasall hält; obwohl sie dessen Werbung mit ablehnender Haltung gegenübersteht, lässt sie ihn dennoch zu sich kommen. Dies geschieht aber nicht aus Achtung vor Etzel oder dem verlockenden Angebot an sich, sondern durch ,,sîne manige tugende"14 - wegen Rüdigers vieler Vorzüge. In ihrem Urteil findet sich damit schon ein Hinweis auf die hervorragende höfische Gesinnung Rüdigers, die ihn zum ,,vater aller tugende"15 macht, dem ,,vollendet höfischen Mann"16.
2. Parteibindungen
2.1 Bindung an Kriemhild
Das nun folgende Gespräch zwischen Kriemhild und Rüdiger soll sich als schicksalhaft erweisen. Weigert sich Kriemhild anfangs noch beharrlich, auf Etzels Werbung einzugehen, mit der Begründung, sie habe mit Siegfried ,,den besten, den ie frouwe gewan",17 verloren, , so ändert sie ihre Meinung am nächsten Morgen sehr schnell. Zu diesem Sinneswandel tragen allerdings nicht so sehr die Aussicht auf ,,friuntlîche liebe"18 oder gar die versprochenen ,,drîzec fürsten lant"19 bei, sondern vielmehr ein Eid, den Rüdiger ihr unter vier Augen schwört. Wegen der Wichtigkeit dieser Strophen, sollen sie hier im Ganzen wiedergegeben werden:
Niht half, daz sie gebâten, unz Rüedegêr gesprach in heimlîche die küneginne hêr, er wolde si ergetzen, swaz ir ie geschach.
ein teil begonde ir senften dô ir grôzer ungemach.
Er sprach zer küneginne: ,,lât iuwer weinen sîn. Ob ir zen Hiunen hêtet niemen danne mîn, getriuwer mîner mâge, und ouch der mînen man, er müeses sêr` engelten, unt het iu iemen iht getân.
Dâ von wart wol geringet dô der vrouwen muot. si sprach: ,,sô swert mir eide, swaz mir iemen getuot, daz ir sît der næhste, der büeze mîniu leit." dô sprach der marcgrâve: ,,des bin ich, vrouwe, bereit."
Mit allen sînen mannen swuor ir dô Rüedegêr mit triuwen immer dienen, unt daz die recken hêr ir nimmer niht versageten ûz Etzelen lant, des si êre haben solde, des sichert` ir Rüedegêres hant.20
Erst nach Rüdigers Zusage, er wolle ,,si ergetzen, swaz ir ie geschach",21 erklärt sich Kriemhild also bereit, der Heirat mit Etzel zuzustimmen. Das Verhängnisvolle bei diesem Schwur liegt nun darin, dass sich Kriemhild mit ,,swaz mir iemen getuot"22 bewusst allgemeiner Worte bedient, um ihn in dem Glauben zu lassen, sein Schwur beziehe sich auf zukünftiges Leid. Damit macht sie ihn in seiner Ahnungslosigkeit23 zum ,,Werkzeug ihrer Rache" an den Mördern Siegfrieds, wozu Rüdiger als Ehrenmann - würde er ihre Pläne durchschauen - wohl nicht sein Einverständnis gäbe.24 Ihre wahren Absichten werden im Nibelungenlied auch ganz offen dargelegt:
Do gedâhte diu getriuwe: ,,sît ich vriunde hân alsô vil gewunnen, sô sol ich reden lân die liute swaz si wellen, ich jâmerhaftez wîp. waz ob noch wirt errochen des mînen lieben mannes lîp?"
Durch diesen Eid bindet sich Rüdiger - zusätzlich zur ohnehin schon bestehenden Lehnspflicht gegenüber Etzel - an Kriemhild persönlich; damit sind die ersten Voraussetzungen für den späteren Gewissenskonflikt des Markgrafen erfüllt. Kriemhild nimmt die Werbung Etzels an.
2.2 Bindung an die Burgunden
Sieben Jahre sind seit Kriemhilds Hochzeit mit Etzel vergangen, als sich der Hunnenkönig auf Bitten seiner Gemahlin hin dazu entschließt, die Burgunden an seinen Hof zu einem Fest einzuladen. Auf deren Weg zu Etzel findet die nächste Begegnung der Burgunden mit Rüdiger statt. An der Grenze zu Bechelaren treffen sie unterwegs auf den Wachtposten Eckewart (26. Aventiure), der die Burgunden vor Kriemhilds immer noch währendem Hass warnt:
,,doch riuwet mich vil sêre zen Hiunen iuwer vart. ir sluoget Sîfriden: man ist iu hie gehaz. daz ir iuch wol behütet, in triuwen rât ich iu daz."25
Derselbe Mann weist die Burgunden jedoch auch auf die hervorragende Gastfreundschaft Rüdigers hin, der seiner Meinung nach ,,der beste wirt"26 ist, ,,der ie kom ze hûse".27 Auch seine Tugenden werden gelobt: ,,sîn herze tugende birt, alsam der süeze meije daz gras mit bluomen tout"28 - ein Motiv, das wohl aus dem Minnesang stammt.29 Rüdigers vollendet höfische tugenden werden hier also wieder ins Spiel gebracht und bereiten damit das nun folgende ,,Idyll von Bechelaren"30 vor.
Die Begrüßung der Burgunden in Rüdigers Heimat bringt abermals das herzliche Verhältnis zwischen Rüdiger und seinen Gästen zum Vorschein. Der Gastgeber ist ,,vrô unt gemeit"31 über den hohen Besuch und weist seine Familie darauf hin, wie sie jeden einzelnen der Gäste zu empfangen habe.32 Vor allem das Wiedersehen mit Hagen scheint ihm Freude zu machen - ,,besunder gruozte er Hagenen: den het er ê bekannt"33 - also genau mit dem Menschen, auf den es Kriemhilds Rache abgesehen hat.
Während des sich nun anschließenden Mahles schlägt Hagen ein Ehebündnis zwischen Rüdigers Tochter und Giselher vor. Trotz anfänglicher Bedenken des Markgrafen, seine Tochter sei wegen ihrer fremden Herkunft - er und seine Frau sind ja ,,ellende"34 - keine standesgemäße Braut für einen König, kommt es zur Eheschließung zwischen den beiden. Da Rüdiger aber als Lehnsmann Etzels seine Tochter nicht mit Burgen oder Ländereien als Mitgift ausstatten kann, überreicht er ihr statt dessen eine große Menge Gold und verspricht den Fürsten aus Worms, er wolle ihnen ,,mit triuwen immer wesen holt."35 Diese Hochzeit und sein Schwur vertiefen das bis dahin schon gute Verhältnis der Burgunden zu Rüdiger beträchtlich: Es besteht nun nicht mehr nur eine Bindung der Freundschaft, sondern auch der Verwandtschaft. Ob Hagen mit seinem Ehevorschlag berechnend handelt, um so die Bindung Rüdigers an die Nibelungen zu verstärken36, oder gänzlich ohne Hintergedanken - etwa, weil durch die friedvolle Atmosphäre in Bechelaren alle Erinnerung an die bevorstehende Gefahr verdrängt wird37 - sei dahingestellt.
Als die Gäste am nächsten Morgen aufbrechen wollen, hält Rüdiger sie zurück und fordert sie auf, noch etwas bei ihm zu bleiben, da er ,,sô lieber geste selten hie iht gewunnen"38 habe. Wieder tritt seine Großzügigkeit zutage: Trotz Dankwarts Ermahnung, ein weiteres Verbleiben der Burgunden in Bechelaren würde die Möglichkeiten des Markgrafen wohl übersteigen (,,wâ næmet ir die spîse, daz brôt und ouch den wîn, / daz ir sô manigen recken noch hînte müeset hân?"39 ), beharrt dieser auf seiner Bitte und ringt den Nibelungen mit dem Hinweis auf seinen Reichtum noch einen Aufenthalt ,,unz an den vierden morgen"40 ab.
Als sie sich schließlich bereit machen weiterzuziehen, gibt Rüdiger eine Probe seiner milte: Nicht nur, dass sie Pferde und Kleider zum Abschied erhalten, nein, König Gunther selbst erhält einen Waffenrock zum Geschenk. Der Vasall beschenkt den König, ,,swie selten er gâbe enpfienge"41 - obwohl er sonst nie Geschenke annimmt. Dies wird verständlich, wenn man daran denkt, dass ein Geschenk immer auch eine Abhängigkeit hervorruft, d. h. der Beschenkte, Gunther, begibt sich durch die Annahme der Gabe in die Abhängigkeit des Schenkenden, Rüdigers. Gerade deswegen war milte ja auch eine Herrschertugend.42 Es ist also als eine große Ehre anzusehen, wenn der König Rüdigers Gabe annimmt.43 Doch damit nicht genug: Gernot erhält das Schwert, ,,dâ von der guote Rüedegêr sît muose vliesen den lîp"44, mit dem er Rüdiger in der 37. Aventiure schließlich töten wird, und Hagen aus den Händen Gotelinds den Schild Nudungs, der nach der Thidrekssaga Gotelinds Bruder war, nach einigen deutschen Dichtungen ihr Sohn.45 All diese Geschenke sind Zeichen von Rüdigers milte, seiner Freigebigkeit und höfischen Gesinnung, mit der er seine Verbundenheit und Freundschaft zu den Nibelungen eindrucksvoll zur Schau stellt.46 Hier jedoch von der ,,christlichen Tugend opferfähiger Selbstüberwindung"47 zu sprechen, scheint unangebracht, da christliche Werte - abgesehen von der 37. Aventiure - im ganzen Nibelungenlied kaum eine Rolle spielen und fast nirgendwo Erwähnung finden. Außerdem gibt der Text selbst eine Begründung für höfische Großzügigkeit, die auch hier gelten kann: ,,sô helde varent rîche, sô sint si hôhe gemuot."48 Erst durch die milte ist ,,überhaupt ein Leben im festlichen Rahmen der höfischen Gesellschaft möglich."49
Wenn Rüdiger nun noch gelobt, ,,ich will iuch selbe leiten und heizen wol bewarn, daz iu ûf der strâze niemen müge geschaden",50 scheint sich dies nicht nur auf den Weg bis zu Etzels Hof zu beziehen; so wird es später auch zu einem seiner Argumente, warum er am Hunnenhof selber nicht gegen die Burgunden kämpfen kann.51
Indem sich Rüdiger durch seine Taten während des Aufenthalts der Burgunden in Bechelaren seinen Gästen so eng verpflichtet, ist nun die Basis für das kommende Unheil in der 37. Aventiure gelegt.
3. Gewissenskonflikte
3.1 Schlichtungsversuche
Von der nächsten bedeutsamen Tat Rüdigers wird in der 31. Aventiure berichtet. Die Stimmung am Hof ist gereizt, erste Spannungen sind mit Hagens und Volkers Weigerung, Kriemhild zu grüßen,52 und dem vereitelten Überfall der Hunnen auf die Burgunden aufgetreten.53 Rüdiger entgeht die drohende Gefahr einer bewaffneten Auseinandersetzung nicht; daher reagiert er sehr reserviert auf den Vorschlag Volkers, einen Buhurt zu veranstalten:
Dô reit er wîslichen zuo z'in durch die schar unde sagete sînen degenen, sie wæren des gewar, daz ummuote wæren die Guntheres man: ob si den bûhurt liezen, ez wære im liebe getân.54
Dass Rüdiger mit seiner Ahnung Recht behält, wird aus dem Ergebnis des Buhurts deutlich: Ein Hunne wird von Volker während des Turniers getötet.55
In der 33. Aventiure beginnt der große Kampf. Während des Festmahls überfällt Bloedel mit seinen Männern auf Geheiß Kriemhilds Dankwart und die burgundischen Knappen (32. Aventiure). Dankwart tötet seinen Gegner und schlägt sich bis zum Festsaal durch, wo die Burgunden sofort zum Angriff übergehen. Rüdiger ist nicht bereit, in die Kampfhandlungen einzugreifen und versucht der Notwendigkeit, sich für Etzel gegen seine ehemaligen Gästen zu stellen, zu entgehen:
Dô sprach der marcgrâve, der edel Rüedegêr: ,,sol aber ûzem hûse iemen komen mêr, die iu doch gerne dienen, daz lâzet uns vernemen. sô sol ouch vride stæte guoten vriunden gezemen."56
Aus dem Kampfverzicht Rüdigers wird deutlich, dass dieser die Nibelungen trotz der nun auftretenden Feindseligkeiten immer noch als vriunde betrachtet - eine Verletzung der Lehnspflicht gegenüber Etzel, auf die im Text aber nicht weiter eingegangen wird.
Ein letzter Versuch, die Situation zu entspannen, folgt am nächsten Morgen (37. Aventiure): Rüdiger kommt an den Hof und erblickt die Opfer, die die Auseinandersetzung bisher gefordert hat: ,,dô sach er beidenthalben diu gr_zlîchen sêr; / daz weinte inneclîchen der vil getriuwe Rüedegêr."57 Seine Klage zielt also auf die Toten beider Seiten ab, seine Treue ist nicht auf eine Partei beschränkt; doch seine Vermittlung schlägt fehl: Über einen Boten verständigt er Dietrich von Bern, der den König der Hunnen vielleicht doch noch für den Frieden gewinnen könnte, der aber wiegelt ab: ,,wer möht'iz understân? / ez enwil der künec Etzel niemen scheiden lân.".58 Etzel ist nach all den Vorkommnissen nicht mehr zu einer unblutigen Lösung bereit.
Schwer gezeichnet von der ausweglosen Situation fährt Rüdiger fort in seiner Klage. Ein Hunne, der dies beobachtet, wirft ihm daraufhin Feigheit und Untätigkeit vor: ,,man giht im, er sî küener, danne iemen müge sîn: / daz ist in disen sorgen worden b_slîche schîn."59 Rüdiger kann dies nicht auf sich sitzen lassen: ,,du solt ez arnen; du gihest, ich sî verzagt. du hâst dîniu mære ze hove ze lûte gesagt."60 Dabei geht es Rüdiger gar nicht so sehr um den Vorwurf an sich, sondern um die Art und Weise: Der Hunne hat seine mære in Anwesenheit des Herrschers - ze hove - und öffentlich - ze lûte - gesagt. Dieser Gesichtsverlust für Rüdiger, dieser Verlust seiner Ehre muss nach ritterlichen Maßstäben bestraft werden. So wird denn auch seine folgende Tat verständlich: mit bloßer Faust erschlägt er den Hunnen.
Die fûst begond er twingen. dô lief er in an unde sluoc sô krefteclîche den hiunischen man, daz er im vor den füezen lac vil schiere tôt! dô was aber gemêret des künec Etzelen nôt.61
Dass dies nicht zu dem Bild passt, das man aus der bisherigen Handlungen Rüdigers erhält, lässt Zweifel an der Wahrhaftigkeit seiner höfischen Gesinnung aufkommen. Jedoch wäre eine solche Tat im Mittelalter durchaus verständlich gewesen: ,,Verletzte Ehre fordert Rache."62 Außerdem muss Rüdiger auch aus dichterischer Sicht so handeln, um von Kriemhild getadelt zu werden und so seinen inneren Konflikt öffentlich machen zu können.63 Rüdiger besetzt ,,eine ihm ad hoc zugewiesene Rolle",64 die Klage der Königin beginnt.
3.2 Rüdiger gegen Etzel und Kriemhild
,,Wie habe wir verdienet daz,
Daz ir mir unt dem künege mêret unser leit? nu habt ir uns, edel Rüedegêr, allez her geseit, ir woldet durch uns wâgen die êre unde ouch das leben. ich hôrt'iu vil der recken den prîs vil gr_zlîchen geben."65
Mit diesen Worten eröffnet Kriemhild ihre Anklage gegen Rüdiger. Das erste Argument ist schnell gefunden: der Eid, den der Markgraf ihr in Worms einst schwor, muss nun erfüllt werden:
,,Ich man'iuch der genâden, und ir mir habt gesworn, do ir mir zuo Etzeln rietet, ritter ûz erkorn, daz ir mir woldet dienen an unser eines tôt. des wart mir armen wîbe nie sô gr_zlîche nôt."66
Dies bestreitet Rüdiger auch gar nicht. Allerdings ergibt sich für ihn nun ein Problem, das jenseits eines jeglichen weltlichen Versprechens steht: das Problem des Seelenheils.
,,Daz ist âne lougen: ich swuor iu, edel wîp, daz ich durch iuch wâgte êre unde ouch den lîp. daz ich die sêle vliese, des enhân ich niht gesworn. zuo dirre hôhgezîte brâht` ich die fürsten wol geborn."67
Ein Bruch des Geleitschutzes, der für Rüdiger wohl immer noch Bestand hat, wäre also ein Eidbruch, der ,,germanisch-sittlich zur Schande, christlich-dogmatisch zur Hölle"68 führt. Das Seelenheil nimmt nun aber eine viel zu hohe Stellung ein, als dass man es durch einen Eid gegenüber einem weltlichen Herrscher gefährden dürfte, ,,jede Verpflichtung [findet darin] ihre unübersteigbare Grenze".69 Die Berufung auf das Seelenheil scheint im Mittelalter zudem eine nicht ungewöhnliche Praxis gewesen zu sein, um einer Weisung, die dem eigenen Gewissen zuwiderläuft, auszuweichen.70 Auch die Wiederaufnahme des Motivs durch den Dichter - ,,Nu liez er an die wâge sêle unde lîp" - lässt darauf schließen, dass es sich hierbei nicht um eine der üblichen Gottesanrufungen handelt, wie sie im Nibelungenlied häufig und oft ohne große Aussagekraft auftreten, sondern um eine für Rüdiger wirklich bedeutsame Angelegenheit. Doch seine Worte finden kein Gehör:
Si sprach: ,,gedenke, Rüedegêr, der grôzen triuwe dîn, der stæte und ouch der eide, daz du den schaden mîn immer woldest rechen und elliu mîniu leit." dô sprach der marcgrâve: ,,ich hân iu selten verseit."71
Den Höhepunkt ihres Unterfangens, Rüdiger auf die Seite der Hunnen zu ziehen, findet sich in der folgenden Strophe: ,,Etzel der rîche vlêgen ouch began. dô buten si sich ze füezen beide für den man."72 Hier kommt es zum zweiten Mal nach der Gabe des Waffenrockes zu einer Umkehrung der Herrschaftsverhältnisse: das Königspaar kniet sich vor dem Vasallen nieder und beharrt nicht mehr auf rechtlichen Ansprüchen, sondern bittet ihn flehentlich um Hilfe,73 worauf sich Rüdiger nun deutlich zur Ausweglosigkeit seiner Lage äußert:
,,Owê mir gotes armen, daz ich ditz gelebet hân.
aller mîner êren der muor ich abe stân,
triuwen unde zühte, der got an mir gebôt.
owê got von himele, daz mihs niht wendet der tôt!
Swelhez ich nu lâze unt daz ander begân,
sô hân ich b_slîche und vil übele getân:
lâze aber ich si beide, mich schiltet elliu diet.
nu ruoche mich bewîsen der mir ze lebene geriet."74
Er erkennt, dass es für sein Problem keine Lösung gibt, wie immer er sich auch entscheiden mag; sein Tun kann nur unrecht sein. Würde er aber gar nicht handeln und für keine der beiden Seiten kämpfen, wäre dies mit dem Verlust von Ansehen und Ehre bei allen Menschen verbunden. Im Bewusstsein der Unmöglichkeit, eine rechtmäßige Entscheidung zu treffen, klagt er über seine verlorenen êren, triuwen und zühte und damit einiger der wichtigsten höfischen Tugenden überhaupt.75 Allein die völlige Auflösung des Lehnsverhältnisses, die diffidatio, könnte noch als Ausweg dienen:
,,her künec, nu nemt hin widere al daz ich von iu hân,
daz lant mit den bürgen: des sol mir niht bestân.
ich will ûf mînen füezen in daz ellende gân.76
Sogar die Aufgabe aller weltlichen Güter scheint ihm also willkommener als eine Entscheidung für eine der beiden Parteien. Ob die diffidatio allerdings im Moment der höchsten Gefahr für den Lehnsherrn möglich war, bleibt zweifelhaft.77 Etzel ist jedenfalls nicht dazu bereit und unterbreitet Rüdiger einen ganz anderen Vorschlag:
Dô sprach der künec Etzel: ,,wer hülfe danne mir?
daz lant zuo den liuten daz gib` ich allez dir,
daz du mich rechest, Rüedegêr, an den vîenden mîn.
du solt ein künec gewaltec beneben Etzelen sîn."78
Rüdiger geht nicht auf das Angebot ein. Ein letztes Mal führt er die Bewirtung, Beschenkung und Verwandtschaft zu den Burgunden an, ehe er sich schließlich - nach einem weiteren Hinweis Kriemhilds auf ihr großes Leid - entscheidet:
Dô sprach der marcgrâve wider daz edel wîp:
,,ez muoz hiute gelten der Rüedegêres lîp,
swaz ir und ouch mîn herre mir liebes habt getan.
dar umbe muoz ich sterben; daz mac niht langer gestan.
Ich weiz wol, daz noch hiute mîne bürge unde mîniu lant in müezen ledec werden von ir etelîches hant. ich bevilh` iu ûf genâde mîn wîp unde mîniu kint und ouch die vil ellenden, die dâ ze Bechelâren sint."79
Nu liez er an die wâge sêle unde lîp.
dô begonde weinen das Etzelen wîp.
er sprach: ,,ich muoz iu leisten, als ich gelobet hân.
owê der mînen friunde, die ich ungerne bestân."80
Rüdiger entschließt sich also, für Etzel und Kriemhild zu kämpfen, obwohl er weiß, dass dies seinen Tod bedeuten wird. Damit trifft er auch eine Entscheidung für die Lehnspflicht und gegen die Verwandtschaftstreue. Dass damit sein Seelenheil gefährdet ist, spricht der Verfasser deutlich an und nimmt damit Bezug auf die von Rüdiger schon zuvor angedeutete Problematik.81 Auffällig ist nun, dass Rüdiger mit Gastrecht, Gaben und Verwandtschaft Argumente anführt, die für Kriemhild in ihrer Rachsucht gegenüber der eigenen Familie keinerlei Bedeutung haben.82 Ein Einlenken ihrerseits ist schon deshalb kaum zu erwarten.
3.3 Rüdiger gegen die Burgunden
Als sich Rüdiger schließlich traurig zum Kampf rüstet und mit seinem Gefolge die Nibelungen aufsucht, erkennt allein Volker seinen Gewissenskonflikt - ,,ez was im gr_zlîche leit."83 Während Giselher noch seiner Freude Ausdruck verleiht, seinen ,,sweher"84 wiederzusehen, ahnt der Spielmann, weshalb der alte Freund in voller Bewaffnung erscheint:
,,Ine weiz, wes ir iuch tr_stet", sprach dô der spileman.
,,wa gesâhet ir ie durch suone sô manegen helt gân
mit ûf gebunden helmen, die trüegen swert enhant?
an uns will dienen Rüedegêr sîne bürge und sîniu lant."85
Rüdiger versagt seinen Verwandten ,,dienest unde gruoz"86 und versucht, sich der Treueverpflichtung, die er ja freiwillig auf sich genommen hat, zu entledigen:
,,ir küenen Nibelunge, nu wert iuch über al.
ir soldet mîn geniezen, nu engeltet ir mîn.
ê do wâren wir friunde: der triuwen will ich ledec sîn."87
,,Da erschrahten dirre mære die nôthaften man"88, keiner außer Volker (und später Hagen) hat mit dieser Reaktion gerechnet. Im Vertrauen auf die gegenseitig zugesicherte triuwe bemüht sich Gunther, Rüdiger von seinem Vorhaben abzubringen:
,,Nune welle got von himele", sprach Gunther der degen, ,,daz ir iuch genâden sült an uns bewegen
unt der vil grôzen triuwe, der wir doch heten muot. ich will iu des getrûwen, daz irz nimmer getuot."89
Doch es hilft nichts, der Entschuss steht fest - ,,ich muoz mit iu strîten, wand` ichz gelobet hân."90 Im weiteren Verlauf des Gespräches nehmen die Burgunden nun genau die Argumente auf, die Rüdiger zuvor gegenüber Kriemhild geäußert hat: die Bewirtung in Bechelaren (,,wand` ez wirt deheiner gesten nie erbôt / sô rehte minneclîchen, als ir uns habt getân"),91 die Gaben und das Geleit (,,der hêrlîchen gâbe, dô ir uns brâhtet her / in Etzeln lant mit triuwen, des gedenket, edel Rüedegêr.").92 Der Markgraf erkennt natürlich die Unrechtmäßigkeit seines Tuns - ,,ez enwart noch nie an helden wirs von friunden getân"93 - muss also gegen seine eigene innere Überzeugung handeln, was schließlich so weit geht, dass er Gernot eine glückliche Heimkehr und sich selbst den Tod wünscht: ,,Daz wolde got", sprach Rüedegêr, ,,vil edel Gêrnôt. / daz ir ze Rîne wæret und ich wære tôt"94. Aber weder die Drohung Gernots, er würde Rüdiger mit dessen eigenem Schwert getötet,95 noch der Vorwurf Giselhers, er würde seine eigene Tochter ins Unglück stürzen,96 können Rüdiger aufhalten. Der Kampf muss beginnen. Die Situation ist aussichtslos; wie zuvor schon Kriemhild, erkennen auch die Burgunden nicht die Zwangslage, in der sich ihr Freund befindet. Allein ihre Argumente zählen, seine Lehnspflicht gegenüber Etzel wird von ihnen überhaupt nicht angesprochen.97 Giselher annulliert endlich die Ehe mit Rüdigers Tochter und kündigt damit auch jede verwandtschaftliche Bindung zu Bechelaren auf; eine Lösung des Konflikts scheint fern.
2.4 Konfliktlösung
Doch nun geschieht etwas, womit niemand gerechnet hat: Hagen tritt zwischen die beiden Seiten und bittet Rüdiger - seinen Freund und Feind - um dessen Schild, da sein eigener, den er von Gotelind in Bechelaren erhalten hat, zerschlagen ist:
,,Daz des got von himele geruochen wolde,
daz ich schilt sô guoten noch tragen solde,
sô den du hâst vor hende, vil edel Rüedegêr!
so bedorfte ich in den stürmen deheiner halsperge mêr."98
Rüdiger sträubt sich zwar aus Rücksicht auf Kriemhild, gibt jedoch dann doch noch nach:
,,Vil gerne ich dir wære guot mit mînem schilde,
torst` ich dir in bieten vor Kriemhilde.
doch nim du in hin, Hagene, unt trag` in an der hant.
hey soldest du in füeren heim in der Burgonden lant."99
In Hagens Bitte und Rüdigers Antwort ist die sonst bestimmende Anrede ,,Ihr" dem vertraulichen ,,Du" gewichen.100 Eine wirkliche Notwendigkeit, genau diesen Schild zu besitzen, besteht für Hagen allerdings nicht; nach der kampfreichen Nacht sind hunderte herrenlose Schilde im Saal.101 Statt dessen schafft der Burgunde durch seine Bitte eine Möglichkeit für Rüdiger, seine Treue zu den Nibelungen eindrucksvoll unter Beweis zu stellen, die ja anfangs schon verloren schien.102 Zweifelhaft bleibt, ob diese Geste neben der Rettung der Ehre auch die Rettung für Rüdigers Seele bedeutet,103 oder ob die Frage des Seelenheils hier nicht berührt wird.104 Eine derart demonstrative Unterstützung des Feindes, wie dies hier geschieht, beinhaltet ja auch eine Verletzung der Lehnspflicht gegenüber Etzel, selbst wenn Rüdiger danach noch für ihn in den Kampf geht. Doch auch Hagen und Volker schrecken auch vor solch einem Eidbruch nicht zurück: Sie weigern sich beide, ihn nach diesem Freundschaftsbeweis anzugreifen.
4. Rüdigers Ende
Der Tod kommt für den Markgrafen schnell: Nachdem er in den Reihen der Burgunden gewütet hat, töten sich Rüdiger und Gernot im Zweikampf gegenseitig. Das eigene Schwert bedeutet für dem Mann aus Bechelaren also den Tod, ganz so wie Gernot es angedroht hatte. Mit dem Tod beider ist nun auch jeder Rechtsentscheid unmöglich geworden.105 Vielmehr wird der Streit um Rüdigers Leichnam zum Anlass für den letzten Kampf.106
Es ist bezeichnend, dass gerade der tugendhafteste Mann aller in diese ausweglose Situation gerät, die mit seinem Tod endet. Höfisch-ritterliche Werte scheinen in dieser Welt keinen Bestand zu haben und müssen zugrundegehen107 - der ,,vater aller tugende lag an Rüedegêren tôt."108
5. Literaturverzeichnis
5.1 Primärliteratur
[Nibelungenlied]. De Boor, Helmut (Hg.). 221996. Das Nibelungenlied. Nach der Ausgabe von Karl Bartsch. Wiesbaden: Albert (Deutsche Klassiker des Mittelalters).
[Nibelungenlied]. 1997. Das Nibelungenlied. Nach dem Text von Karl Bartsch und Helmut de Boor ins Neuhochdeutsche übersetzt und kommentiert von Siegfried Gosse. Stuttgart: Philipp Reclam jun. (Universal-Bibliothek, 644).
5.2 Sekundärliteratur
Heinzle, Joachim. 1987. Das Nibelungenlied. München: Artemis (Artemis-Einführungen, 35).
Hoffmann, Werner. 1969. Das Nibelungenlied. Interpretation von Werner Hoffmann. München: R. Oldenbourg (Interpretationen zum Deutschunterricht) .
. 1987. Das Nibelungenlied. Von Werner Hoffmann. Frankfurt am Main: Diesterweg (Grundlagen und gedanken zum Verständnis erzählender Literatur).
Nagel, Bert. 1965. Das Nibelungenlied. Stoff - Form - Ethos. Frankfurt am Main: Hirschgraben.
Naumann, Hans. 1932. ,,Rüdigers Tod." In: Deutsche Vierteljahresschrift für Literatur wissenschaft und Geistesgeschichte 10, 387-403.
Schulze, Ursula. 1997. Das Nibelungenlied. Stuttgart: Philipp Reclam jun. (UniversalBibliothek, Literaturstudium, 17604).
Splett, Jochen. 1968. Rüdiger von Bechelaren. Studien zum zweiten Teil des Nibelungen liedes. Heidelberg: Carl Winter (Germanische Bibliothek, Dritte Reihe, Untersuchun gen und Einzeldarstellungen).
[...]
1 Str. 1676, 3; diese und alle folgenden Verweise auf Strophen und Verse im Nibelungenlied beziehen sich auf die Handschrift B nach der Ausgabe von Karl Bartsch, hrsg. von Helmut de Boor (siehe Bibliographie)
2 Str. 1153, 4
3 Str. 1147, 2
4 Str. 1147, 4
5 Str. 1158, 1-3
6 Splett, S. 45 u. 56
7 Str. 1149, 1
8 Str. 1151, 1
9 Str. 1147, 4
10 Str. 1184, 3-4
11 Str. 1186, 1
12 Str. 1192, 2
13 Splett, S. 48
14 Str. 1121, 3
15 Str. 2202, 4
16 Splett, S. 44
17 Str. 1233, 4
18 Str. 1234, 2
19 Str. 1235, 3
20 Str. 1255 - 1258
21 Str. 1255, 3
22 Str. 1257, 2
23 Splett, S. 59
24 Splett, S. 51f.
25 Str. 1635, 2-4
26 Str. 1639, 1
27 Str. 1639, 2
28 Str. 1639, 2-3
29 Splett, S. 60
30 Splett, S. 66
31 Str. 1646, 4
32 Str. 1651f.
33 Str. 1657, 4
34 Str. 1676, 3
35 Str. 1682, 1
36 Hoffmann, S. 85
37 Splett, S. 69
38 Str. 1688, 4
39 Str. 1689, 2-3
40 Str. 1691, 2
41 Str. 1695, 3
42 Splett, S. 68
43 Splett, S. 65
44 Str. 1696
45 de Boor, S. 268
46 Splett, S. 65f.
47 Nagel, S. 230
48 Str. 1171, 4
49 Splett, S. 68
50 Str. 1708, 2-3
51 vgl. Str. 2150
52 vgl. Str. 1780ff.
53 vgl. Str. 1837ff.
54 Str. 1876
55 vgl. Str. 1892
56 Str. 1996
57 Str. 2135, 3-4
58 Str. 2137, 3-4
59 Str. 2140, 3-4
60 Str. 2141, 3-4
61 Str. 2142
62 de Boor, S. XI
63 Splett, S. 76
64 Splett, S. 75
65 Str. 2147, 4 und 2148
66 Str. 2149
67 Str. 2150
68 de Boor, S. 337
69 Splett, S. 80
70 Splett, S. 80
71 Str. 2151
72 Str. 2152, 1-2
73 Splett, S. 81
74 Str. 2153f.
75 Nauman, S. 389
76 Str. 2157, 2-4
77 Splett, S. 83
78 Str. 2158
79 Str. 2163f.
80 Str. 2166
81 Str. 2150, 3
82 Splett, S. 86
83 Str. 2170, 4
84 Str. 2171, 1
85 Str. 2172
86 Str. 2174, 4
87 Str. 2175, 2-4
88 Str. 2176
89 Str. 2177
90 Str. 2178, 2
91 Str. 2182, 2-3
92 Str. 2180, 3-4
93 Str. 2183, 4
94 Str. 2183, 1-2
95 Vgl. Str. 2184ff.
96 Vgl. Str. Str. 2188f.
97 Splett, S. 94
98 Str. 2195
99 Str. 2196
100 Splett, S. 95
101 Naumann, S. 387
102 Naumann, S. 393
103 Naumann, S. 393
104 Splett, S. 97f.
105 Splett, S. 100
106 Str. 2262ff.
107 Hoffmann, S. 48
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text ist eine umfassende Analyse der Figur Rüdiger von Bechelaren im Nibelungenlied. Er untersucht Rüdigers Beziehungen zu Etzel und den Burgunden, seine Parteibindungen, seine Gewissenskonflikte und seinen Tod.
Was sind Rüdigers Beziehungen zu Etzel?
Rüdiger ist ein Lehnsmann Etzels, der sich in Wien als Flüchtling in Etzels Dienste begeben hat. Er fungiert als Etzels Berater und Brautwerber für Kriemhild.
Wie ist Rüdigers Verhältnis zu den Burgunden?
Rüdiger pflegt eine tiefe Freundschaft und ein tiefes Vertrauensverhältnis zu den Burgunden, das auf langer Bekanntschaft beruht. Er empfängt sie gastfreundlich in Bechelaren und geht mit ihnen verwandtschaftliche Beziehungen ein.
Welchen Eid schwört Rüdiger Kriemhild?
Rüdiger schwört Kriemhild, sie für jedes Leid zu entschädigen, das ihr widerfährt. Dieser Eid erweist sich als verhängnisvoll, da Kriemhild ihn zur Durchsetzung ihrer Rachepläne missbraucht.
Welche Gewissenskonflikte erlebt Rüdiger?
Rüdiger gerät in einen Gewissenskonflikt zwischen seiner Lehnspflicht gegenüber Etzel und seiner Freundschaft und Verwandtschaft zu den Burgunden. Er versucht, den Konflikt durch Schlichtungsversuche zu lösen, scheitert aber.
Wie versucht Rüdiger, dem Kampf zu entgehen?
Rüdiger versucht zunächst, sich aus den Kampfhandlungen herauszuhalten. Er argumentiert, dass er den Burgunden Geleitschutz versprochen hat und dass er seinen Eid gegenüber Kriemhild nicht brechen darf, ohne sein Seelenheil zu gefährden.
Wie entscheidet sich Rüdiger schließlich?
Nach langem Zögern entscheidet sich Rüdiger, für Etzel und Kriemhild zu kämpfen, obwohl er weiß, dass dies seinen Tod bedeuten wird. Er wägt sein Seelenheil gegen seine Lehnspflicht ab.
Was geschieht im Kampf gegen die Burgunden?
Im Kampf gegen die Burgunden übergibt Rüdiger Hagen seinen Schild und beweist damit seine Treue. Er stirbt schließlich im Zweikampf gegen Gernot.
Welche Bedeutung hat Rüdigers Tod?
Rüdigers Tod symbolisiert das Scheitern höfisch-ritterlicher Werte in einer Welt des Konflikts und der Rache. Er stirbt als tugendhaftester Mann in einer ausweglosen Situation.
Welche Primär- und Sekundärliteratur wird im Text verwendet?
Primärliteratur: "Das Nibelungenlied". Sekundärliteratur: Werke von de Boor, Gosse, Heinzle, Hoffmann, Nagel, Naumann, Schulze und Splett.
- Quote paper
- Andreas Harlander (Author), 2000, Rüdiger von Bechelaren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97831