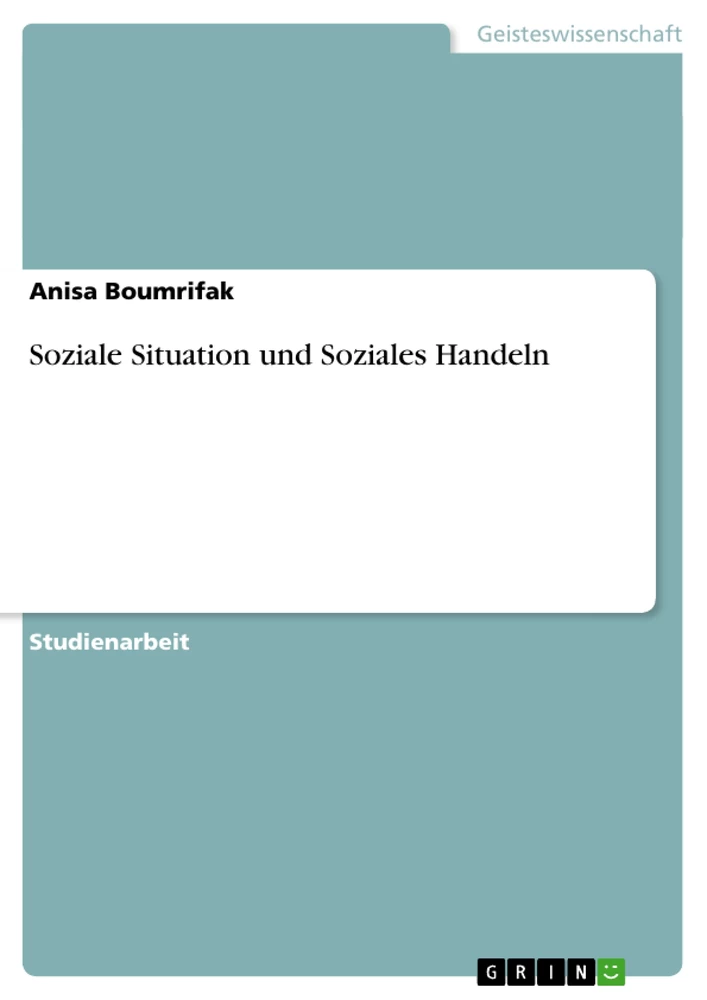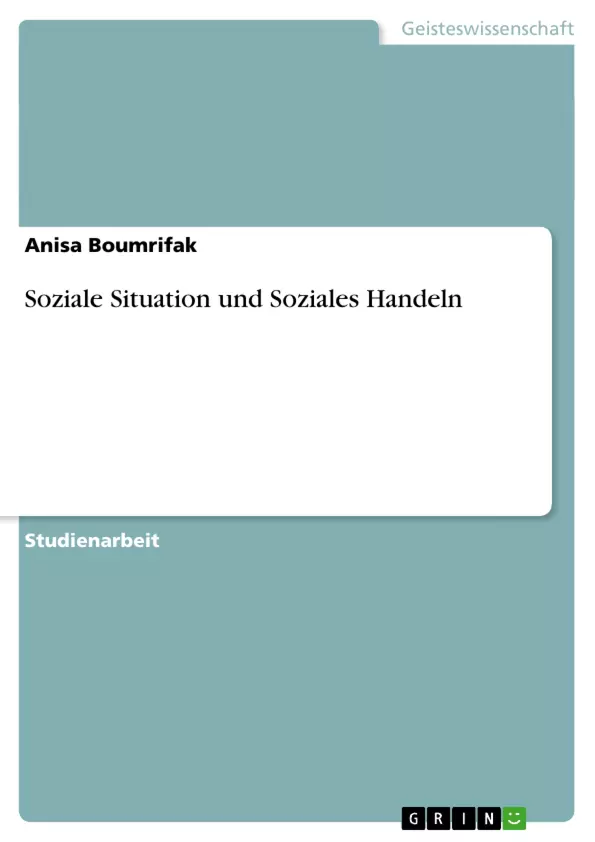Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
2. Menschenbilder
2.1. Was sind Menschenbilder?
2.2. Die Bedeutung von Menschenbildern
2.3. Menschenbilder in der Betriebswirtschaft und den Managementwissenschaften
2.3.1. Explizite Menschenbilder in der Betriebswirtschaftlehre
2.3.2. Implizite Menschenbilder in der Betriebswirtschaftslehre
2.4. Schlussfolgerung für das betriebswirtschaftliche Menschenbild
3. Der faktortheoretische Ansatz
3.1. Das Faktorsystem – Grundlage des faktortheoretischen Ansatzes
3.2. Einbettung in den historischen Kontext: Technisierung und Taylorismus
3.2.1. Historische Rahmenbedingungen und Lebensumstände
3.2.2. Grundsätze der wissenschaftlichen Betriebsführung
3.3. Merkmale und Eigenschaften des faktortheoretischen Ansatzes
3.3.1. Der dispositive Faktor
3.3.2. Der Faktor Arbeit
3.3.3. Betriebsmittel
3.3.4. Werkstoffe
3.4. Bedeutung für die heutige Betriebswirtschaftlehre
3.5. Das Menschenbild im faktortheoretischen Ansatz
3.5.1. Herleitung des Menschenbildes der Faktorentheorie
3.5.2. Der Homo oeconomicus
4. Die Ressourcentheorie
4.1. Problematik und Konzeptualisierung des Begriffs Human Resource Management
4.2. Historische Wurzeln und Entwicklung des Resource-based view und des Human Resource Management
4.3. Merkmale und Eigenschaften der Ressourcentheorie
4.3.1. Der Begriff der ‚Strategie‘ und die Ausrichtung des HRM
4.3.2. Abhängigkeit von anhaltenden Wettbewerbsvorteilen
4.3.3. Ressourcen als Mittel zur Erreichung von anhaltenden Wettbewerbsvorteilen
4.4. Das Menschenbild im ressourcentheoretischen Ansatz
4.4.1. Herleitung des Menschenbildes im ressourcentheoretischen Ansatzes
4.4.2. Das Menschenbild im ressourcentheoretischen Ansatz
5. Vergleich
5.1. Vergleich des faktortheoretischen Ansatzes und der Ressourcentheorie
5.2. Vergleich des homo oeconomicus mit dem Menschenbild der Ressourcentheorie
5.3. Vergleich durch Einbettung in die Theorie X und Y
6. Schlussfolgerung
7. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Heutzutage fällt in Bezug auf Mitarbeiter oftmals der Begriff der Humanressourcen oder des Humanpotentials, was darauf zurückzuführen ist, dass die Abhängigkeitsverhältnisse sich im Laufe der Zeit gewandelt haben (vgl. Staehle 1989, S. 388). Die sprachliche Wandlung zeigt eine erhöhte Wertschätzung des Personals und die Anerkennung zu einem strategischen Erfolgsfaktor des Unternehmens. Das Denken über den Menschen ist eine essentielle Voraussetzung für unser soziales Leben. Damit in Verbindung steht die Frage der menschlichen Freiheit und worin diese besteht. Die Ökonomie stellt sich als Reich der Notwendigkeit dar (vgl. Woll 1994, S. 5). Es stellt sich also die Frage, wie viel Freiheit zu gestatten bzw. zu verbieten ist, um diese Notwendigkeit zu erfüllen und ob diese absolut zu klären ist oder an gewissen Umständen festgemacht werden muss. Deswegen wird in der folgenden Abhandlung beschrieben, inwiefern Menschenbilder die Wirtschaft und Ausübung von Erwerbstätigkeiten beeinflussen. Weiterhin soll geklärt werden, welche ökonomischen Gegebenheiten vorliegen müssen, damit gewisse Menschenbilder geschaffen werden. Die Frage nach der Freiheit soll hierbei allgegenwärtig sein. Die mögliche Freiheit des Denkens, des Handelns, der Autonomie etc. spielen in diesen Menschenbildern eine große Rolle. „Jede Entscheidung im Management beruht auf Theorie“ (McGregor 1973, S. 18) und damit beruht jeder Akt im Management auf Voraussetzungen, Verallgemeinerungen und Hypothesen, die häufig implizit sind. Theorie und Praxis untrennbar miteinander verbunden, weil die Annahme A, welche die Theorie darstellt, zum Verhalten B führt, was für die Praxis steht. Der Manager hat gewisse Vorstellungen von seinen Mitarbeitern, welche beeinflussen, wie er sich im Umgang mit ihnen verhält (vgl. Schein 1980, S. 77). Der Wirkungsgrad seiner Arbeit definiert sich durch die Überschneidung von Annahme und empirisch überprüfter Wirklichkeit. Um diese Tatsachen an zwei Beispielen sichtbar zu machen werden der Faktoransatz nach Erich Gutenberg und die Ressourcentheorie, dessen Ursprünge auf Edith Penrose zurückgehen, genauer betrachtet und verglichen. Das Ziel ist es, diese beiden Theorien als zwei divergente Punkte auf dem Spektrum der möglichen Menschenbilder im Managementbereich vorzustellen, um die unterschiedlichen Annahmen auf denen sich das Führungsverhalten von Managern begründet darzulegen. Daraus soll ein Vergleich gezogen werden, der die beiden Theorien und ihre jeweiligen Menschenbilder in ein Verhältnis einordnet, um zu hinterfragen, ob möglicherweise eine Diskrepanz zwischen dem Verhältnis der Theorien und dem Verhältnis der Menschenbilder existiert. Zudem demonstrieren die Vorstellung und der anschließende Vergleich, inwiefern die Menschenbilder in den Managementwissenschaften durch ihren jeweiligen Zeitgeist beeinflusst wurden, was sie über ihre Zeit ausdrücken und warum es nicht ein universelles Menschenbild geben kann. Zu diesem Zwecke wird zu Beginn ein allgemeines Verständnis von Menschenbildern hergestellt. Das zweite Kapitel beschreibt, was Menschenbilder sind, sowie welchen Sinn und welche Bedeutung sie haben. Nachdem dieses Verständnis hergestellt wurde, soll im dritten Kapitel genauer auf den faktortheoretischen Ansatz eingegangen werden. Hierfür wird das Faktorsystem zuerst kurz vorgestellt, um anschließend die historischen Gegebenheiten zu betrachten, unter welchen es entstand. Darauf folgt eine detaillierte Beschreibung der Eigenschaften und Merkmale des faktortheoretischen Ansatzes, was von Bedeutung ist, um später in diesem Kapitel ein Menschenbild zu formulieren. Bevor dies geschieht, soll jedoch noch die heutige Bedeutung des Faktoransatzes kurz dargelegt werden. Das vierte Kapitel, welches sich mit der Ressourcentheorie befasst, ist ähnlich aufgebaut. Auch hier wird zu Beginn ein kurzer Überblick zur Thematik gegeben, um mit der Einbettung in den historischen Kontext fortzufahren. Anschließend werden die Besonderheiten und Merkmale der Ressourcentheorie beschrieben, um daraus ein Menschenbild extrahieren zu können. Das fünfte Kapitel vergleicht die beiden zuvor beschriebenen Theorien und erarbeiteten Menschenbilder. Der erste Teil geht dabei ausschließlich auf die Theorien ein, während sich der zweite Teil den Menschenbildern widmet. Außerdem wird eine Positionierung und Polarisierung der beiden Menschenbilder und Theorien vorgenommen, indem sie mit weiteren Menschenbildern verglichen werden. Das sechste Kapitel fasst die wichtigsten Erkenntnisse kurz zusammen und beschreibt, in welcher Lage sich die Theorien zueinander befinden. Hier wird das Wesen der Theorien und damit ihrer Menschenbilder wiedergegeben, um ein Resümee zu bilden.
2. Menschenbilder
Im Folgenden wird, wie bereits beschrieben, explizit auf Menschenbilder eingegangen, um ein allgemeines Verständnis herzustellen, was notwendig ist, um zu einem späteren Zeitpunkt die Menschenbilder aus den jeweiligen Theorien bilden zu können. Dabei befasst sich diese Abhandlung zuerst mit allgemeinen Menschenbildern und anschließend mit den Menschenbildern in den Managementwissenschaften, was speziell für zu behandelnden Theorien von besonderer Wichtigkeit ist.
2.1. Was sind Menschenbilder?
Zu allen Zeiten haben sich die Menschen Bilder über das eigene Wesen und dessen Positionierung in der Welt gemacht. Die Problematik dabei ist die Abhängigkeit der Interpretation und Erfassung des Wesens von unterschiedlichen Voraussetzungen, um differenzierte Eigenschaften zu finden, die den Menschen bestimmen. Aus diesem Grunde enthalten z.B. Religionen, Kulturen, aber auch Wissenschaftsdisziplinen explizite oder implizite Bilder des Menschen, die aus Spekulationen, Erkenntnissen oder Zielvorgaben über dessen Wesen entstehen, auch wenn sie in ihren Annahmen nicht übereinstimmen (vgl. Gehlen 1993, S. 3). Menschenbilder dienen der Typologisierung von Menschen, die durch „Abstraktion und Verallgemeinerung die Vielfalt von real existierenden Wesensmerkmalen, Wesensinhalten und Verhaltensmustern für die jeweilige Person“ (Weinert 1995, S. 1498) vereinfacht. Durch die Vereinfachung sind Menschenbilder nicht mit der Realität identisch. Allgemein bestimmt ist also ein Menschenbild „eine bestimmte Vorstellung über den Menschen, die aus Annahmen und/oder Erkenntnissen zu seinem Wesen besteht.“ (Hesch 2000, S. 6). Es lassen sich drei Erscheinungsformen herausstellen (vgl. Wiswede 2000, S. 38f.). Menschenbilder können subjektive Beschreibungen oder Interpretationen sein. Sie sind dann implizite Theorien, wenn sie der Erklärung und Deutung des Verhaltens dienen. Weiterhin können Menschenbilder Ideale darstellen, die eine Vorbildfunktion erfüllen. Zuletzt spielen sie in wissenschaftlichen Paradigmen eine große Rolle. Sie können in diesen Theorien implizit in normativen Aussagen enthalten sein oder als explizite Vorannahmen dienen, um die Grundlage für weitere Ausführungen darzustellen (vgl. Conrad 2000, S. 2).
2.2. Die Bedeutung von Menschenbildern
Menschenbilder sind allgegenwärtig. Dies ist daran zu erkennen, dass ihre Annahmen über das Wesen des Menschen die Grundlage für alle Staatsformen und Verfassungen sind und dadurch alle sozialen Gefüge und Systeme geprägt werden (vgl. Hesch 2000, S. 6). Deswegen beschäftigte die Frage nach dem Menschenbild im Laufe der Zeit Philosophen und Wissenschaftler, aber auch Staatsleute auf der ganzen Welt. Betrachtet man die bislang aufgestellten Menschenbilder, dann fällt auf, dass sie sich lediglich auf die Aspekte beziehen, die für ihre Thematik relevant sind. Daraus folgt, dass weder die Philosophie, noch die Psychologie, Soziologie, Medizin, Biologie oder Theologie eine vollständige Erklärung des Menschen vorgenommen hat, sondern nur Teile eines Mosaiks geschaffen hat. Die Aufgabe, „den Menschen darzustellen, ist oft schwer, oft versucht worden, aber doch wohl nie gelungen“ (Gehlen 1993, S. 6). Auch mit einer stärkeren Einbeziehung von Hirnforschung, Verhaltenstheorie und Kybernetik wird das o.g. Rätsel kaum zu lösen sein. So zeigen die Erkenntnisse über den Menschen die Grenzen des Wissens auf allen Wissenschaftsgebieten auf. Diese Ausführungen stellen die Komplexität und Universalität der Thematik der Menschenbilder dar. Gleichzeitig fällt auf, dass sie eigentlich nicht zum Erkenntnisbereich der Betriebswissenschaft gehören. Dennoch haben Menschenbilder für die Organisations- und Managementwissenschaften eine herausragende Bedeutung. Das folgende Kapitel soll darüber Aufschluss geben. Für weitere Informationen über die Komplexität, das Entstehen und die Merkmale von Menschenbildern können die Schriften von Maturana und Varela zu Rate gezogen werden1.
2.3. Menschenbilder in der Betriebswirtschaftslehre und den Managementwissenschaften
Menschenbilder vermitteln Grundannahmen „über Ziele, Motive, Bedürfnisse und Erwartungen über Verhaltensweisen“ (Conrad 2000, S. 3), die Mitarbeiter und Vorgesetzte in ihrem Denken, Entscheiden und Handeln beeinflussen. Die konsequente sozial- und verhaltenswissenschaftliche Öffnung der Betriebswirtschaftslehre, die gegen Ende der 60er Jahre einsetzte (vgl. Raffée 1993, S. 25.f), sorgte dafür, dass der Begriff des Menschenbildes in der neueren Literatur verwendet wurde. Dennoch lässt sich selbst in der Disziplin der Betriebswirtschaftslehre nicht von einer einheitlichen Begriffsbestimmung sprechen. Die folgende Übersicht verdeutlicht diese Aussage:
„Beim Menschenbild handelt es sich um die Annahmen darüber, was der Mensch ist: welche Bedürfnisse er hat und welche Ziele er verfolgt, was sein Rang ist in der Welt und welches sein Verhältnis zu den Mitmenschen, was sein Denken und sein Handeln bestimmt und wo seine Grenzen liegen“ (Werhahn 1980, S. 10).
„Menschenbilder sind vereinfachte und standardisierte Muster von menschlichen Verhaltensweisen, die Personen im Laufe der Zeit glauben lokalisieren zu können“ (Scholz 2000, S. 117).
„Wir sprechen hier von Menschenbildern, um damit auszudrücken, daß es sich um eine Typologisierung vom Menschen handelt, um Theorien, die implizit entwickelt, aufgestellt und später verfestigt wurden. Sie sollen dazu dienen, durch Abstraktion und Verallgemeinerung die Vielfalt von real existierenden Wesensmerkmalen, Wesensinhalten und Verhaltensmuster für die jeweilige Person überschaubar zu machen, zu vereinfachen und zu ordnen“ (Weinert 1995, S. 1497f.).
Diese Auswahl, die zudem noch sehr klein ist, soll demonstrieren, dass die unterschiedlichen Auffassungen ein weites Spektrum aufweisen. Dennoch lassen sich Menschenbilder in unterschiedliche Arten und Funktionen unterteilen. Als Systematisierung soll zunächst der Unterschied zwischen expliziten und impliziten Menschenbildern dienen.
2.3.1. Explizite Menschenbilder in der Betriebswirtschaftslehre
Explizite Menschenbilder werden deutlich und offen dargelegt. Die Annahmen über den Menschen sind essentieller Bestandteil des jeweiligen Paradigmas und dessen Hauptinhalt. Eine Form der expliziten Menschenbilder stellen die spekulativen Persönlichkeitstheorien dar. Sie basieren weitestgehend auf den subjektiven Mutmaßungen und sind nicht empirisch fundiert. Dennoch können sie von großer Bedeutung für die Theorieentwicklung sein. Diese expliziten Menschenbilder gehen dennoch auf vorherrschende Annahmen von Managern zurück, die in Typologien zusammengefasst werden (vgl. Hesch 2000, S. 28). Am bekanntesten für diese Form von Menschenbildern sind die Theorien X und Y von McGregor (1960) und die Menschenbild-Typologien von Schein (1980). Im Gegensatz dazu können empirische Persönlichkeitstheorien genannt werden, die sich mit der wissenschaftlichen Fundierung spekulativer Persönlichkeitstheorien befassen. Weinert begründete die empirische Vorgehensweise damit, dass „eine große Zahl von allgemeinen Annahmen über die Natur des Menschen (…) nach subjektivem Ermessen“ (Weinert 1984, S. 30) zusammengefasst werden. Es wurde also kein Versuch unternommen, eine systematische Bestätigung der Annahmen über die Vorstellungen von Führungskräften über Mitarbeiter vorzunehmen. Eine dritte Form expliziter Menschenbilder stellen die sogenannten Menschenbild-Typologien dar, die sich aus empirischen Untersuchungen ergeben, welche aus impliziten Theorien abgeleitet wurden (vgl. Hesch 2000, S. 29). Das wohl bekannteste Beispiel für eine Menschenbild-Typologie sind die Managertypen nach Maccoby (1977). Während seinen psychoanalytischen Untersuchungen zwischen 1969 und 1975, in denen er 250 Manager unterschiedlicher amerikanischer Unternehmen charakterisierte, indem er die Tätigkeit, die Einstellung und das Verhalten erfasste, konnte er eine Unterscheidung in vier Managertypen feststellen: den Fachmann, den Firmenmenschen, den Dschungelkämpfer und den Spielmacher. Jeder Typ legt andere Charaktereigenschaften an den Tag, die das Unternehmen anders beeinflussen. Nach Maccobys Managertypologie brauchen Unternehmen primär Spielmacher, aber auch Firmenmenschen und Fachmänner, wohingegen sie auf Dschungelkämpfer verzichten können. Zuletzt sind noch Menschenbilder zu erwähnen, die keinen empirischen Untersuchungen entspringen, sondern Annahmen über wünschenswertes Verhalten und zu erreichende Fähigkeiten darstellen. Diese Leitbilder werden nach den Anforderungen konzipiert, welche das Unternehmen gegenwärtig und wahrscheinlich zukünftig an seine Mitarbeiter stellt (vgl. Hesch 2000, S. 30f.). Jegliche Handlungen und Strukturen sollen sich an den gestellten Idealen ausrichten. Leitbilder erfüllen also eine Orientierungsfunktion. Weiterhin entwerfen sie einen Zukunftsfit für die Unternehmensentwicklung und steuern einen Beitrag zur Sinnstiftung bei. Sie dienen der Motivation, der Verhaltensentwicklung und prägen das Charakterbild der Unternehmung (vgl. Bleicher 1992, S. 21f.). Diese expliziten Menschenbilder, die ein Ideal darstellen, sind die Grundlage der Führungsphilosophie eines Unternehmens, welche dessen Einstellungen, Wertehaltungen und Führungsgrundsätze sowie Konzepte beinhalten. Zusammengefasst dienen Leitbilder der Beeinflussung der subjektiven Wertehaltungen von Führungskräften und Mitarbeitern durch die spezifische Charakteristik und die Situation des Unternehmens.
2.3.2. Implizite Menschenbilder in der Betriebswirtschaftslehre
Implizite Menschenbilder werden bei der Formulierung einer These für gewöhnlich nicht besonders betont, weil Wissenschaftler bei der Theoriebildung von ihnen ausgehen. Hesch bezeichnet sie deswegen auch in Anlehnung an die Psychologie als „verborgene Menschenbilder der betriebswirtschaftlichen Theorie“ (2000, S. 32). Als mögliche Ansätze, um verborgener Menschenbilder‘ sichtbar zu machen, können die Arbeiten von Staehle (1975) und Werhahn (1980) erwähnt werden. Die Menschenbilder stehen hier über der Theorie und gelten als latent, weswegen sie nicht ausdrücklich erwähnt werden müssen, um Basiswerturteile aufzufassen. Dies macht deutlich, dass objektiv wirkende Theorien dennoch durch ein subjektives Werturteil vorgeschaltet werden. Diese Menschenbilder werden innerhalb der Theorie nicht mehr hinterfragt und gelten als selbstverständlich. So wird die „Objektivität auf die Subjektivität (…) reduziert“ (Staehle 1975, S. 722). Ebenfalls zu den impliziten Menschenbildern gehören Theorien die Führungskräfte und Mitarbeiter während der Ausübung ihrer Tätigkeit für sich selbst kreieren. Diese Persönlichkeitstheorien der Praxis werden in der Unternehmung bei Interaktionen mit den Mitmenschen zu Rate gezogen, aber auch beeinflusst. Diese Menschenbilder entstehen, ähnlich wie die theoretischen Konstrukte der Wissenschaft, durch die Aktionen der Personen, die diese Menschenbilder ursprünglich geschaffen haben oder aus der Ableitung der Leitbilder. Sie sind nötig, um die Komplexität der Gesamtheit der Menschen in der Unternehmung zu ordnen und damit zu vereinfachen.
„Jeder Manager hat eine bestimmte Vorstellung von seinen Mitmenschen. Unabhängig davon, ob er sich dieser Tatsache überhaupt bewußt wird, bestimmen diese Annahmen und Vorstellungen maßgeblich, wie er sich im Umgang mit seinen Vorgesetzten, Kollegen und Untergebenen verhält. Seine Effizienz als Manager hängt davon ab, in welchem Maß seine Annahmen mit der empirischen überprüften Wirklichkeit übereinstimmen“ (Schein 1980, S. 77).
Implizite Persönlichkeitstheorien sind also besonders für die betriebliche Praxis relevant.
2.4. Schlussfolgerung für das betriebswirtschaftliche Menschenbild
Die zuvor vorgenommene Spezialisierung demonstriert die vielseitige Bedeutung des Menschenbildes in der Betriebswirtschaftslehre. Oftmals wird in der Literatur auf diese Unterscheidung verzichtet und es wird universell von einem Menschenbild gesprochen. Es lässt sich nun also festhalten, wie der Begriff Menschenbild in der Betriebswirtschaftslehre für diese Abhandlung zu definieren ist:
„Ein betriebswirtschaftliches Menschenbild läßt sich begreifen als subjekt-abhängiges Abbild vom Menschen in der betrieblichen Praxis. Es basiert auf impliziten oder expliziten Annahmen über den Menschen und liegt betriebswirtschaftliche Theorien und/oder menschlichen Interaktionen in der betrieblichen Praxis zugrunde.“ (Hesch 2000, S. 34)
Dem Wandel von Menschenbildern in betriebswirtschaftlichen Systemen geht immer ein Wandel der philosophischen Menschenbilder voraus, denen eine gesellschaftliche Veränderung zugrunde liegt. Die Betriebswirtschaft reflektiert damit die Entwicklungen und Eingebungen der jeweiligen Zeit. Dadurch wird eine Rechtfertigung der jeweiligen Organisationskonzepte erreicht (vgl. Schein 1980, S. 77). Für die weitere Vorgehensweise ist zu erwähnen, dass die Theorien, dessen Menschenbilder verglichen werden sollen, also der faktortheoretische Ansatz und die Ressourcentheorie, implizite bzw. verborgene, Menschenbilder enthalten. Sie werden also nicht durch die Theorie an sich offengelegt, sondern bilden einen nicht sichtbaren Ausgangspunkt, von dem die Theorie konzipiert wurde. Dies bedeutet für die Vorgehensweise, dass es wichtig ist, sich einen ausführlichen Überblick über die beiden Theorien zu verschaffen, um die Merkmale der jeweiligen Menschenbilder bestimmen zu können. Die folgenden beiden Kapitel beschreiben die Organisationstheorien und arbeiten das jeweilige Menschenbild heraus.
3. Der faktortheoretische Ansatz
Mit seinem Werk ‚Einführung in die Betriebswirtschaftslehre‘ ordnete Erich Gutenberg2 die Betriebswirtschaftslehre nach dem zweiten Weltkrieg von Grund auf neu. Er etablierte betriebliche Teilbereiche, stellte mathematische Funktionen für die Kostenrechnung auf und führte Instrumente der Absatzpolitik ein. Dieses Kapitel wird sich ausschließlich mit dem faktortheoretischen Ansatz befassen.
3.1. Das Faktorsystem – Grundlage des faktortheoretischen Ansatzes
Gutenbergs Faktorsystem begründet sich auf der Annahme, dass sich der gesamtbetriebliche Prozess aus Arbeitsleistungen und maschinellen Gerätschaften zusammensetzt, um entweder Sachgüter oder Dienstleistungen zu produzieren. Diese sogenannten Betriebsmittel bezeichnet er als „Elementarfaktoren der betrieblichen Betätigung“ (Gutenberg 1990, S. 28). Gerade im Fabrikationsprozess werden zudem Rohstoffe, Hilfsstoffe oder Verbrauchsmaterialien benötigt, um die Produktion anzutreiben. Diese Werkstoffe werden als dritter Elementarfaktor deklariert. Nach Gutenberg bedarf es jedoch weiterhin einer Instanz, nach dessen Grundsätzen die betriebliche Leistungserstellung und Verarbeitung vonstatten gehen muss. Diese koordiniert und kombiniert die Elementarfaktoren, leitet damit den Prozess der Fertigung und legt Prinzipien, wie z.B. eine möglichst effiziente oder wirtschaftliche Zielerreichung, fest. Der sogenannte ‚dispositive Faktor‘ gliedert sich in drei Faktoren, nämlich in Leitung, Planung und Organisation. Verfehlt er seine Aufgabe, kann kein betrieblicher Prozess zustande kommen. Der dispositive Faktor wird den Elementarfaktoren also gegenübergestellt. Planung und Organisation sind also derivative Faktoren der Geschäftsleitung, wobei der rationale Teil der Unternehmensleitung durch die Planung und die Realisierung des Geplanten durch die Organisation ausgedrückt wird (vgl. Werhahn 1980, S. 69).
3.2. Einbettung in den historischen Kontext: Technisierung und Taylorismus
Laut Wächter gehen Gutenbergs betriebswirtschaftliche Ansätze auf Theorien zurück, die bereits Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt worden sind (vgl. Wächter 1979, S. 58). Das ‚Scientific Management‘, auch als ‚wissenschaftliche Betriebsführung‘ bekannt, geht auf den amerikanischen Ingenieur Frederick W. Taylor zurück und bildet eine essentielle Betrachtungsweise der menschlichen Arbeit des 20. Jahrhunderts. Aus dessen Umsetzung und Wirkung entwickelte sich das Taylor-System, das auch als Taylorismus bezeichnet wird. Taylor ging den Problemen des Arbeitsvollzuges nach und entwickelte nach Betrachtung von Arbeitskräften und menschlichen Arbeitsleistungen Rationalisierungsmöglichkeiten, die aus einem gut organisierten und strukturierten Arbeitssystem hervorgehen können. Bis heute bleiben die Beobachtungen und Errungenschaften Taylors Grundbausteine der heutigen Industrie, ohne die unsere heutige Arbeitswelt nicht zu verstehen wäre.
3.2.1. Historische Rahmenbedingungen und Lebensumstände
Sowohl für Taylor als auch für Gutenberg spielen die technologischen Umwälzungen in den Vereinigten Staaten und Europa ab der Mitte des 19. Jahrhunderts eine entscheidende Rolle. Durch das industrielle Wachstum und der damit verbundenen Transformation von Produktionsprozessen wurden auch neue Anforderungen an Führungs- und Managementaufgaben gestellt. Parallel zu diesen technischen Neuerungen transformierten sich die zuvor hauptsächlich landwirtschaftlich orientierten Nationen zu treibenden Industriestaaten, sogar zu Industriemächten (vgl. Hebeisen 1999, S. 13), was sich durch eine eindrückliche Verschiebung vom primären zum sekundären und teilweise zum tertiären Sektor ausdrückt. So entstanden aus Handwerkern und Bauern Industrieheere, die in den meisten Fällen ungewohnte und auch unnatürliche Arbeitsinhalte verrichten müssen (vgl. Staehle 1999, S. 12). Gerade Gutenberg kam als Sohn eines Fabrikanten bereits in jungen Jahren unmittelbar mit den seit der Industrialisierung veränderten Arbeitsbedingungen und den damit verbundenen Problemen in Kontakt. Obwohl sein persönliches Interesse eher den naturwissenschaftlichen Fächern galt, folgte er der Bitte seiner Familie, sich um die Firma des verstorbenen Vaters zu kümmern und begann im Sommer 1919 ein nationalökonomisches Studium (vgl. Gutenberg 1989, S. 6). Doch das junge Fach der Betriebswirtschaftlehre, wie wir es heute kennen, entstand gerade erst. Der erste Weltkrieg und der mit der Niederlage der Deutschen verbundene Inflation zwang die Vertreter des Faches der Nationalökonomie dazu, nach Auswegen zu suchen, um das Rechnungswesen der Unternehmen, was nun völlig funktionslos war, wiederherzustellen. Aus diesem Grunde führte der Wertverlust der deutschen Währung in den zwanziger Jahren zu einer regen Auseinandersetzung mit Bilanz- und Kostenproblemen, was eine rege Diskussion entfachte, die dafür sorgen sollte, dass in den darauffolgenden Jahren die Betriebswirtschaftslehre als eigene Wissenschaft deklariert und die grundlegenden theoretischen Fundamente gelegt wurden (vgl. Gutenberg 1989, S. 17f.). Die Fundamente der jungen Disziplin befassten sich jedoch ausschließlich mit der Thematik des Rechnungswesens, was ein gewisses Unwohlsein der jüngeren Generation, zu der auch Gutenberg gehörte, mit sich führte. Ihnen galt es, den Wirkungsradius der Betriebswirtschaftslehre über das Rechnungswesen hinaus auszuweiten (vgl. Gutenberg 1989, S. 19). So wurde also in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre versucht nach zusätzlichen Gebieten der wissenschaftlichen Betätigung und einem modifizierten Verständnis zu suchen, ohne dass die vor kurzem erstellten Fundamente hätten aufgegeben werden müssen. Für Gutenberg waren vor allen Dingen Schmalenbach und Schumpeter richtungsweisend. Schmalenbach sticht durch die Besonderheit seines methodischen Vorgehens in ‚Grundlagen der Selbstkostenrechnung und Preispolitik‘ aus dem Jahre 1925 hervor.
„Er löst aus dem großen Variablenzusammenhang, den ein Unternehmen darstellt, zwei Variablen heraus und richtet sein Interesse ausschließlich auf die Abhängigkeit, die zwischen diesen Variablen besteht. Das war neu in der Betriebswirtschaftslehre und für mein wissenschaftlichen Anliegen von großen Interesse.“ (Gutenberg 1989, S. 25)
Gutenberg nahm diesen wissenschaftlichen Ansatz für sich an und versuchte diesen weiterzuentwickeln. Sein Ziel war es, die anderen bestehenden Abhängigkeiten der Variablen des Systems zu bestimmen, um Erkenntnisse über die Gesamtheit des betrieblichen Variablensystems zu gewinnen. Ein weiteres Werk, welches Gutenbergs betriebswissenschaftliche Denkweise beeinflusste, war ‚Wesen und Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie‘ von Joseph Schumpeter. Dieses Buch greift auf das mathematisch formulierte System von Léon Walras zurück. Schumpeter begeht den Versuch eine Volkswirtschaft zu definieren, in der „jedes Wirtschaftssubjekt im Besitze bestimmter Quantitäten bestimmter Güter ist“ (Gutenberg 1989, S. 26). Diese ökonomischen Quantitäten sind Elemente des Systems, die in gegenseitiger Abhängigkeit voneinander bestehen. Durch Schmalenbach und Schumpeter wurde Gutenberg auf seiner Suche nach weiteren Grundgebieten der Betriebswirtschaftslehre vorangetrieben und in seinen Ideen der Wissenschaftlichkeit, die über das betriebliche Rechnungswesen hinausgingen, bestärkt. Durch die Theorien von Schmalenbach wurde Gutenberg auf die Idee gebracht, dass sich der Gesamtzusammenhang des Betriebes durch die Interaktion einzelner Variablen, die er später als Faktoren deklariert, erklären lässt. Schumpeter demonstriert, dass diese Variablen in mathematischen Abhängigkeiten zueinander stehen. Nämlich insofern, dass die Veränderung einer Variable nicht für sich zu betrachten ist, sondern dass die Veränderung eines Elements alle anderen Elemente beeinflusst. Demnach ist also eine Bestimmbarkeit gewisser Variablen gegeben, falls die Größen anderer Variablen bekannt sind. Diese Grundtheorien sollten wir uns vor Augen führen, wenn wir den faktortheoretischen Ansatz Gutenbergs verstehen möchten.
3.2.2. Grundsätze der wissenschaftlichen Betriebsführung
Die Grundsätze des Taylorismus, die ihren Ursprung in der wissenschaftlichen Betriebsführung finden, sind insofern von Bedeutung, dass sie uns helfen die Ausführungen Gutenbergs vor dem damaligen Zeitgeist und den betriebswissenschaftlichen Anforderungen zu betrachten. Es stellt sich nun die Frage, worin die Unterschiede des Taylorismus zu einem gewöhnlichen Betriebssystem liegen und wie damit bessere Erfolge erzielt werden können (vgl. Taylor 1913, S. 37). Die nun erwähnten Prinzipien des Taylorismus gehen näher auf diese Fragen ein. Wächter fasst die grundsätzlichen Gedanken zur Effizienzsteigerung Taylors in fünf Punkten zusammen, die hier als Anhalt gelten sollen (1979, S. 61). Zum Zwecke der Leistungssteigerung sollen die Arbeiter von den Ingenieuren durch eine Einwegkommunikation mit festgelegten, aber detaillierten Inhalten angewiesen werden. Menschliche Eigenarten und Verhaltensweisen gelten hierbei als nicht erwünscht, sowie als hinderlich. Dieses mechanistische Menschenbild setzt voraus, dass die Vorarbeiter ihre Untergebenen wie Maschinen behandeln. Die Planung, Vorbereitung und Organisation der Arbeit ist strikt von ihrer Ausführung zu trennen. In diesem Punkt gleichen sich das System Taylors und Gutenbergs. Es folgt eine Unterteilung der Arbeit in einen produktiven und einen dispositiven Faktor, wobei die ausführende Arbeit von leicht ersetzbaren, ungelernten bzw. angelernten Arbeitern zu verrichten ist, wohingegen die Planung von der Unternehmensleitung bis hin zu speziell ausgebildeten Ingenieuren übernommen werden soll. Man spricht hier von einer Trennung von Kopf- und Handarbeit (vgl. Hebeisen 1999, S. 119). Leistungsanreize werden im Taylorismus ausschließlich in monetärer Form dargeboten. Taylor hielt den Akkordlohn in seiner Reinform für das gerechteste Anreizsystem, das der menschlichen Natur am ehesten zukommt. Dies sei auch gerechtfertigt, solange der Arbeiter dem Geld eine ebenso hohe Priorität beipflichtet wie sein Arbeitgeber. Auch wenn die bisher erwähnten Grundsätze aus der heutigen Perspektive unmenschlich auf uns wirken (vgl. Wächter 1979, S. 63), so muss gesagt werden, dass Taylor sein System sowohl zum Wohle des Unternehmers, als auch zum Wohle des einzelnen Arbeiters verstanden hatte. In ‚Die Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung‘ beschreibt er z.B., dass einer seiner Arbeiter, der zuvor immer zwölf Tonnen Roheisen umzuladen schaffte, durch den Akkordlohn und den Ansporn seines Vorarbeiters nun „47 t auf den Waggon verladen [hatte – d. Verf.]. (…) Er verdiente diese ganze Zeit hindurch etwas mehr als 1,85 Doll. durchschnittlich, während er vorher nie mehr als 1,15 Doll. täglich verdient hatte“ (Taylor 1913, S. 48). Dies bedeutet, dass der Arbeiter tatsächlich eine sechzig prozentige Lohnsteigerung erhält, während das Unternehmen für diesen Mehrkostenaufwand eine Leistungssteigerung von 280% erhält. Für diese Leistung hätte das Unternehmen ansonsten drei Arbeiter auszahlen müssen, was doppelt so teuer gewesen wäre. Ein weiteres Prinzip, was dem System Taylors zugrunde liegt, ist die Arbeitsteilung. Taylor trieb diese bis zu einem zuvor unbekannten Niveau voran. Für ihn war eine immer weitere Differenzierung der Arbeitsschritte mit einer Erhöhung der Effizienz verbunden. Nach Betrachtung dieser Prinzipien lässt sich bestätigen, dass die menschliche Arbeitskraft mit zunehmender Ähnlichkeit in Bezug auf Maschinen geeigneter für die Produktion erscheint. Die dargebotene Planbarkeit und Manipulierbarkeit durch die dispositive Komponente trägt Sorge dafür, dass jeder eigene Gedanke, jede individuelle Handlung unterdrückt wird, weil sie als störend empfunden wird, auch wenn dies durch Ersetzung der Arbeitskraft vollzogen wird (vgl. Wächter 1979, S. 63). Wie schon erwähnt, war dies jedoch nicht zum Nachteil des Mitarbeiters gedacht, sondern zum Vorteil von Unternehmen und Arbeitskraft. Dies trifft auch zu, wenn man bei beiden Akteuren von einer Interessensphäre ausgehen kann, nämlich ausschließlich der monetären, der Dimension der Einkommenssteigerung. Der Taylorismus soll hier nicht negativ dargestellt werden. Er ist ein Prinzip der Prozesssteuerung, welches den Rahmenbedingungen und Gegebenheiten seiner Zeit entsprang. Diese ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen, die Prinzipien und die Ausgangpunkte des Taylorismus sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir uns mit dem Produktionsfaktoren nach Gutenberg beschäftigen, weil sie auf dieses Denksystem zurückgehen.
3.3. Merkmale und Eigenschaften des faktortheoretischen Ansatzes
Die vorrausgehende Systematisierung in die vier Faktoren stellt nach Gutenberg das geschlossene System der Betriebswirtschaftslehre dar, die den zentralen Ausgangspunkt für die funktionale Produktivitätsbeziehung ausmacht (vgl. Jung 2006, S. 48). Hieraus ergibt sich die Grundproblemstellung, die Kombination der Elementarfaktoren möglichst ökonomisch zu gestalten. Zur Kalkulation dieser werden Faktoreinsatz und Faktorertrag miteinander ins Verhältnis gesetzt. Dies bedeutet, dass das übergeordnete Ziel die Wirtschaftlichkeit des Produktionsprozesses ist, und die optimale Faktorkombination eine Bedingung zum Erreichen dieses Zieles darstellt. Wenn sich Gutenberg in der ersten Auflage seiner ‚Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre‘ (1983, S. 266) durch Hilfestellung der ‚Komponente g‘ für das Ertragsgesetz ausspricht, was er später durch die ‚Produktionsfunktion vom Typ B‘ revidiert, bleibt zu beachten, dass der faktortheoretische Ansatz ursprünglich von einer möglichen Substitution der Produktionsmittel ausgegangen ist. Dies bedeutet, dass das Auswahlprinzip hier anfangs Anwendung fand, also dass Wirtschaftlichkeit nur dann erreicht werden könne, wenn die Wahlmöglichkeit mehrerer Faktorkombinationen gegeben sei. Es wird immer diejenige Faktorkonstellation realisiert, die eine bestimmte Produktionsleistung mit der geringsten Faktoreinsatzmenge erreicht (vgl. Gutenberg 1990, S. 31). In marktwirtschaftlichen Systemen, die kapitalistisch geprägt sind, wird Unternehmen eine relativ weite Autonomie eingeräumt, insofern dürfen die Unternehmer selbst über die Produktionspläne und die Durchführung der Produktion entscheiden. Gutenberg benennt drei Leitmaximen, die das Handeln der Unternehmensführung in solchen Systemen bestimmen (vgl. Gutenberg 1990, S. 43ff.). Eine der Hauptmaximen unternehmerischen Verhaltens ist das erwerbswirtschaftliche Prinzip, also Handlungen so zu begehen, dass die Investition über eine zeitliche Spanne hinweg und unter Abwägung aller Risiken und Beachtung aller Chancen einen möglichst hohen Gewinn erzielt. Die zweite Maxime ist das Prinzip der Wirtschaftlichkeit. Es hat nicht die absolute Bedeutung der ersten Maxime, ist aber dafür auch nicht vom Wirtschaftsystem abhängig. Die letzte allgemeine Maxime, die das Handeln der Verantwortlichen bestimmt, ist das finanzielle Gleichgewicht. Dieses Prinzip erfüllt den Zweck, die Gefahr abzuwenden, die Termine der Rückzahlung geliehenen Kapitals nicht mit den Terminen der Kapitalfreisetzung in Übereinstimmung bringen zu können, also drohende Spannungen im finanziellen Gefüge abzuwehren. Diese Illiquidität kann eventuell zum Zusammenbruch der Unternehmung führen.
[...]
1 Maturana, H.R. / Varela, F.J. (1987): Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens. Bern, München.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes "Inhaltsverzeichnis:"?
Der Text ist eine umfassende Sprachvorschau, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele und Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter umfasst. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Menschenbildern im Kontext der Betriebswirtschaftslehre.
Welche Hauptthemen werden im Inhaltsverzeichnis behandelt?
Die Hauptthemen sind: Menschenbilder (Definition, Bedeutung, in der Betriebswirtschaft), der faktortheoretische Ansatz, die Ressourcentheorie, ein Vergleich beider Ansätze und eine Schlussfolgerung. Außerdem gibt es eine Einleitung und ein Literaturverzeichnis.
Was sind Menschenbilder im Kontext dieses Textes?
Menschenbilder sind Vorstellungen über das Wesen des Menschen, die aus Annahmen und/oder Erkenntnissen bestehen. Sie dienen der Typologisierung von Menschen und sind Grundlage für soziale Gefüge und Systeme.
Welche Bedeutung haben Menschenbilder in der Betriebswirtschaftslehre?
Menschenbilder beeinflussen das Denken, Entscheiden und Handeln von Mitarbeitern und Vorgesetzten. Sie vermitteln Grundannahmen über Ziele, Motive, Bedürfnisse und Erwartungen.
Was ist der faktortheoretische Ansatz nach Erich Gutenberg?
Der faktortheoretische Ansatz basiert auf der Annahme, dass sich der betriebliche Prozess aus Arbeitsleistungen und maschinellen Gerätschaften (Betriebsmittel) zusammensetzt, um Güter oder Dienstleistungen zu produzieren. Weitere Faktoren sind Werkstoffe und der dispositive Faktor (Leitung, Planung, Organisation).
Was ist der historische Kontext des faktortheoretischen Ansatzes?
Der faktortheoretische Ansatz ist eng mit den technologischen Umwälzungen des 19. und 20. Jahrhunderts verbunden, insbesondere mit dem Taylorismus und der wissenschaftlichen Betriebsführung.
Was sind die Merkmale des Taylorismus?
Zu den Hauptmerkmalen des Taylorismus zählen die strikte Trennung von Planung und Ausführung, die Arbeitsteilung, die Fokussierung auf monetäre Leistungsanreize und die Betrachtung der menschlichen Arbeitskraft als austauschbare Komponente.
Was ist die Ressourcentheorie?
Die Ressourcentheorie (Resource-based view) und das Human Resource Management (HRM) stellen ein Konzept dar, in dem die Mitarbeiter als eine Ressource betrachtet werden. Hieraus wird ein Wettbewerbsvorteil des Unternehmens geschaffen.
Welche Rolle spielt der Homo oeconomicus im faktortheoretischen Ansatz?
Der Homo oeconomicus ist ein Modell des Menschen, das von rationalem, gewinnorientiertem Verhalten ausgeht und eine wichtige Rolle im faktortheoretischen Ansatz spielt.
Was ist die Beziehung zwischen Theorie und Praxis im Management?
Theorie und Praxis sind untrennbar miteinander verbunden, da Annahmen (Theorie) zum Verhalten (Praxis) führen. Das Führungsverhalten von Managern wird durch ihre Vorstellungen von ihren Mitarbeitern beeinflusst.
Wie beeinflusst der Zeitgeist Menschenbilder in den Managementwissenschaften?
Menschenbilder in den Managementwissenschaften werden durch den jeweiligen Zeitgeist beeinflusst und spiegeln die gesellschaftlichen Entwicklungen wider. Daher kann es kein universelles Menschenbild geben.
Welche Rolle spielt die Freiheit in den diskutierten Menschenbildern?
Die Frage nach der Freiheit des Denkens, Handelns und der Autonomie spielt eine große Rolle in den diskutierten Menschenbildern, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Notwendigkeit und Freiheit in der Ökonomie.
- Quote paper
- Anisa Boumrifak (Author), 1999, Soziale Situation und Soziales Handeln, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97843