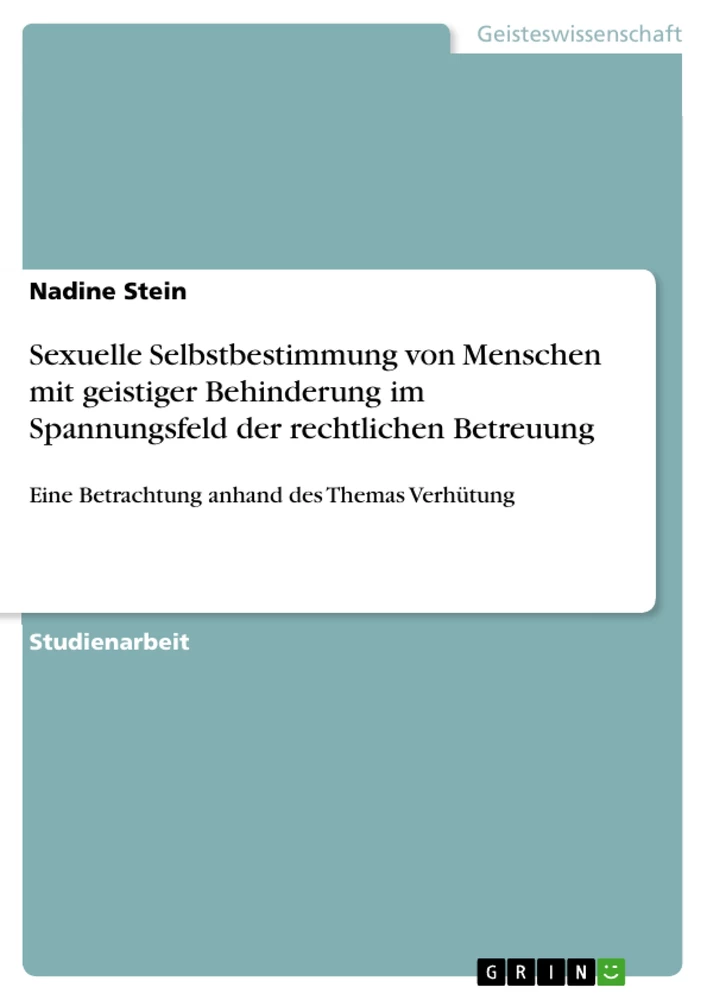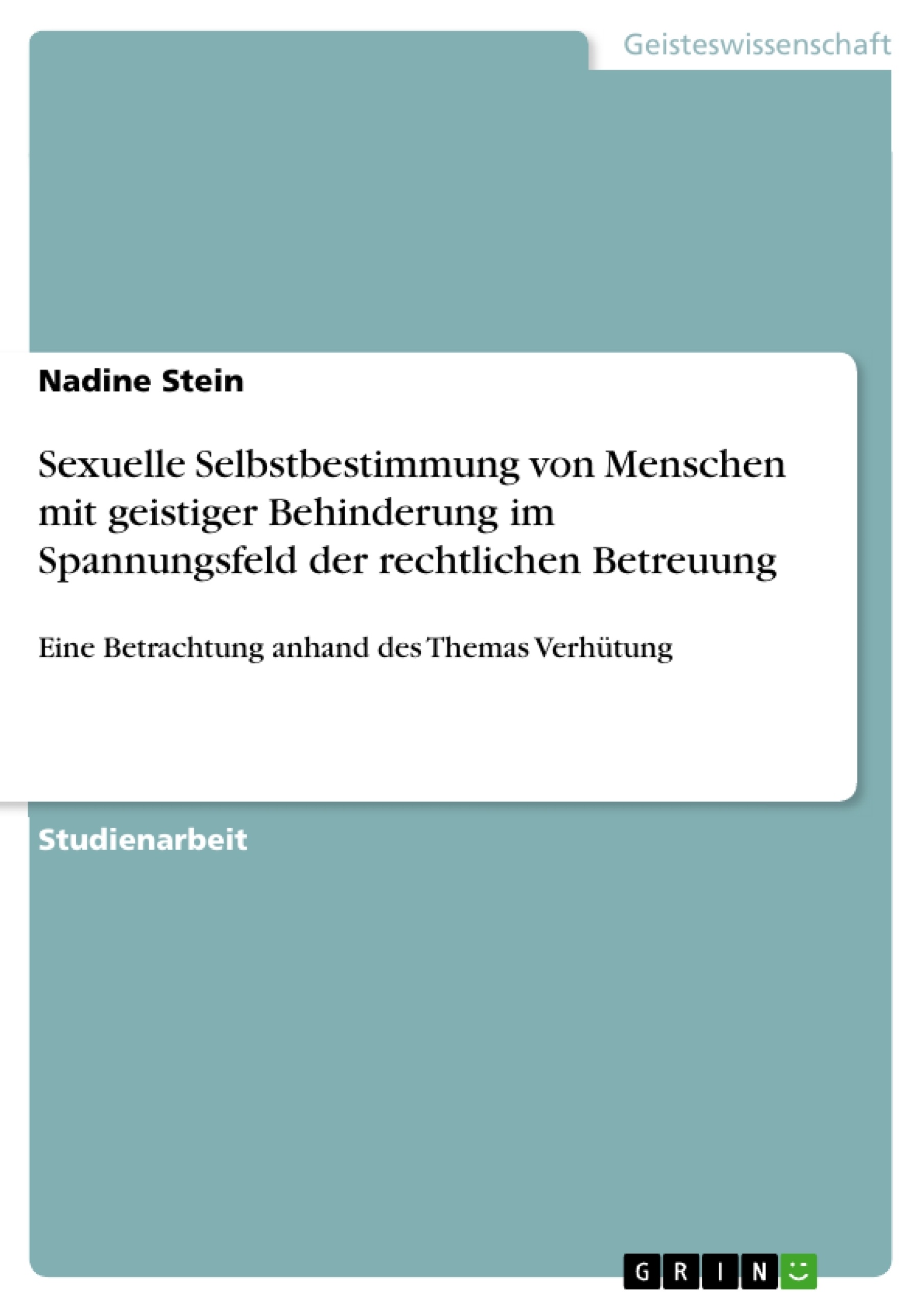In dieser Praxisarbeit wird die Forschungsfrage „Inwiefern können Menschen mit geistiger Behinderung selbstbestimmt über eine Sterilisation entscheiden, wenn eine rechtliche Betreuung eingerichtet ist?“ unter dem Thema „Sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung im Spannungsfeld der rechtlichen Betreuung - Eine Betrachtung am Beispiel des Themas Verhütung“ bearbeitet.
Sexualität und die damit verbundene Aufklärung und selbstbestimmte Auswahl an Verhütungsmethoden ist Teil des menschlichen Daseins und Bestandteil der Persönlichkeit eines jeden Menschen. Sie umfasst nicht nur die Gentitalsexualität, sondern vielmehr den Austausch von Mimik, Gestik, Gefühlen, Freundschaften und Partnerschaften, sowie die geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung.
Sexualität, die für Menschen ohne diagnostizierte Behinderung meist keine Komplikationen bereitet, stellt für Menschen mit einer Behinderung oftmals eine sehr große Schwierigkeit dar. Nicht zwangsläufig sind die körperlichen oder kognitiven Einschränkungen die Hauptproblematik, sondern die Gesellschaft.
Nur etwa 10% bis 15% der Menschen in Deutschland mit geistiger Behinderung haben Genitalsex. Viele Menschen mit geistiger Behinderung leben ihre Sexualität mit Schmusen, Petting, Streicheln, Küssen oder Selbstbefriedigung aus. Trotz dessen verwenden ca. 75% der Menschen mit Behinderung Verhütungsmethoden, wie zum Beispiel die 3-Monatsspritze oder die Sterilisation.
Obwohl seit einigen Jahren die Politik versucht ein Umdenken und Sensibilisieren auf Themen wie Sexualität mit Behinderung zu erreichen, lässt sich in der Praxis pädagogisch und institutionell immer noch Formen der Bevormundung hinsichtlich der Sexualität und Verhütung von Menschen mit Behinderung feststellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Teil
- Verhütungsmethode Sterilisation - eine medizinische Definition
- Historischer Wandel und rechtliche Aspekte der (Zwangs-) Sterilisation
- Betreuungsrecht
- Rechtliche Rahmenbedingungen für Menschen mit geistiger Behinderung in Bezug auf sexuelle Selbstbestimmung
- Sexualität
- Definition von Sexualität
- Verhütungsmethoden
- Verhütungsmethode Sterilisation - eine medizinische Definition
- Beratungsangebote
- Vorurteile und Erschwernisse der Sexualität von Menschen mit geistiger Behinderung
- Vorurteile
- Verhütung
- Rahmenbedingungen
- Art und Schwere der Behinderung
- Geschlechterrollenzugehörigkeit
- Assistenzbedarf
- Eltern
- Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung
- Rechtliche Betreuung
- Empirischer Teil
- Forschungsdesign
- Beschreibung der Durchführung
- Beschreibung des methodischen Vorgehens
- Auswertung des Interviews
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Praxisarbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern Menschen mit geistiger Behinderung selbstbestimmt über eine Sterilisation entscheiden können, wenn eine rechtliche Betreuung eingerichtet ist. Die Arbeit untersucht die sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung im Spannungsfeld der rechtlichen Betreuung am Beispiel des Themas Verhütung.
- Rechtliche Rahmenbedingungen für sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung
- Vorurteile und Diskriminierung in Bezug auf Sexualität und Verhütung bei Menschen mit Behinderung
- Die Rolle der rechtlichen Betreuung bei Entscheidungen über Verhütungsmethoden
- Empirische Untersuchung der Erfahrungen von Menschen mit geistiger Behinderung im Hinblick auf ihre sexuelle Selbstbestimmung
- Ethische Aspekte der Sterilisation im Kontext der Behinderung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung ein und stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor. Der theoretische Teil befasst sich mit der Definition von Sterilisation, dem historischen Wandel der Sterilisation, dem Betreuungsrecht und den rechtlichen Rahmenbedingungen für Menschen mit geistiger Behinderung in Bezug auf sexuelle Selbstbestimmung, sowie mit dem Thema Sexualität und Verhütung im Allgemeinen. Es werden die Vorurteile und Erschwernisse, die Menschen mit geistiger Behinderung in Bezug auf ihre Sexualität erfahren, beleuchtet.
Der empirische Teil beschreibt das Forschungsdesign, die Durchführung der Studie und die Auswertung des Interviews.
Schlüsselwörter
Sexuelle Selbstbestimmung, geistige Behinderung, rechtliche Betreuung, Sterilisation, Verhütung, Vorurteile, Diskriminierung, empirische Forschung, qualitative Forschung, Interview.
- Quote paper
- Nadine Stein (Author), 2020, Sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung im Spannungsfeld der rechtlichen Betreuung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/978802