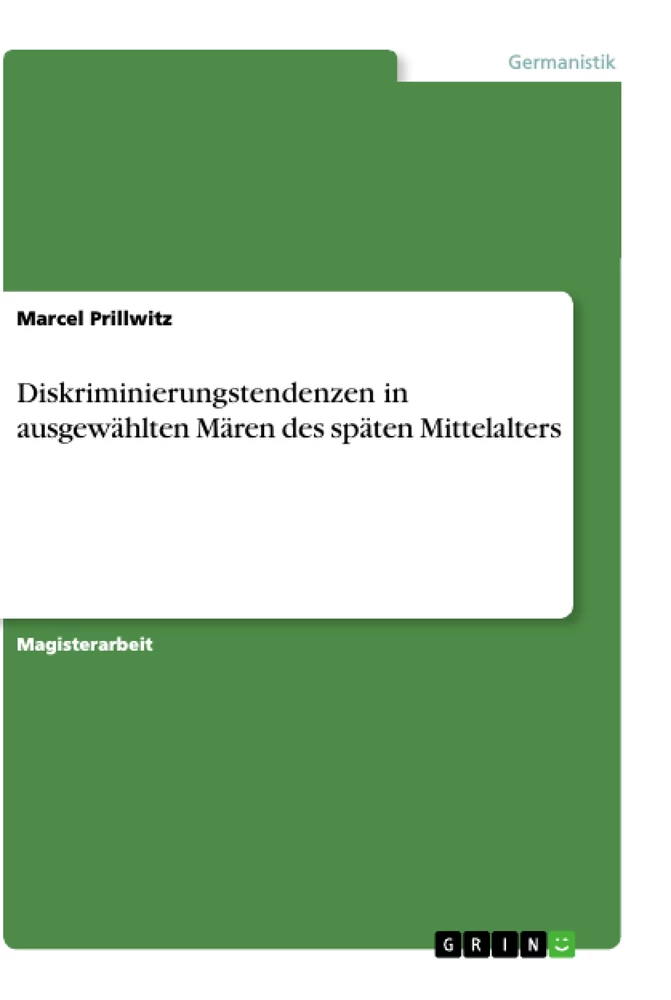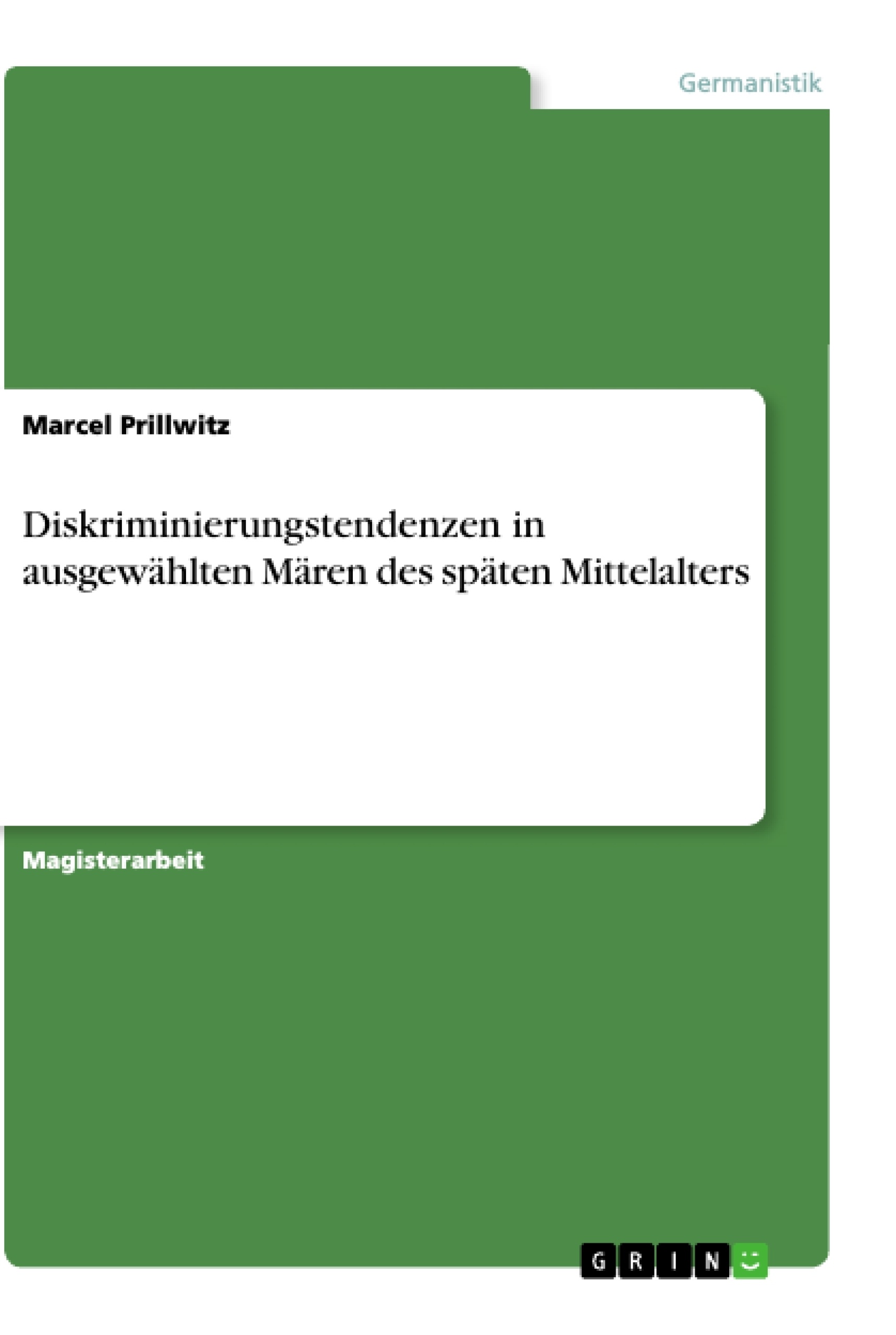Der Text befasst sich mit interdisziplinären Untersuchungen zum Diskriminierungsbegriff und der Anwendung von Diskriminierung in der literarischen Praxis im deutschsprachigen Raum des Mittelalters. Exkurse in andere Sprachräume sind ebenfalls enthalten.
„sweigt ain weil und horchet her, so will ich euch sagen ain neus mer“.
Mit diesen an sein Publikum adressierten Worten beginnt HANS ROSENPLÜT seine Erzählung „Die Tinte“. Er berichtet über einen zölibatbrechenden Mönch, dessen gekaufte Gespielin durch ein Missgeschick sämtliche Klosterbrüder als vermeintlicher Teufel in Angst und Schrecken versetzt. Das komödiantische Potential des Stückes ist für jedermann ersichtlich. Hinzu mischt der Autor eine Prise Zeitkritik, sowie eine ausdrückliche Moralisatio.
Damit sind einige Zutaten eines Märe aufgezählt. Natürlich existieren auch Mären, die gänzlich ohne Komik auskommen, oder aber welche, die keine Ansätze der Zeitkritik erkennen lassen: „Es sind Typen und typische Geschehnisse, menschliche Irrungen und Wirrungen, die hier gezeigt werden.“ . Allen Mären ist eines gemein: Sie sind immer in Versen paargereimt.
Über den ästhetischen Stellenwert des Märe im Gesamtkontext der mittelalterlichen Literaturlandschaft ist die Forschung lange Zeit zu keinem Ergebnis gelangt. Dies hängt zusammen mit der Tatsache, dass dieser Literaturtyp vielerorts noch nicht als vollwertige Gattung anerkannt ist. Über die Problematik der Gattungskonzeption sowie die literarische Umwelt des Märe berichtet vorliegende Untersuchung.
Soziologische Milieustudien und kulturhistorische Rückschlüsse sind auf Grund der schwankhaft humoristisch-unterhaltenden Ausrichtung der Texte schwerlich möglich.
Es sind Grundtendenzen in einigen Mären aufspürbar, die das Gesellschaftsbild – oder besser: die Teilnehmer der Gesellschaft – dennoch in diskriminierender Art und Weise darzustellen versuchen. Jene Texte sind das Ziel dieser Untersuchung. An sie werden wir ein basissoziologisches Gerüst anlegen, bevor die eigentlichen textkritischen Analysen einer Auswahl von Märentexten vollzogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Einführung
- Gattungsspezifische Voruntersuchungen
- Märendefinitionen
- Die Definition eines Märe nach HANNS FISCHER
- HEINZLEs Universalkritik
- ZIEGELERs partiell-definitorischer Neuansatz
- Versnovelle, Novelle oder doch Schwank?
- Die literarischen Vorläufer des Märe
- Das lateinische ridiculum
- Das altfranzösische Fabliau
- Märendefinitionen
- Soziologische Bemerkungen
- Positivismus und symbolischer (Inter)Aktionismus
- Bestimmung der Diskriminierung
- Zielgerichtete Diskriminierung
- Textkritische Einzeluntersuchungen
- Antisemitische Mären – Der Juden Schand‘
- HANS FOLZ: Der falsche Messias
- HANS FOLZ: Die Wahrsagebeeren
- HANS ROSENPLÜT: Die Disputation
- Schlag auf Schlag – Frauen in der Gewalt der Männer
- Die gezähmte Widerspenstige
- HANS FOLZ: Der Köhler als gedungener Liebhaber
- DER STRICKER: Die eingemauerte Frau
- HEINRICH KAUFRINGER: Der feige Ehemann
- HEINRICH DER TEICHNER: Die Rosshaut
- Kastration als ultima ratio – Das Leid der Pfaffen
- HANS ROSENPLÜT: Der Bildschnitzer von Würzburg
- HANS ROSENPLÜT: Die Wolfsgrube und HEINRICH KAUFRINGER: Die Rache des Ehemannes
- Rustikales vom Lande – Bauernbilder
- Der Bauernhochzeitsschwank
- SCHWEIZER ANONYMUS: Zweierlei Bettzeug
- DER STRICKER: Die Martinsnacht
- Antisemitische Mären – Der Juden Schand‘
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht Diskriminierungstendenzen in ausgewählten Mären des späten Mittelalters. Ziel ist die Analyse der Darstellung verschiedener sozialer Gruppen und die Erforschung der zugrundeliegenden Vorurteilsstrukturen. Die Arbeit betrachtet, wie diese Tendenzen literarisch umgesetzt wurden und welche Rolle sie im gesellschaftlichen Kontext spielten.
- Darstellung von Juden in der Märendichtung
- Frauenbilder und Gewalt gegen Frauen in den Mären
- Die Rolle des Klerus und die Kritik an dessen Verhalten
- Die Darstellung des Bauerntums und dessen sozialer Positionierung
- Die gattungsspezifische Einordnung des Märe und seine literarischen Vorläufer
Zusammenfassung der Kapitel
Zur Einführung: Die Arbeit beginnt mit einer kurzen Einführung in die Welt der mittelalterlichen Mären, die als paargereimte Verserzählungen charakterisiert werden. Es wird die Problematik der Gattungsdefinition des Märe angesprochen und die Fokussierung auf Texte mit diskriminierenden Tendenzen begründet. Die Arbeit gliedert sich in eine Untersuchung der Gattung, eine soziologische Betrachtung der Diskriminierung und eine textkritische Analyse ausgewählter Mären.
Gattungsspezifische Voruntersuchungen: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit der Definition des Märe. Es werden verschiedene Ansätze von Forschern wie Hanns Fischer, Joachim Heinzle und Hans-Joachim Ziegeler kritisch diskutiert und ihre Definitionen verglichen. Dabei wird die Schwierigkeit der Abgrenzung zu ähnlichen Gattungen wie der Novelle und dem Schwank hervorgehoben. Die literarischen Vorläufer des Märe, insbesondere das lateinische Ridiculum und das altfranzösische Fabliau, werden analysiert und ihre Einflüsse auf die deutsche Märendichtung beleuchtet.
Soziologische Bemerkungen: Dieses Kapitel liefert den soziologischen Rahmen für die Analyse der Diskriminierungstendenzen. Es werden der Positivismus und der symbolische Interaktionismus als relevante soziologische Ansätze vorgestellt und ihre Anwendung auf die mittelalterliche Gesellschaft erläutert. Die Arbeit definiert Diskriminierung als "überdeutliche Herabwürdigung mit erniedrigender Tendenz" und benennt die relevanten Zielgruppen: Juden, Frauen, Klerus und Bauern.
Textkritische Einzeluntersuchungen: Dieses Kapitel präsentiert textkritische Analysen ausgewählter Mären, geordnet nach den vier Diskriminierungstypen. Es werden die jeweiligen Texte auf ihre diskriminierenden Tendenzen hin untersucht, wobei der Kontext der mittelalterlichen Gesellschaft berücksichtigt wird. Die Analyse umfasst Texte von Hans Folz, Hans Rosenplüt, dem Stricker und Heinrich Kaufringer, unter anderem.
Schlüsselwörter
Märe, Märendichtung, Spätmittelalter, Diskriminierung, Antisemitismus, Misogynie, Kleruskritik, Bauernsatire, Gattungsdefinition, Soziologie, Symbolischer Interaktionismus, Textanalyse, Literaturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Diskriminierungstendenzen in ausgewählten Mären des späten Mittelalters
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht Diskriminierungstendenzen in ausgewählten Mären des späten Mittelalters. Sie analysiert die Darstellung verschiedener sozialer Gruppen (Juden, Frauen, Klerus, Bauern) und die zugrundeliegenden Vorurteilsstrukturen in diesen Texten. Die Arbeit beleuchtet die literarische Umsetzung dieser Tendenzen und deren Rolle im gesellschaftlichen Kontext.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Darstellung von Juden in der Märendichtung, Frauenbilder und Gewalt gegen Frauen, die Rolle des Klerus und Kritik an dessen Verhalten, die Darstellung des Bauerntums und dessen soziale Positionierung sowie die gattungsspezifische Einordnung des Märe und seine literarischen Vorläufer.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einführung, gattungsspezifische Voruntersuchungen (inkl. Definition des Märe und seiner Vorläufer), soziologische Bemerkungen (mit Fokus auf Positivismus und symbolischen Interaktionismus) und textkritische Einzeluntersuchungen ausgewählter Mären, geordnet nach den vier Diskriminierungstypen.
Welche Autoren und Mären werden analysiert?
Die textkritischen Analysen umfassen Mären von Hans Folz (z.B. "Der falsche Messias", "Die Wahrsagebeeren"), Hans Rosenplüt (z.B. "Die Disputation", "Der Bildschnitzer von Würzburg", "Die Wolfsgrube"), dem Stricker (z.B. "Die eingemauerte Frau", "Die Martinsnacht") und Heinrich Kaufringer (z.B. "Der feige Ehemann"), sowie weitere anonyme Texte wie "Der Bauernhochzeitsschwank" oder "Zweierlei Bettzeug".
Welche soziologischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit nutzt den Positivismus und den symbolischen Interaktionismus als soziologische Rahmen für die Analyse der Diskriminierungstendenzen. Diese Ansätze helfen, die mittelalterliche Gesellschaft zu verstehen und die dargestellten Vorurteile im Kontext ihrer Zeit zu interpretieren.
Wie wird Diskriminierung in dieser Arbeit definiert?
Diskriminierung wird als "überdeutliche Herabwürdigung mit erniedrigender Tendenz" definiert, wobei die Zielgruppen Juden, Frauen, Klerus und Bauern im Fokus stehen.
Welche literarischen Vorläufer des Märe werden untersucht?
Die Arbeit analysiert das lateinische Ridiculum und das altfranzösische Fabliau als literarische Vorläufer des Märe und beleuchtet deren Einfluss auf die deutsche Märendichtung.
Was sind die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Märe, Märendichtung, Spätmittelalter, Diskriminierung, Antisemitismus, Misogynie, Kleruskritik, Bauernsatire, Gattungsdefinition, Soziologie, Symbolischer Interaktionismus, Textanalyse, Literaturgeschichte.
- Arbeit zitieren
- Marcel Prillwitz (Autor:in), 2010, Diskriminierungstendenzen in ausgewählten Mären des späten Mittelalters, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/978842