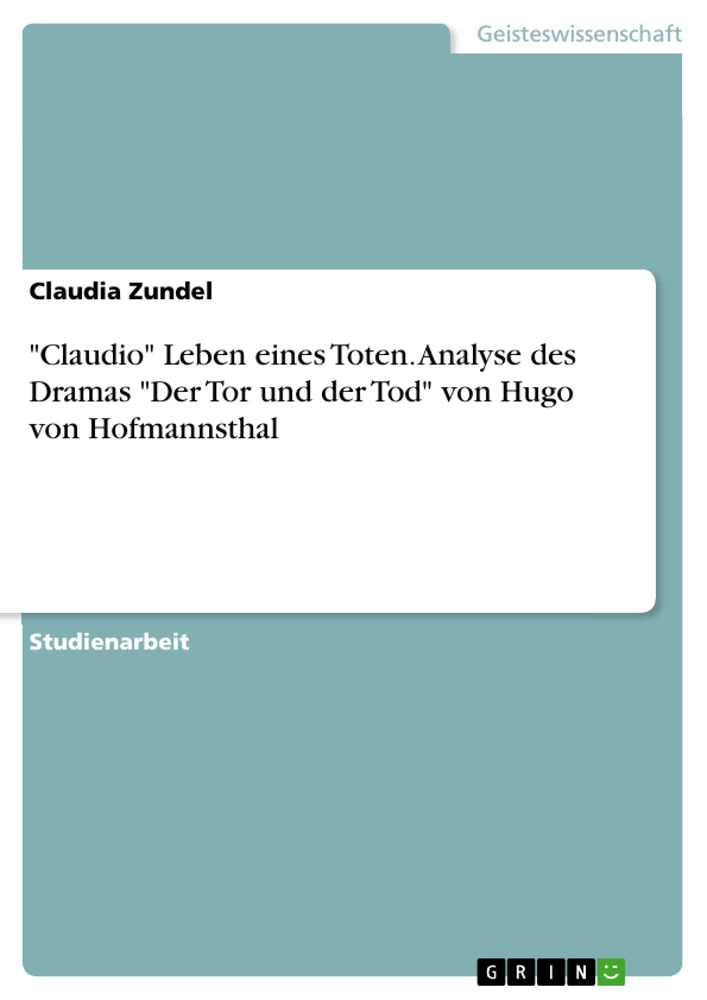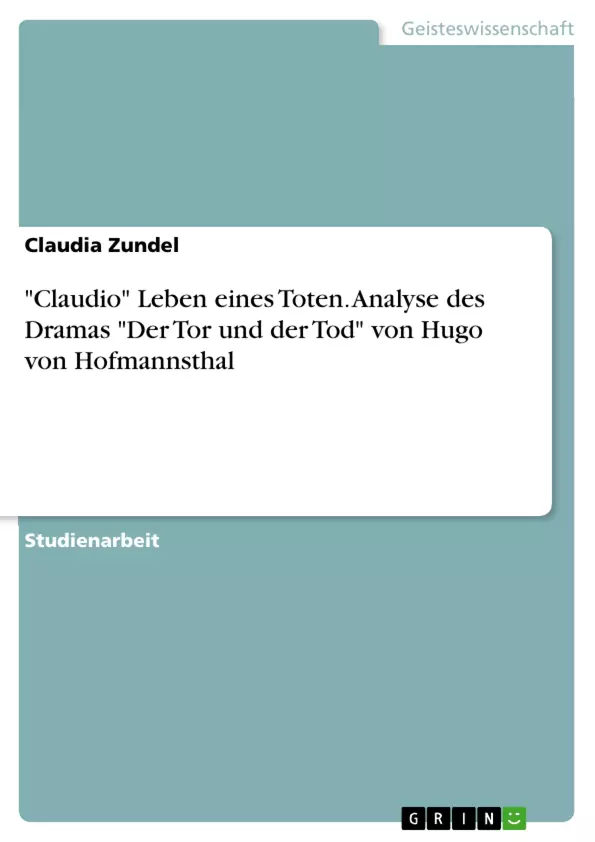In dem 1892 verfassten Essay „Die Legende einer Wiener Woche“ schreibt der achtzehnjährige Hugo von Hofmannsthal:
„Denn dazu, glaube ich, sind Künstler: dass alle Dinge,
die durch ihre Seele hindurchgehen, einen Sinn und
eine Seele empfangen ... . Und manche Wolken, schwere
goldengeballte, haben ihre Seele von Poussin, und manche
rosig-runde, von Rubens, und andere, prometheische,
blauschwarze, düstere, von Böcklin.“
Es lässt sich kaum übersehen, in welchem Zeitalter diese Zeilen geschrieben wurden;
Die Beanspruchung Kunst sei der Natur weit überlegen, und darüber hinaus sei Natur ausschließlich auf die Wahrnehmungs- und Deutungsmuster eines Künstlers angewiesen, lassen sich eindeutig in den Symbolismus bzw. Ästhetizismus oder Decadence der Jahrhundertwende einordnen.
Noch im selben Jahr eröffnet der junge Hofmannsthal seinen Aufsatz „Südfranzösische Eindrücke“ mit folgenden Worten:
„... der unabsichtlichen Anmut, die das Leben hat. Denn
die Bilder des Leben folgen ohne inneren Zusammenhang
aufeinander und ermängeln gänzlich der effektvollen
Komposition.“
Beispiele dieser Art finden sich viele im Werke Hofmannsthals, die von seiner ambivalenten Haltung gegenüber dem Symbolismus zeugen. Ebenso widersprüchlich war und ist die Rezeption des künstlerischen Schaffens Hofmannsthals. Besonders repräsentativ hierfür scheint die Figur des Claudio, in dem 1894 erschienenen lyrischen Drama „Der Tor und der Tod“ zu sein, das sein populärstes Frühwerk wurde. Die einen sehen in Claudio den in sich ruhenden Ästheten par excellence, der keine Wandlung durchmacht; andere wiederum meinen, Claudios selbstverschuldete Krankheit des Ästhetizismus werde durch den Prozess, den der Tod ihm mache, am Ende überwunden bzw. geheilt.
Anhand der nun folgenden Analyse des Dramas „Der Tor und der Tod“ soll dargelegt werden, inwieweit sich gerade hier Hofmannsthals Ambivalenz gegenüber dem Symbolismus manifestiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Claudios Eingangsmonolog
- Wandlung durch Musik
- Im Angesicht des Todes
- Tanz der Toten
- Der Tod sein Leben
- Epilog
- Beginn einer Wandlung des Ästheten
- Hofmannsthals Ästhetizismusbegriff
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Analyse des Dramas „Der Tor und der Tod" von Hugo von Hofmannsthal und untersucht, inwiefern sich darin Hofmannsthals ambivalente Haltung gegenüber dem Symbolismus manifestiert. Die Analyse konzentriert sich insbesondere auf die Figur des Claudio und dessen Verhältnis zum Ästhetizismus.
- Claudios Ästhetizismus und dessen Auswirkungen auf seine Lebensgestaltung
- Die Rolle des Todes in Claudios Wandlungsprozess
- Das Verhältnis von Natur und Kunst im Drama
- Hofmannsthals Ästhetizismusbegriff im Kontext der Jahrhundertwende
- Die Rezeption des Dramas und die Interpretation der Figur des Claudio
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und gibt einen Überblick über die Rezeption des Dramas „Der Tor und der Tod".
- Claudios Eingangsmonolog: Dieser Abschnitt analysiert Claudios Selbstbild und seine Einstellung zur Welt, die sich in seinem ersten Monolog manifestiert.
- Wandlung durch Musik: Hier wird untersucht, wie Musik eine transformative Kraft auf Claudio ausübt und ihn in eine neue, emotionalere Welt führt.
- Im Angesicht des Todes: Die Begegnung mit dem Tod stellt Claudios Weltbild in Frage und führt zu einer Konfrontation mit seiner eigenen Sterblichkeit.
- Tanz der Toten: Dieser Abschnitt beleuchtet den Tanz der Toten als symbolische Darstellung von Claudios Abschied von der Welt und seiner Konfrontation mit dem Tod.
- Der Tod sein Leben: Die Begegnung mit dem Tod führt Claudio zu einer neuen Erkenntnis über das Leben und seine Bedeutung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Symbolismus, Ästhetizismus, Tod, Kunst, Natur, Leben, und der Rezeption von Hugo von Hofmannsthals Werk.
- Quote paper
- Claudia Zundel (Author), 1994, "Claudio" Leben eines Toten. Analyse des Dramas "Der Tor und der Tod" von Hugo von Hofmannsthal, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9795