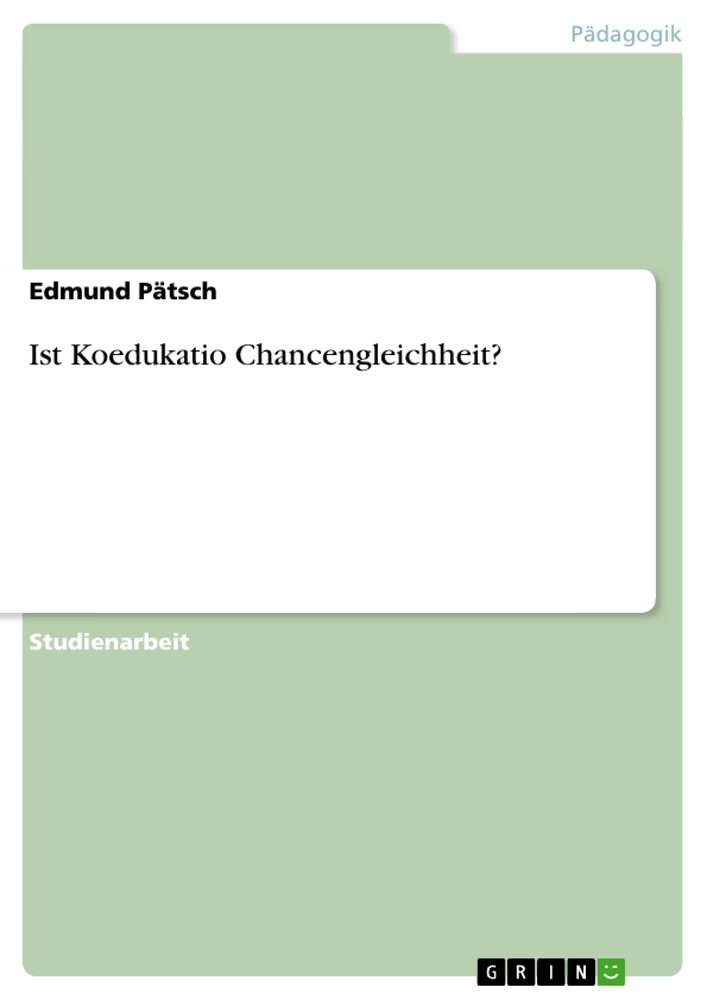Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Geschichte der Mädchenbildung und der Koedukation
2. 1. Mädchenbildung von der Antike bis zum Mittelalter
2. 2. Mädchenbildung im 16. und 17. Jahrhundert
2. 3. Mädchenbildung im 18. Jahrhundert
2. 4. Das Schulsystem im 18. und 19. Jahrhundert
2. 5. Der Anfang der Frauenbewegung
2. 6. Mädchenbildung am Anfang des 20. Jahrhunderts
2. 7. Die Weimarer Republik
2. 8. Hitler und sein Schulsystem
2. 9. Koedukation in der BRD
2. 10. Zeittafel
3. Situation heute
3. 1. Koedukative und getrennte Schulen in Zahlen
3. 2. Pro und Kontra Koedukation (tabellarisch)
4. Die reflexive Koedukation
4. 1. Heißt Koedukation auch Chancengleichheit?
4. 2. Schule der Zukunft
5. Schlußbemerkung
6 Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Koedukation oder doch lieber getrennt? Passen Mädchen und Jungen überhaupt zusammen? Oder sind die Unterschiede doch zu groß? Fragen, die nicht nur Pädagogen und Philosophen beschäftigen, im Hinblick auf Kinder und Jugendliche und deren Erziehung, sondern ein Thema, welches uns alle ein Leben lang begleitet.
In dieser Hausarbeit werde ich versuchen zu erläutern, warum seit einiger Zeit die Diskussion um die Koedukation wieder entbrannt ist. Ob dies nur aus der Richtung „fanatischer“ Feministinnen kommt oder ob andere Aspekte hier eine Rolle spielen.
Ich werde im ersten Kapitel (Geschichte der Mädchenbildung und der Koedukation) einen geschichtlichen Überblick über die Schulbildung seit der Antike geben. Besonderes Augenmerk lege ich dabei auf die Bildung der Mädchen (soweit sie denn stattgefunden hat). Weitere wichtige Punkte in diesem ersten Kapitel sind der Verlauf der Koedukation in den Jahrhunderten und die Anfänge der Frauenbewegung.
Im zweiten Kapitel (Situation heute) werde ich die Schule in der heutigen „normalen“ Form beleuchten und auch gleich einige ihrer Schwachpunkte herausgreifen. Am Schluß des Kapitels befindet sich eine tabellarische Übersicht über Vor- und Nachteile der Koedukation.
Spätestens im dritten Kapitel (Die reflexive Koedukation) sollte klar werden, warum die Diskussion um die Koedukation ihre Berechtigung hat. Ich werde versuchen hier aufzuzeigen, welche Verbesserungsmöglichkeiten es an dem jetzigen Schulsystem gibt.
2. Geschichte der Koedukation und der Mädchenbildung
2. 1. Mädchenbildung von der Antike bis zum Mittelalter
Die Anfänge der Koedukation lassen sich kaum auf ein bestimmtes Datum festlegen. Aus historischen Quellen werden, wenn Frauen überhaupt er- wähnt werden, nur Dokumente zur getrenntgeschlechtlichen Erziehung überliefert, wobei den Mädchen meistens häusliche Aufgaben zugeteilt werden.
Bei Homer ist bereits ca. 700 vor Chr. nachzulesen, daß für Mädchen und Frauen vor allem die Beschäftigung mit der Musik vorgesehen ist, neben Ihren Aufgaben im häuslichen Bereich. Im alten Griechenland wurden Mädchen in Sparta bis in die Militärausbildung einbezogen. In Athen da- gegen wurden sie von jedem öffentlichen Leben ausgeschlossen. Ab 300 vor Chr. wurden Frauen ins öffentliche Bildungssystem integriert. Zu die- sem Zweck gab es sowohl Knaben- als auch Mädchenschulen.1
Praktisches Lernen herrschte im alten Rom vor. Während Jungen Ackerbau, Kriegsdienst und politisches Handeln gelehrt wurde, erlernten Mädchen „typisch weibliche“ Arbeiten.
Im 11. - 13. Jahrhundert wurden adelige und privilegierte Mädchen meist von ihren Müttern oder von Nonnen unterrichtet. Später übernahmen die- se Aufgaben die Hauslehrer. Mädchen der unteren Schichten besuchten zu dieser Zeit meist sogenannte Klipp- oder Winkelschulen gemeinsam mit Jungen ihrer Schicht.2
Ab 1350 entstanden getrennte Mädchen- und Knabenschulen. Den Mäd- chen war zu dieser Zeit der Zugang zu den ersten Universitäten die ent- standen streng untersagt. Ebenfalls untersagt war ihnen der Zugang zu den im 15. Jahrhundert entstandenen humanistischen Gymnasien.3
2. 2. Mädchenbildung im 16. und 17. Jahrhundert
Auch in dieser Zeitspanne findet man Aussagen zur Mädchenbildung. So fordert Thomas Morus (1478 - 1535) gleiche Bildung für Jungen und Mädchen in öffentlichen Staatsschulen und Johann Valentin Andrea (1586 - 1654) entwarf für seinen „Christenstaat“ eine mit dem 7. Lebensjahr beginnende Schulpflicht für alle. Die Erziehung sollte allerdings immer noch getrennt erfolgen.4
Wolfgang Ratke (1571 - 1635) kämpfte dann im 17. Jahrhundert für die Einführung der allgemeinen Schulpflicht beider Geschlechter in Deutschland. Etwa zur gleichen Zeit erarbeitete Comenius (1592 - 1670) einen Schulplan, der eine koedukative „Mutterschule“ vom 1. - 6. Lebensjahr vorsah, und dem eine Muttersprachenschule folgte.
2. 3. Mädchenbildung im 18. Jahrhundert
Die Vorstellung, daß die Frau dem Mann gefallen solle, lieferte der französische Erziehungsroman von Jean Jacques Rousseau (1712 - 1782) „Emile oder über die Erziehung“ (1762). Die Ausbreitung des Kapitalismus tat sein übriges, so daß Mädchen “entsprechend ihrer Bestimmung” zur Gattin und Hausfrau erzogen wurden.
Es gab nur wenige Verfechter der Mädchenbildung wie z. B. Johann Gottlieb Ficht (1762 - 1814). Die meisten Pädagogen waren jedoch Gegner der Mädchenbildung und hielten diese auch für überflüssig, wie z. B. Ernst Daniel Schleiermacher (1768 - 1834).5
2. 4. Das Schulsystem im 18. und 19. Jahrhundert
An der Schwelle vom 18. zum 19. Jahrhundert bekam Schule, durch die allmähliche Einführung der allgemeinen Schulpflicht, einen neuen Stellen- wert.
Während der Industrialisierung war gemeinsame Erziehung in den ländli- chen Schulen und Trivialschulen in der Stadt ganz normal. Auch die Volksschulen des 19. Jahrhunderts waren fast immer koedukativ, denn die Koedukation bis zum Alter von 10 / 12 Jahren wurde nicht als problema- tisch angesehen, da sich der Lernstoff in den Volksschulen sowieso nur auf die allernötigsten Kulturtechniken bezog. Dennoch wurden die Ge- schlechter innerhalb des Klassenzimmers unter Androhumg von Strafe getrennt.6 Die Ausbildung der Mädchen stand jedoch immer im Hinter- grund. Die Jungen wurde unterrichtet, die Mädchen nur „mitbeschult“.7
Die Qualität der um 1750 entstandenen privaten höheren Töchterschulen ließ sehr zu wünschen übrig, da die Mädchen hier nur zur Weiblichkeit erzogen wurden und keinesfalls mit ihrem Abschluß eine Berechtigung erlangten, die vergleichbar war mit der der Jungen, die ein Regelgymnasi- um besucht hatten.8
2. 5. Der Anfang der Frauenbewegung
Etwa am Ende des 18. Jahrhunderts kam die Frauenbewegung auf. Eine wichtige Rolle spielte dabei der 1865 gegründete ADV (Allgemeiner Deut- scher Frauenverein)9, der 1867 auf seiner ersten Generalversammlung, zum ersten Mal einen Antrag bezüglich der Koedukation stellte. „ Der Ver- ein wollte sich auf dem Weg der Petition an Regierungen und Kom- munalbehörden dahin wenden, daßdie bestehenden Unterrichtsan- stalten auch dem weiblichen Geschlecht zugänglich, auch solche für des weibliche Geschlecht besonders gegründet würden, um dassel- be höhere Bildung teilhaftig und besser erwerbsfähig zu machen. “ 10 Aufgrund der Brisanz und der Aussichtslosigkeit wurde diese Petition jedoch nicht weitergeleitet, und erst 1897 forderte der ADV eine Angleichung des höheren Mädchenschulwesens an das höhere Jungenschulsystem. Vernachlässigt wurde immer noch die Forderung des Zugangs der Mädchen zu den bestehenden Universitäten, obwohl 1895 bereits die ersten sechs Berlinerinnen ihr Reifezeugnis erhalten hatten.
2. 6. Mädchenbildung zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das Erkämpfen des Rechts auf Bil- dung für Frauen vordergründig, während Koedukationsdiskusionen fast keine Rolle spielten. Mädchen der Unterschicht bekamen eine dürftige Einführung ins Lesen, Schreiben und Rechnen, und oft nicht einmal das. Der Unterricht der Töchter des gehobenen Bürgertums bestand aus An- standsregeln, gepflegter Konversation, Französisch, Musik und Handar- beit. Unterordnung und Schicksalsergebenheit war das Ziel des Unter- richts der Mädchen, damit es dem Mann eine gute Ehefrau sein konnte.11 Die Forderung der bürgerlichen Frauenbewegung nach „weiblicher“ Leis- tung von Schulen und dem Unterricht an Jungenschulen, die zunächst jedoch besonders vom Oberlehrerverband abgelehnt wurde, stand lange Zeit im Zentrum der Diskussion.12 Nur der Verein „Frauenwohl“, den man zum radikalen Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung zählte, trat 1901 für die Umwandlung aller getrenntgeschlechtlichen Schulen ein. Ein Jahr später forderte auch der „Bund Deutscher Frauenvereine“ (BDF) eine be- schränkte Koedukation, wo es keine Mädchenschulen gab. Diesem Vor- schlag hatte jedoch nur den pragmatischen Grund, das sonst Mädchen in diesen Gebieten garnicht beschult worden wären.
Am 15. August 1908 nahm das preußische Ministerium eine Neuordnung des höheren Mädchenschulwesens vor. Sie umfaßte die Einführung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts. Mädchen soll- ten vom 6. bis zum 16. Lebensjahr ein Lyzeum besuchen können. Danach hatten sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Zweigen des Oberly- zeums. Ein hauswirtschaftlicher Zweig, ein höheres Lehrerinnenseminar und eine Studienanstalt, die zum Abitur führte.13 Im gleichen Jahr wurden Frauen auch erstmals in Preußen zum Studium zugelassen. Der „Verein Deutscher Katholischer Lehrerinnen” bekräftigte noch Ende 1908 seine Gegnerschaft zur Koedukation. „ Die gemeinsame Erziehung von Knaben und Mädchen lehnen wir als Prinzip ab. “ 14 Desweiteren kämpfte um ca. 1908 innerhalb der Arbeiterbewegung eine sozialistische Frauenbewegung für die Koedukation. Die Zielsetzung war jedoch eine andere als die der bürgerlichen Frauenbewegung. Sie wollten nicht nur das Schulsystem ändern, sondern auch die Gesellschaftsform. Für sie war die gesellschaftliche Stellung der Frau nicht naturbestimmt, sondern historisch bedingt und abhängig von den Eigentums- und Produk- tionsverhältnissen.15
2. 7. Die Weimarer Republik
Während der Weimarer Republik wurden zwar Koedukationsschulen zugelassen, bzw. Mädchen an Jungenschulen mit aufgenommen; Koedukation als Prinzip setzte sich jedoch nicht durch. Einzig in der Landerziehungsheimbewegung wurde die Koedukation als wesentlicher Bestandteil in der Entwicklung von Jungen und Mädchen gesehen. Hier konnten die männliche und weibliche Kultur zusammenfließen.16
Heftigen Widerstand gegen alle Bestrebungen zur Durchsetzung der Ko- edukation kam insbesondere von Seiten der katholischen Kirche. Die Ful- daer Bischofskonferenz lehnte 1925 die Koedukation ab. Am 31. 12. 1929 wird von Papst Pius XI. sogar eine Enzyklika gegen die Koedukation verkündet. Darin heißt es: „ Der Schöpfer hat nach Regeln und Ordnung das Zusammenleben der beiden Geschlechter voll- ständig nur in der Einheit der Ehe, dagegen in verschiedenen Abstu- fungen in der Familie und Gesellschaft gewollt. Ferner l äß t sich aus der Natur, welche die Verschiedenheit im Organismus, in den Nei gungen und Anlagen hervorbringt, kein Beweis herleiten, daßeine Vermischung oder gar eine Gleichheit in der Heranbilden beider Ge schlechter tunlich oder notwendig wäre. “ 17
2. 8. Hitler und sein Schulsystem
Die Nationalsozialisten unterbrachen die Koedukation teilweise wieder, da der Vorbereitung der Mädchen auf die Mutterschaft in der nationalsozialistischen Ideologie eine besondere Rolle eingeräumt wurde. 1933 und 1934 wurden in Sachsen und Preußen Gesetze erlassen, die Mädchen nur noch den Besuch von Mädchenschulen erlaubten.18
In der Regel war es üblich, daß Jungen und Mädchen drei oder vier Jahre gemeinsam die Volksschule besuchten, dann aber getrennt wurden. Die Jungen hatten die Möglichkeit sich in Latein unterrichten zu lassen. In den Mädchenschulen dagegen wurde Handarbeit und Musik unterrichtet. Desweiteren hatten Mädchen weder die Möglichkeit einen naturwissen- schaftlichen noch einen mathematischen Zweig zu belegen.19
2. 9. Koedukation in der BRD
Nach 1945 wurde in der späteren DDR die Koedukation sofort eingeführt, während in der „Westzone“ die Frage der Koedukation zunächst vernachlässigt wurde und man nach alten Strukturen weiter unterrichtete. Nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland (1948) fand die koedukative Erziehung zunehmend Eingang in die Schulverfassungen der Länder. Zur Regel wurde sie aber erst in den 70er Jahren.20
Die Lehrkörper wurden jedoch in keinster Weise auf ihre neuen Aufgaben, die mit Einführung der Koedukation zu leisten waren, vorbereitet. 1955 forderte der Philologenverband eine Vorbereitung der Lehrer. Doch in ei- ner Umfrage im Jahre 1988 an nordrhein - westfälischen Gymnasien kam folgendes heraus: „ Alle befragten Schulleiter und Studienrätinnen antwortetenübereinstimmend, daßdie Koedukation - außer der Schaffung der sanitären Voraussetzungen - in keinerlei Weise vorbe reitet worden sei, weder durch didaktische und curriculare Maßnah men noch durch Lehrerinnenweiterbildung “ 21
Seit Anfang der 80er Jahre ist die Diskussion über die Koedukation wieder aufgelebt. Denn die Hoffnungen der Koedukationsbefürworter haben sich nicht, oder nur zum Teil erfüllt. Mädchen können heute das Gleiche lernen und dennoch orientiert sich der Lernstoff in erster Linie an den Interessen und Bedürfnissen der Jungen. Desweiteren erschweren Geschlechtsste- reotypen und die Doppelbelastung der Frau durch Beruf und Familie die Aufstiegsmöglichkeiten und tragen immer noch zur Benachteiligung der Frauen bei.
2. 10. Zeittafel zur Koedukation
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
3. Situation heute
Koedukation wird von seiner Einführung bis heute als rein formale Organi- sationsform eines gemeinsamen Unterrichts von Mädchen und Jungen im gleichen Raum zur gleichen Zeit betrachtet, die unreflektiert und unbewußt traditionelle Rollenklischees weiter tradiert und nicht weiter hinterfragt. Im Laufe der Jahre hat sich gezeigt, daß diese Form des Unterrichts ihre Probleme mit sich bringt.
Als Beispiel werden Leistungen der Geschlechter anders beurteilt. Ein gu- ter Schüler gilt als intelligent und selbstbewußt, eine gute Schülerin hinge- gen als fleißig und angepaßt. Gute schulische Leistungen werden also bei Mädchen meist nicht mit Intelligenz in Verbindung gebracht.34 Desweiteren sagt man: „ Soziale Kompetenzen von Schülerinnen [...] werden zwar gebraucht, um Unterricht zu ermöglichen, werden aber meist nicht als erlernte Stärke und Kompetenzen wahrgenommen [...]. Im Gegen- satz zu den Mädchen erhalten Jungen Bestätigung für ihr dominan- tes und störendes [...] Verhalten. “ 35
Außerdem ist zu erkennen, daß es eine stark geschlechterspezifische Fä- cherwahl gibt. Mädchen belegen am stärksten die Fachrichtungen Spra- chen, Kultur-, Wirtschafs-, und Gesellschaftswissenschaften, während Jungen häufiger Ingenieur-, Mathematik-, und Naturwissenschaften wäh- len.36 Ein letzter Aspekt -auf den ich eingehen möchte- ist, daß obwohl Mädchen einen Abiturientenanteil von mittlerweile 54% ausmachen Frau- en in vielen Berufen und in höheren Stellungen der meisten Berufssparten noch immer unterrepräsentiert sind. Bezeichnend ist auch, daß 80% der Frauen in nur 25 Berufen ausgebildet sind. Diese Berufe werden meist geringer bezahlt, was mit einem geringeren sozialen Ansehen verbunden ist.37
„Koedukative Schulen sind, so scheint es jedenfalls, Jungenschulen, die auch Mädchen offenstehen.”
3. 1. Koedukative und getrennte Schule in Zahlen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
An dieser Tabelle ist deutlich zu erkennen, daß38 die koedukativen Schulen in Nordrhein-Westfalen, den getrenntgeschlechtichen Schulen zahlenmäßig überlegen sind. Das bedeutet, daß über 95% der Schüler in NRW koedukative Schulen besuchen.
3. 2. Pro und Kontra Koedukation (tabellarisch)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten39
4. Die reflexive Koedukation
Die reflexive Koedukation ist der Versuch die Koedukation zu verbessern. Es ist der Versuch, durch Schaffung von geschlechtshomogenen Gruppen und Sensibilisierung der Geschlechter für einander, das koedukative Le- ben zu beeinflussen.
Reflexive Koedukation bedeutet Beibehaltung und bewußte Verbesserung des koedukativen Unterrichts. Geschlechtshomogene Gruppen sollten je- doch je nach Lernsituation gebildet werden. Allerdings sind fächerbezoge- ne Schematisierungen auszuschließen. Ziel eines solchen Konzepts ist das gleichberechtigte Zusammenleben beider Geschlechter, in dem Ge- schlechterhierarchien abgebaut werden und somit ein neues Geschlech- terverhältnis aufgebaut wird.
4. 1. Heißt Koedukation auch Chancengleichheit?
Eines muß von vornherein klar sein; Selbst eine hinkende Koedukation ist besser als gar keine.40
Eine zeitweise Trennung der Geschlechter ist vielleicht kein sehr kreativer, aber doch ein oft sinnvoller Weg. An einigen Schulen in Deutschland wird er schon gegangen. Vor allem in den Fächern Mathematik, Naturwissenschaft und Technik.
Sind Mädchen nun also unter sich, dann können sie nicht nur ihre Ar- beitsweise und Interessen besser pflegen, sondern erzielen dabei auch noch bessere Ergebnisse, wie eine Studie von Hannelore Faulstich- Wieland und Anneliese Dick zeigt.41 Darüber hinaus arbeiteten die Mäd- chen auch kreativer und flexibeler. Ihre Ergebnisse waren phantasievoller und anspruchsvoller.
Mädchen durch einfache Raumtrennung Platz zu verschaffen, kann selbstverständlich nur der Anfang sein. Weitere kleine Schritte in die rich- tige Richtung könnten sein, Mädchen und Jungen immer abwechselt im Unterricht aufzurufen, damit eine ungerechte Aufmerksamkeitsverteilung gar nicht erst auftritt. Die Namen der Mädchen zuerst zu lernen, ihnen verstärkt positive Zuschreibungen zu machen > „Du kannst das“ <. Den Mädchen bewußt genauso wichtige und schwierige Fragen zu geben wie den Jungen. Darauf zu achten, daß Mädchen eine genauso lange Rede- zeit bekommen wie ihre männlichen Mitschüler, und diese wenn nötig durch gezielte Rückfragen zu verlängern. Desweiteren darauf zu achten, daß Kooperation in den Klassen höher bewertet wird als wettbewerbsorientiertes Verhalten.42
Manches hiervon mag mechanisch und aufgesetzt klingen: Beim Aufrufen abzählen oder mit der „Stoppuhr“ die Länge der Redebeiträge messen. Aber ein Problem wie dieses, daß so unterschwellig und schleichend da- herkommt, muß man eben in Greifbares und Konkretes versuchen umzu- wandeln.
Der nächste Schritt ist sicherlich rollentypische Verhaltensweisen und Einstellungen sichtbar zu machen und aufzubrechen, sowie rollenübergreifendes Verhalten zu fördern.43
Ein wichtiger Augenmerk sollte hier mit Sicherheit auf die Schulbücher gelegt werden. Die Darstellung von Männern und Frauen ist hier durchaus unterschiedlich. So werden Männer als arbeitend und geldverdienend dargestellt während Frauen nur als Anhängsel dieser Männer vorkommen. Hier ein Beispiel aus dem Mathematikunterricht: Herr K. gibt seiner Frau 500 DM für den Haushalt. Sie kauft für 80 DM Lebensmittel, für 60 DM eine Bluse, für 20 DM Socken und für 10 DM Zigaretten. Wieviel Prozent des Haushaltsgeldes hat sie ausgegeben?44
In dieser Aufgabe sind mehrere Sachverhalte versteckt:
1. Herr K. ist der „Ernährer“ der Familie.
2. Herr K. wird mit Namen genannt, währen Frau K. nur als seine Frau (Anhängsel) auftritt.
3. Der Mutter wird die typische Rolle der Hausfrau zugeteilt.
Weitere dieser Beispiele sind auch in allen anderen Fächern wiederzufin- den. Dieses Phänomen wird „heimlicher Lehrplan“ genannt. Das heißt, daß zwar vordergründig alle Schüler dasselbe lernen, die Prozentrech- nung, unterschwellig wird ihnen jedoch gleich eine vorbereitete “normale” Gesellschaftsform mitvermittelt (in diesem Beispiel: Mann arbeitet, Frau macht den Haushalt).
4. 2. Schule der Zukunft
In den neuen Richtlinien für die gymnasiale Oberstufe sowie für die Se- kundarstufe I der Gesamtschule wird in NRW ab 1999 eine „flexive Ko- edukation“ vorgeschrieben. Bis zum Jahr 2000 müssen sogar alle Schulen ein Programm vorlegen, in dem eine gezielte Mädchen- und Jungenförde- rung verankert ist.45
Was die Schule der Zukunft wirklich bringt ist schwer zu sagen. Klar ist nur, daß sie in ihrer jetzigen Form noch verbesserungswürdig ist. Die re- flexive Koedukation ist ein Schritt in die richtige Richtung. Dennoch bedeu- tet sie nicht Rückkehr zu getrennten Gruppen oder gar getrennten Schu- len, sondern Beibehaltung und bewußte Verbesserung des koedukativen Unterrichts. Geschlechtshomogene Gruppen sollten je nach Lernsituation gebildet werden.46
Grundsätzlich sollte sich das Angebot aber nicht nur an Mädchen richten, denn es geht nicht um Nachhilfe für Mädchen. Auch Jungen brauchen Förderung zu Beispiel im Bereich Sprache, oder bei dem was man soziale Kompetenz nennt. Es kommt darauf an, daß Jugendliche in der Schule nicht frühzeitig auf eingeschränkte Geschlechterrollen festgelegt werden.47
5. Schlußbemerkung
Ich hoffe, daß die Fragen der Einleitung alle beantwortet werden konnten. Ich denke, es ist im Verlaufe der Arbeit klar geworden, daß die Koedukati- on einen wichtigen Schritt in der Erziehung unserer Kinder darstellt. Es ist eine Errungenschaft, die wir nicht wieder über Bord werfen sollten sondern als Prinzip beibehalten müssen. Diese Koedukation kann nur nicht das Ende aller Bemühungen sein. Hier ist Reflexion ein ganz wichtiges Wort.
Wir müssen über unsere Unterrichtsformen weiter nachdenken und so zu Verbesserungen kommen. Wie wohl in der Arbeit klar geworden ist, geht es bei der reflexiven Koedukation nicht um einen feministischen Versuch der Frauen die Weltherrschaft an sich zu reißen sondern vielmehr darum, wie es möglich ist, Schule zu verbessern. Es geht um gezielte Förderung von Mädchen und Jungen. Es geht darum, daß auch Frauen mit Computern umgehen können; es auch männliche Entbindungshelfer geben darf, daß Frauen durchaus die Position einer Topmanagerin belegen können und auch Jungen miteinander über Probleme reden.
Reflexive Koedukation ist ein echter Schritt in Richtung einer wirklichen Gleichberechtigung der Geschlechter.
Zum Abschluß möchte ich noch sagen, daß eine Form der reflexiven Ko- edukation nicht nur in der Schule wichtig ist. Auch im „richtigen“ Leben müssen geschlechtsspezifische Barrieren und Vorurteile abgebaut wer- den. Die Schule kann hier sicherlich nur einen Teil der Arbeit übernehmen. Ein gesellschaftliches Umdenken auf diesem Gebiet ist genauso wün- schenswert.
6. Literaturverzeichnis
Arold, A.: Koedukation in der Diskusion. In: Faulstich-Wieland: Abschied von der Koedukation?. Frankfurt am Main1987
Beck-Gernshein, E.: Starke Männer - schwache Frauen?. In: FaulstichWieland: Abschied von der Koedukation?. Frankfurt am Main1987
Bildungskommision NRW: Zukunft der Bildung - Schule der Zukunft. Neuwied 1995
Bildungskommision NRW: Zukunft der Bildung - Schule der Zukunft. 2. Zwischenbericht, Neuwied 1996
Brehmer, I.: Koedukation in der Schule. Faulstich-Wieland: Abschied von der Koedukation? Frankfurt am Main1987
Faulstich-Wieland, H.: Koedukation - ein erledigtes Thema? In: Faulstich- Wieland, H. Abschied von der Koedukation? Frankfurt am Main 1987.
Faulstich-Wieland, H.: Koedukation-Enttäuschte Hoffnung?.Darmstadt 91
Knab, D.: Mädchenbildung. In: Speck / Wehle: Handbuch pädagogischer Grundbegriffe. München 1970.
Koch, F.: Geschlechterverhältnisse und Erziehung. In Pädagogik, 2/1996
Kraus, J.: Koedukation oder Resignation - Schule auf dem Weg zur Quo-te? In. DL - Aktuell 1998
Pfister, G.: Entwicklungslinien. In: Zurück zur Mädchenschule. Pfaffenheim 1988
Stalmann, F. Die Reform einer Reform. In Pädextra, 9/1991
[...]
1 Faulstich-Wieland, H: Koedukation - ein erledigtes Thema?. In: Faulstich-Wieland: Abschied von der Koedukation?. Frankfurt am Main 1987. S.8
2 vgl.: ebd., S. 9
3 vgl.: Brehmer, I.: Koedukation in der Schule. In: Faulstich-Wieland: Abschied von der Koedukation?. a.a.O., S. 81
4 Faulstich-Wieland, H.: Koedukation - ein erledigtes Thema?. a.a.O., S. 9
5 vgl.: ebd., S. 10
6 vgl.: Brehmer, I.: a.a.O., S. 81-82
7 vgl.: Faulstich-Wieland, H.: Koedukation - Enttäuschte Hoffnung?. Darmstadt 1991., S. 11
8 Arolt, A.: Koedukation in der Diskussion. In: Faulstich-Wieland: Abschied von der Koedukation. a.a.O., S. 53
9 Faulstich-Wieland, H.: Koedukation - Enttäuschte Hoffnung?. a.a.O., S. 15
10 Arold, A.: a.a.O., S. 51
11 vgl.: Beck-Gernsheim, E.: Starke Männer - schwache Frauen?. In: Faulstich-Wieland: Abschied von der Koedukation. a.a.O., S. 20
12 vgl.: Faulstich-Wieland, H.: Koedukation - ein erledigtes Thema?. a.a.O., S. 12
13 vgl.: Faulstich-Wieland, H.: Koedukation - Enttäuschte Hoffnungen?. a.a.O., S. 24
14 ebd., S. 24
15 Arold, A.: a.a.O., S. 63
16 Faulstich-Wieland, H.: Koedukation - Enttäuschte Hoffnung?. a.a.O., S. 27
17 ebd.: S. 28 ff
18 Faulstich-Wieland, H.: Abschied von der Koedukation?. a.a.O., S. 84
19 ebd.: S. 84
20 ebd.: S. 84
21 Faulstich-Wieland, H.: Koedukation - Enttäuschte Hoffnung?. a.a.O. S. 32 ff
22 Pfister, G.: Entwicklungslinien. In: Zurück zur Mädchenschule. G. Pfister. Pfaffenheim 1988., S. 14
23 Arolt, A.: Koedukation in der Diskussion. In: Faulstich-Wieland: Abschied von der Koedukation?. a.a.O. S. 53
24 Arolt, A.: a.a.O., S 51
25 ebd.
26 Knab, D.: Mädchenbildung. In: Speck / Wehle: Handbuch pädagogischer Grundbegriffe. München 1970. S. 57 ff
27 Brehmer, I.: Koedukation in der Schule. In. Faulstich-Wieland: Abschied von der Koedukation?. a.a.O., S. 83
28 Pfister, G.: a.a.O., S. 218
29 Faulstich-Wieland, H.: Koedukation - ein erledigtes Thema?. In: Faulstich-Wieland: Abschied von der Koedukation?. a.a.O., S. 8
30 Knab, D.: a.a.O.
31 Brehmer, I.: a.a.O., S. 85
32 Kraus, J.: Koedukation oder Designation In: Deutscher Lehrerverband Aktuell Bonn 1998
33 ebd.
34 vgl.: Brehmer, I.: a.a.O., S. 97
35 ebd.:, S. 98
36 ebd.:, S. 99
37 vgl.: Bildungskommision NRW: Zukunft der Bildung - Schule der Zukunft. Neuwied 1995
38 Faulstich-Wieland, H.: Abschied von der Koedukation?. a.a.O., S. 86
39 Faulstich-Wieland, H.: Abschied von der Koedukation?. a.a.O., S. 103 ff
40 vgl.: Stalmann, F.: Die Reform einer Reform. In Pädextra, September/1991. S. 6-10
41 ebd.:
42 ebd.:
43 ebd.:
44 vgl.: Koch, F.: Geschlechterverhältnisse und Erziehung. In Pädagogik, 2/96, S. 58
45 Kraus, J.: Koedukation oder Desintegration. In: DL - Aktuell. 1998
46 Bildungskommision NRW: Zukunft der Bildung - Schule der Zukunft. 2. Zwischenbericht, Neuwied 1996
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments über Mädchenbildung und Koedukation?
Dieses Dokument ist eine umfassende Analyse der Geschichte der Mädchenbildung und der Koedukation (gemeinsamer Unterricht von Jungen und Mädchen) von der Antike bis zur Gegenwart, mit einem besonderen Fokus auf Deutschland. Es untersucht die Entwicklung der Bildungssysteme, die Rolle der Frauenbewegung und die Debatte über die Vor- und Nachteile der Koedukation.
Welche Themen werden in der Geschichte der Mädchenbildung und der Koedukation behandelt?
Das Dokument behandelt die Mädchenbildung von der Antike bis zum Mittelalter, die Entwicklungen im 16., 17. und 18. Jahrhundert, das Schulsystem im 18. und 19. Jahrhundert, den Beginn der Frauenbewegung, die Mädchenbildung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die Weimarer Republik und die Zeit des Nationalsozialismus. Abschließend wird die Koedukation in der BRD beleuchtet.
Wie wird die aktuelle Situation der Koedukation in Deutschland dargestellt?
Das Dokument analysiert die Koedukation in der heutigen Zeit anhand von Zahlen und Fakten. Es werden die Vor- und Nachteile der Koedukation tabellarisch dargestellt, die Verteilung koedukativer und getrennter Schulen in Nordrhein-Westfalen untersucht und die geschlechterspezifische Fächerwahl thematisiert.
Was ist "reflexive Koedukation" und wie wird sie in diesem Dokument behandelt?
Die reflexive Koedukation wird als ein Ansatz zur Verbesserung der Koedukation dargestellt. Es handelt sich um den Versuch, durch die Schaffung von geschlechtshomogenen Gruppen und die Sensibilisierung der Geschlechter füreinander das koedukative Leben zu beeinflussen. Es geht darum, Gleichberechtigung zu fördern, Geschlechterhierarchien abzubauen und ein neues Geschlechterverhältnis aufzubauen.
Welche Kritik wird an der aktuellen Form der Koedukation geübt?
Das Dokument kritisiert, dass die Koedukation oft als rein formale Organisationsform betrachtet wird, die unreflektiert traditionelle Rollenklischees weiter tradiert. Es wird argumentiert, dass die Leistungen der Geschlechter unterschiedlich beurteilt werden, dass es eine geschlechterspezifische Fächerwahl gibt und dass Frauen in vielen Berufen und höheren Stellungen unterrepräsentiert sind.
Welche Vorschläge werden zur Verbesserung der Koedukation gemacht?
Das Dokument schlägt vor, zeitweise Trennungen der Geschlechter in bestimmten Fächern (insbesondere Mathematik, Naturwissenschaft und Technik) einzuführen. Außerdem werden Maßnahmen zur Förderung von Mädchen und Jungen vorgeschlagen, um sicherzustellen, dass Jugendliche nicht frühzeitig auf eingeschränkte Geschlechterrollen festgelegt werden. Das Dokument betont auch die Bedeutung der Schulbücher und des "heimlichen Lehrplans" bei der Vermittlung von Geschlechterbildern.
Was sagt das Dokument über die Zukunft der Schule?
Das Dokument erwähnt, dass in Nordrhein-Westfalen ab 1999 eine "reflexive Koedukation" vorgeschrieben wird und dass bis zum Jahr 2000 alle Schulen ein Programm vorlegen müssen, in dem eine gezielte Mädchen- und Jungenförderung verankert ist. Es wird jedoch betont, dass reflexive Koedukation keine Rückkehr zu getrennten Gruppen oder Schulen bedeutet, sondern die bewusste Verbesserung des koedukativen Unterrichts.
Welche Schlussfolgerung zieht das Dokument?
Das Dokument kommt zu dem Schluss, dass die Koedukation ein wichtiger Schritt in der Erziehung unserer Kinder ist, der nicht wieder aufgegeben werden sollte. Reflexion und Weiterentwicklung der Unterrichtsformen sind jedoch notwendig, um die Koedukation zu verbessern und eine echte Gleichberechtigung der Geschlechter zu erreichen. Das Dokument betont, dass ein gesellschaftliches Umdenken auf diesem Gebiet genauso wünschenswert ist.
- Arbeit zitieren
- Edmund Pätsch (Autor:in), 2000, Ist Koedukatio Chancengleichheit?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97972