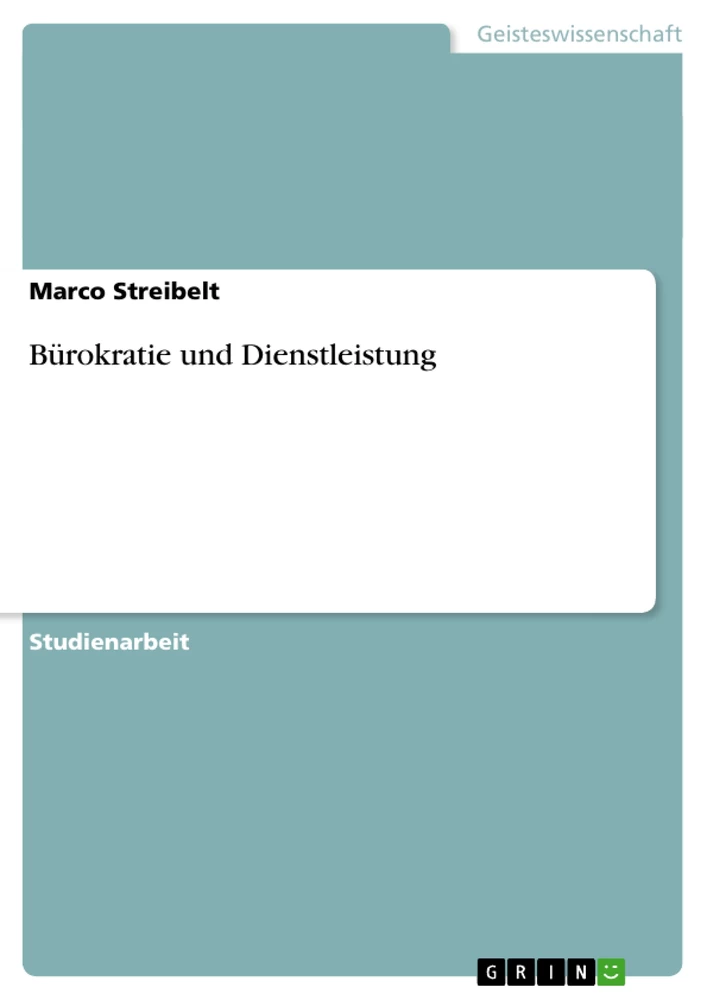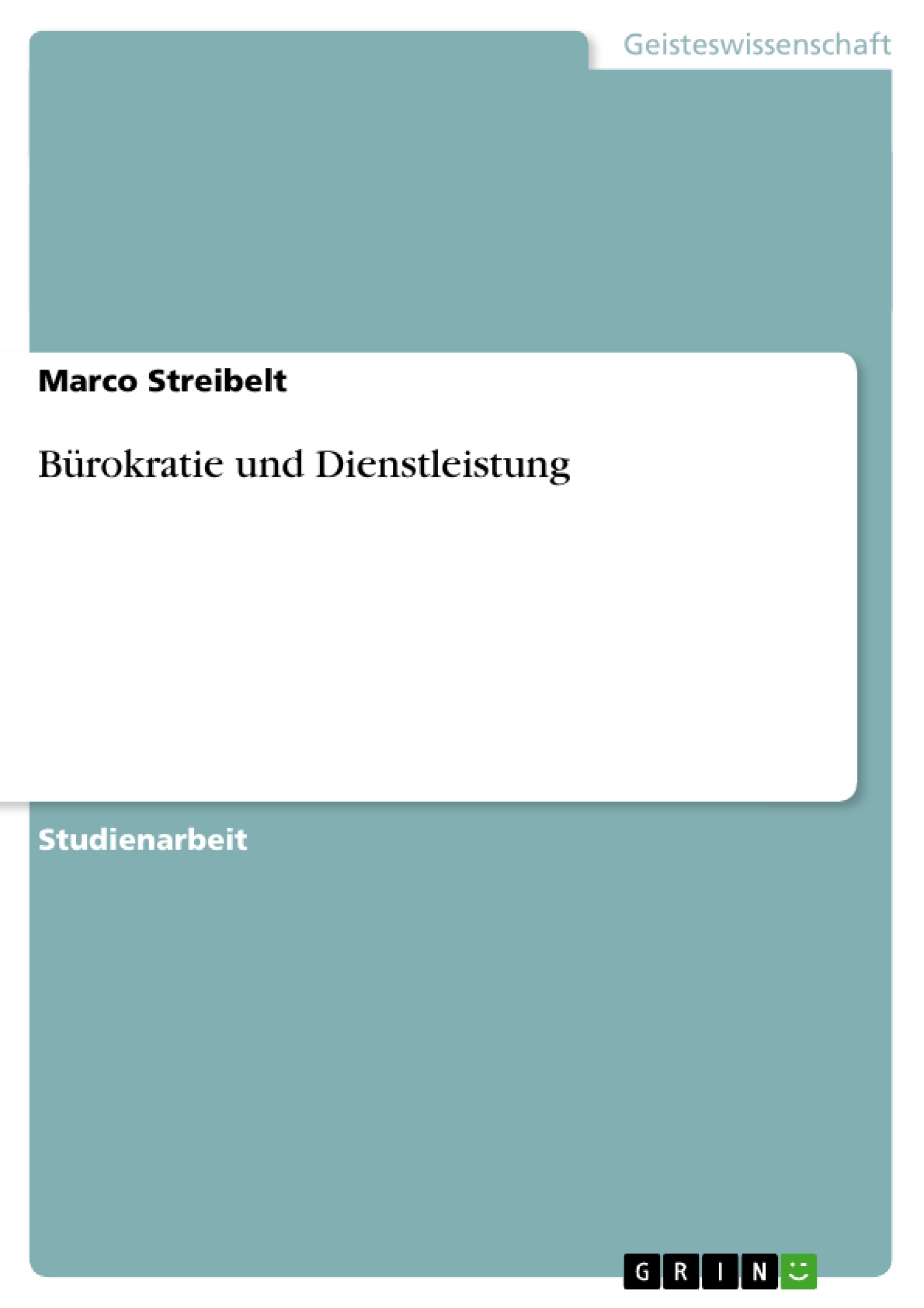Inhalt
1 EINLEITUNG
2 DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFTEN
2.1 DER BEGRIFF DER DIENSTLEISTUNG
2.2 KLASSISCHE ANSÄTZE
2.2.1 Die Optimisten
2.2.2 Die Pessimisten
2.3 URSACHEN FÜR DIE TERTIÄRE EXPANSION
2.3.1 Ökonomische Theorien
2.3.2 Die soziologische Betrachtung des Problems
2.4 EXKURS - DER FLEXIBLE MENSCH: WANDEL INDIVIDUELLER LEBENSFÜHRUNG DURCH GESELLSCHAFTLICHEN WANDEL
2.4.1 Drift und Scheitern
2.4.2 Fazit
3 BÜROKRATIE UND DIENSTLEISTUNG
3.1 BEGRIFF DER BÜROKRATIE NACH WEBER
3.2 KOORDINIERUNGSFALLE DER BÜROKRATIE - DIE MAKRO-EBENE
3.2.1 Externalisierung
3.2.2 Intra-Tertiarisierung
3.3 STIL STATT ROLLE - DIE MIKRO-EBENE
3.3.1 Rollenerosion
3.3.2 Von der Aussen- zur Innenleitung
3.4 IDEALTYPUS DER DIENSTLEISTUNGSRATIONALITÄT
3.4.1 Konzept des Idealtypus nach Weber
3.4.2 Bürokratischer Mensch vs. Dienstleister
4 ZUSAMMENFASSUNG
5 LITERATUR
1 Einleitung
Schlägt man heutzutage die Zeitung auf, liest man allerorts, die Expansion des Dienstleistungssektors würde unsere Wirtschaft gesunden lassen und die Arbeitslosenzahlen spürbar senken. Schon Rüttgers1 sah 1998 als einzige Lösung des Beschäftigungsproblems die politischen Rahmenbedingungen nach amerikanischem Vorbild auf die Ausweitung des tertiären Sektors auszurichten. Für ihn entstehen nicht nur die sogenannten und in den USA weit verbreiteten Mc Jobs, auch die Berufe des oberen Lohnsegments würden expandieren. Die einzige Möglichkeit zur Modernisierung des Staates Deutschland führt über die Dienstleistungsgesellschaft.
Doch nicht nur die Politik, auch Wirtschaft und Wissenschaft sehen uns auf dem Sprung in eine neue Gesellschaftsform. Die Entstehung von Dienstleistungen wird als eine der herausragenden Entwicklungen des 20.Jahrhunderts gesehen. Doch ist diese Form der Leistungserbringung tatsächlich so neu, wie allerorts behauptet? Es besteht durchaus Grund zur Kritik.
Wird das Thema nämlich, entgegen der öffentlichen Diskussion, aus soziologischer Perspektive betrachtet, so lässt sich durchaus die These aufstellen, Dienstleistungen gab es nicht nur schon immer, sie waren in früherer Zeit noch viel verbreiteter2. Um die Wende zum 20. Jahrhundert boomte die Land-Stadt-Wanderung. Viele Menschen kamen in die Industriestädte, um Arbeit zu finden und der Engstirnigkeit und Rückständigkeit ländlicher Gegenden zu entfliehen. Doch war das Potential an Arbeit auf das männliche Geschlecht begrenzt. Frauen mussten, wollten sie ebenfalls in die Städte, andere Arbeitsbereiche finden. Dies eröffnete sich im Dienstbotentum. Als Amme, Köchin oder Wäscherin verdienten sich viele junge Frauen zu dieser Zeit ihren Lebensunterhalt3. Unter oftmals schlechten Arbeitsbedingungen (so war Feierabend für Dienstboten ein Fremdwort) und der rigiden Herrschaft der Hausherren entwickelte sich ein Arbeitsverhältnis, welches Nerdinger sehr treffend als „Macht und soziale Distanz bei gleichzeitiger Intimität“4 bezeichnet. Der Unterschied zwischen damals und heute erbrachter Dienstleistung, so man die Dienstboten als die Dienstleister des 19.Jh. titulieren kann, liegt im Verhältnis zum Kunden. Die moderne Dienstleistung ist durch kooperative Handlung zwischen Dienstleister und Kunde auf Vertrauensbasis definiert. Beide Partner sind gleichberechtigt und vom jeweils anderen abhängig, wollen sie ihr Ziel erreichen. Das Verhältnis der Herrschaften zu ihren Dienstboten dagegen ist durch die unterschiedliche soziale Position und der darauf gegründeten Macht der Herrschaften gegenüber den Dienstboten gekennzeichnet. Dienstmädchen waren ein Gebrauchsgegenstand mit nur geringer Möglichkeit der eigenen Ausgestaltung des Lebensraums. Die Begegnung Dienstleister-Kunde dagegen wird in jeder neuen Situation neu definiert und ist in institutionelle und normative Rahmenbedingungen eingefasst.
Das Problem wird deutlich: Geht man von der reinen Absicht der Leistungserbringung am Menschen aus, so sind die Dienstbotenverhältnisse durchaus als Dienstleistung aufzufassen. Stellen jedoch gewisse Regeln im Umgang miteinander (Einmaligkeit der Handlung, Kooperation) erst den nötigen Rahmen zur Definition des Begriffs Dienstleistung, so befinden wir uns mit unserer eingangs behaupteten These im Irrtum.
Genau an diesem Punkt scheiden sich in der Literatur die Geister. Wie sind Dienstleistungen zu definieren? Was sind die Ursachen für die Ausbreitung tertiärer Strukturen und Handlungen? Und nicht zuletzt, wo führt die bestehende Entwicklung uns hin?
Mit diesen Fragen wird sich die folgende Arbeit auseinandersetzen. Schon seit geraumer Zeit werden Theorien und Erklärungsversuche aus den verschiedenen Wissenschaften, vor allem der Soziologie und der Ökonomie, abgeliefert. Im zweiten Teil werden wir die wichtigsten kurz anreißen, um dann im dritten Teil der Arbeit einer Herangehensweise besonders viel Aufmerksamkeit zu schenken: Der Herausbildung tertiärer Strukturen aus den Defekten der Bürokratie.
2 Dienstleistungsgesellschaften
2.1 Der Begriff der Dienstleistung
Als Dienstleistungsgesellschaft werden jene Gesellschaften betitelt, „...deren Beschäftigungsstruktur durch ein Übergewicht von Dienstleistungen gekennzeichnet ist.“5 Eine genaue Definition bleiben Häußermann/Siebel uns zwar schuldig, doch wird durch die folgenden Überlegungen relativ klar werden, wie der Begriff der Dienstleistung abzugrenzen und weiter zu verwenden ist.
Um den Begriff der Dienstleistungen in ein verwertbares Schema zu pressen, sind einige Vorüberlegungen nötig. In erster Linie stellt sich die Frage, wie Dienstleistungen von anderen Tätigkeiten des Wirtschaftslebens abgegrenzt werden können. Dies erweist sich als schwierig, denn es fällt auf, dass klassische Dienstleister wie der Friseur oder der Arzt natürlich vom Facharbeiter durch eine Vielzahl von Argumenten unterschieden werden können, doch erfordert es schon eine differenziertere Betrachtung, wenn es um Berufe geht, die beide Eigenarten, die Produktion und die Dienstleistung, in sich vereinen. Es stellt sich beispielsweise die Frage, inwiefern ein Sachbearbeiter der Personalabteilung zum tertiären Bereich gezählt werden kann, ist er doch in einem Produktionsunternehmen angestellt, also indirekt auch am Produktionsprozess beteiligt. Seine eigentliche Tätigkeit erfüllt aber eher dienstleistungsbezogene Arbeiten. Häußermann/Siebel unterscheiden daher die sektorale und die funktionale Gliederung des Wirtschaftslebens.
Die sektorale Gliederung spaltet sich in drei Sektoren auf, den primären Sektor, der die Landwirtschaft und die Fischerei beinhaltet, den gesamten Bereich der Industrieproduktion im sekundären Sektor und eben die Dienstleistungen im tertiären Sektor. Diese Aufteilung beschreibt Dienstleistungen im wesentlichen als die Tätigkeiten, die den anderen beiden Sektoren nicht zugeordnet werden können.
Nerdinger spricht aus diesem Grund auch von der Dienstleistung als einem Residualbegriff, der „...über eine negative Abgrenzung zum Gewohnten das Ungewohnte zu verstehen,...“6 versucht. Als problematisch erweist sich dabei, dass man bei der sektoralen Gliederung dem Endprodukt des jeweiligen Betriebes folgt. Der oben beschriebene Personalbearbeiter würde also in der amtlichen Statistik im sekundären Bereich geführt, da das Unternehmen, in welchem er arbeitet, ein Produktionsbetrieb ist. Bleibt man bei diesem Schema, lässt sich in den letzten Jahrzehnten eine Verschiebung des Schwerpunktes vom sekundären Sektor zum tertiären erkennen. Dies hat laut Häußermann/Siebel seine Gründe in der zunehmenden Rationalisierung des sekundären Bereiches, der permanent Arbeitskräfte freisetzt, die im tertiären Sektor neue Arbeit finden. Dienstleistungen sind nämlich nach Meinung vieler Autoren - im Gegensatz zur Produktion - rationalisierungsresistent. Es ist nicht möglich, durch Prozess- oder Produktinnovationen wesentliche Tätigkeiten durch maschinelle Vorgänge zu ersetzen, da tertiäre Elemente in erster Linie durch den direkten Kontakt von Dienstleister und Kunde gekennzeichnet sind. Diese Art der Dienstleistungen kann man als konsumoder personenorientierte Dienstleistungen definieren.
Durch die funktionale Gliederung werden die Betriebe nicht nach ihrem Endprodukt bewertet, sondern nach den vorherrschenden Tätigkeiten der Beschäftigten. In diesem Fall wird unser Personalsachbearbeiter also in der Statistik im tertiären Bereich geführt, während der Facharbeiter aus dem gleichen Unternehmen als an der Produktion direkt beteiligt und somit im sekundären Sektor angesiedelt wird. Dieses Beispiel macht auch einen weiteren Aspekt der Dienstleistungsgesellschaft deutlich. Es nimmt nicht nur die Zahl der Dienstleistungsunternehmen zu, auch innerhalb der Unternehmensstrukturen vermehrt sich die Zahl derer, die nicht mehr direkt am Produktionsprozess beteiligt sind. Forschung und Entwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und nicht zuletzt das Human Ressource Management binden immer mehr Arbeitskräfte, während im Produktionsbereich die schon beschriebenen Rationalisierungen zu einem Sinken der Beschäftigtenzahlen führen. Die Tätigkeiten, die diesem Rationalisierungsprozess nicht unterliegen, sondern im Gegenteil immer mehr an Bedeutung gewinnen, werden auch als produktionsorientierte Dienstleistungen beschrieben7.
Nerdinger sieht den grossen Unterschied zu anderen Tätigkeiten darin, dass Dienstleistungen im wesentlichen durch das „uno-actu-Prinzip“ gekennzeichnet sind, der gleichzeitigen Herstellung und Konsumption des Produktes. Es besteht also immer auch ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Dienstleister und seinem Kunden, da dieser nur durch seine - teilweise stillschweigende - Zustimmung zum Gelingen der Handlung beiträgt. Nerdinger trennt aus diesem Grund die direkten Dienstleistungen von anderen Beschäftigungen durch mehrere Attribute, die gleichzeitig zu einer Art Definitionsversuch zusammengefasst Dienstleistungen wie folgt beschreiben:
„ Unter Dienstleistungen werden hier also jene Problemlöse-TÄtigkeiten verstanden, die es erfordern, dass Dienstleister in face-to-face Interaktionen zu
Bedienten treten, mit denen sie nichts weiter verbindet als der Tausch „ Leistung gegen Geld “ . “ 8
Diese Definition ist allerdings etwas zu eng gefasst. Wir werden an späterer Stelle noch sehen, dass es etwas mehr bedarf, den Begriff der Dienstleistung vollständig zu beschreiben. Wichtig ist jedoch, dass zu einer Dienstleistung immer mindestens zwei Parteien gehören, und dass diese in Kooperation ein Problem versuchen zu lösen. Nerdinger fasste dies in seiner Dyade zusammen, die hier nicht weiter erläutert sei. Sie stellt im Wesentlichen das Verhältnis Bedienter-Dienstleister grafisch dar9.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Dienstleistung ein sehr heterogener Begriff ist, den zu fassen es sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich ist. Allein durch den Fakt, dass er sich von der reinen Produktion unterscheidet, macht ihn - ökonomisch gesehen - zu einer eigenständigen Tätigkeit. Und diese Tätigkeiten sind in der heutigen Zeit in den fortschrittlichen Industriestaaten immer mehr auf dem Vormarsch, sei es durch Auslagerung oder Neugründung von Dienstleistungsunternehmen oder durch Wandel der Beschäftigungsstruktur innerhalb traditioneller Betriebe. Im Zuge dieser Unterscheidung der Ausbreitung spricht man von personen- oder konsumorientierten und produktionsorientierten Dienstleistungen.
2.2 Klassische AnsÄtze
Grundlegend für die Beschäftigung mit dem Phänomen der Dienstleistungen war die sogenannte Drei-Sektoren-Theorie von Colin Clark im Jahre 1940. Er bezeichnete die Agrarwirtschaft als den ersten Sektor, die Industrieproduktion als zweiten und den tertiären Bereich der Wirtschaft als den dritten Sektor. Seine Aufteilung folgte der Fishers und unterschied im Wesentlichen die Sektoren nach dem Grad ihrer Notwendigkeit in der Bevölkerung. Die Güter der landwirtschaftlichen Produktion sah er als lebensnotwenidg an, die der Industrieproduktion als relativ notwendig. Dementsprechend handelte es sich beim dritten, dem tertiären Sektor um den Konsum von nicht unbedingt notwendigen Luxusgütern. Fourastié10 dagegen unterschied im Jahre 1954 die drei Sektoren nicht nach ihrer konsumptiven Notwendigkeit, sondern nach der Höhe ihrer Produktivitätspotentiale. Dem ersten Sektor, der Landwirtschaft, diagnostizierte er eine normale Produktivitätsneigung, der Industrieproduktion als zweitem Sektor eine sehr hohe, und den dritten Sektor beschrieb er als überhaupt nicht oder nur tangential produktivitätssteigernd.
2.2.1 Die Optimisten
Fourastié schliesslich ist es auch, der als „Vater der Debatte“11 um die Dienstleistungsgesellschaft gilt. Er prognostizierte, dass die Konsumneigung der Menschen sich durch Übersättigung und Wohlstand zum tertiären Sektor hin verändern wird. Genau wie die Menschen vom Land in die Stadt wanderten, weil der Markt für Nahrungsmittel übersättigt war, so werden sie an einem Punkt der Überproduktion der Industrie aufgrund von Produktivitätssteigerungen nach anderen Mitteln suchen, ihre veränderten Bedürfnisse zu befriedigen. Dadurch steigt die Nachfrage nach Dienstleistungen, also nach Gütern und Produkten des tertiären Sektors, so dass hier die in der Produktion durch Rationalisierung freigesetzten Arbeitskräfte neue Arbeitspotentiale finden werden.
Dieser „Hunger nach Tertiärem“12 fusst auf zwei Annahmen. Erstens sind Dienstleistungen zeitsparend, d.h. sie schaffen eine höhere Effektivität. Der Mensch wird nun nicht mehr seine täglichen Aufgaben selbst erledigen, sondern sie durch Dienstleistungen erbracht wissen. Zweitens folgt aus der allgemeinen Sättigung des Konsums eine Verfeinerung des individuellen Geschmacks, der dazu dient, insbesondere die „...Differenz zu anderen zu betonen.“13
Eine andere Erklärung für die Ausbreitung tertiärer Elemente, insbesondere in den industriellen Einrichtungen, sieht Fourastié in der steigenden Vergeistigung der Arbeit, die durch technischen Fortschritt in der Industrie unverzichtbar wird. Konsequenz wird eine Anhebung des allgemeinen Bildungsgrades und eine Wohlstandssteigerung in der Gesellschaft sein.
Genau wie Fourastié unterteilt auch Daniel Bell14 die Gesellschaft in drei Wirtschaftssektoren. Doch liegt sein Schwerpunkt der Betrachtung auf der produktionsorientierten Dienstleistung. Für ihn ist die nachindustrielle Gesellschaft, in die die Entwicklung münden wird, durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet:
In der Wirtschaft werden die Dienstleistungen über die Güter der Industrieproduktion dominieren. Technisch qualifizierte und sehr spezialisierte Tätigkeiten, die mit einer hohen Anhäufung an Wissen korrelieren, werden auf dem Arbeitsmarkt an Bedeutung gewinnen. Dadurch wird theoretisches Wissen zum axialen Prinzip werden, und zur eigentlichen Ressource, die es zu schützen gilt. Alte Machtmittel wie das „Kapital“ oder das „Amt“, also die Position innerhalb des Machtapparates verlieren an Bedeutung. Statt unkoordinierter ad-hoc-Reaktionen wird die Gesellschaft mit Hilfe modernster Technologie in der Lage sein, Risiken berechenbar zu machen und damit prophylaktisch auszuschalten. So könnte es möglich werden, die Gesellschaft planbar zu machen und staatliche Eingriffe so zu gestalten, dass sie nicht mehr konträr zum wirtschaftlichen Prozess wirken. Die Schlüsselpositionen bei der Lösung dieses Problems werden von wissensintensiven Berufsgruppen wie Ingenieuren oder Wissenschaftlern eingenommen.
Weil theoretisches Wissen in der postindustriellen Gesellschaft, wie Bell seine Gesellschaftsform nennt, Macht ist und sich letztlich über das Kapital oder den Status erheben wird, gehören nach Bell Wissenschaftler und Technokraten zur künftigen politischen Elite.
Bells Zukunftsversion der postindustriellen Gesellschaft mutet, gerade in letzter Konsequenz, sehr utopisch an, doch sind die Entwicklungslinien, die er aufzeigt, durchaus nachvollziehbar und in der Gegenwart auch partiell eingetreten. Die wichtigste Erkenntnis ist wohl die steigende Bedeutung der Dienstleistungen und ihrer wichtigsten Ressource, des Wissens.
Gartner/Riesman betrachten das Vordringen, vor allem der personenbezogenen Dienstleistungen, unter dem Aspekt der Veränderung in den Wertvorstellungen und einem Demokratiegewinn in der Gesellschaft. Sie argumentieren auf folgende Weise:
Genau wie Fourastié und Bell stellen auch sie eine Zunahme an Dienstleistungen fest, die immer mehr an Bedeutung gewinnen. Insbesondere für den Zugang zu anderen gesellschaftlichen Privilegien sind gewisse Dienstleistungen (Schule, Ausbildung) unverzichtbar geworden. Dabei kommt den personenbezogenen Dienstleistungen eine besondere Rolle zu. Sie sind „...von der Natur der Sache her wohltätig.“15, weil sie durch eine Mensch-Mensch-Beziehung definiert sind, in der es primär um das Wohlergehen des Konsumenten geht, dessen Erreichen sowohl ihm als auch dem Produzenten der Dienstleistung zugute kommt. Hier zeigen sich Parallelen zu Nerdinger. Der Konsument ist in den Prozess der Zielerreichung mit eingebunden. So wird ihm ein gewisser Machtzuwachs zuteil. Durch diese doppelte Abhängigkeit der Dienstleistung - vom Produzenten und vom Bedienten gleichermassen - wird die Dienstleistung zu einer gesellschaftlich wohltätigen Handlung. Grundlegende Veränderungen auf gesellschaftlicher Ebene, hier denken Gartner/Riesman z.B. an Schulreformen o.ä. sind so nur noch mit Zustimmung und Hilfe der Konsumenten, also z.B. der Schüler, möglich.
Konsequenz aus dieser Entwicklung wird ein Wertewandel weg von industriellen hin zu postmateriellen Orientierungen und eine erhöhte politische Partizipation der gesellschaftlichen Basis sein.
2.2.2 Die Pessimisten
Diesen optimistischen Theorien, oder besser Visionen, stehen Ansichten gegenüber, die die allgemeine Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft mit eher skeptischen Augen sehen. Vor allem Baumol und Gershuny16 wären hier zu nennen.
Baumols Theorie der Kostenkrankheit impliziert im Wesentlichen folgenden Sachverhalt:
Dienstleistungen werden von ihm als insgesamt produktivitätsavers bezeichnet und können so dem nichtprogressiven Bereich der Produktion zugeordnet werden, wogegen Industrieproduktion dem progressiven Bereich angehört. Beim Kostenvergleich der beiden Bereiche können alle Kostenarten bis auf die der Arbeit vernachlässigt werden. Geht man nun von der Prämisse aus, dass sich die Löhne in beiden Bereichen trotz unterschiedlicher Produktivitätszuwächse gleich entwickeln und der Entwicklung des Produktivitätszuwachses des progressiven Bereiches entsprechen, folgt daraus, dass die Produkte des nichtprogressiven Sektors immer teurer werden, ohne entsprechende Steigerung der Produktivität. Sie werden vom Markt verschwinden, weil sie zu teuer und unrentabel werden. Genau das prognostiziert Baumol für die Dienstleistungen. Entweder ihre Entwicklung stagniert oder sie werden vom Staat künstlich erhalten, was zu einer endlosen Kostenspirale führt, die letztendlich an „...unübersteigbare finanzielle Schranken stösst.“17 oder die Dienstleistungen, wenn nicht staatlich unterstützt, an der Kostenkrankheit sterben lässt.
Gershuny dagegen widerspricht der These von der Expansion der Dienstleistungsgesellschaft mit zwei statistisch begründeten Einwänden. Erstens rührt die Erhöhung der Beschäftigung im Dienstleistungssektor nicht an der unveränderten privaten Nachfrage an Dienstleistungen, weil diese Zunahme nur durch produktionsorientierte Dienstleistungen unterstützt wird. Die Firmen lagern aus, statt neue Potentiale zu schaffen. Zweitens hat sich, bei preisbereinigter Betrachtung, der Gesamtkonsum (also private und staatliche Nachfrage) an Dienstleistungen in 40 Jahren nur um rund drei Prozent erhöht. Es gibt laut Gershuny keine Tendenz zu mehr konsumorientierter Dienstleistungen, sondern vielmehr substituieren die Haushalte diese durch eine Mischung aus Industrieprodukten und Heimarbeit (beispielsweise ersetzen die Waschmaschine und das Waschen zu Hause den Waschsalon). So sieht Gershuny die Entwicklung nicht in Richtung der Dienstleistungsgesellschaft, sondern einer Selbstbedienungsgesellschaft18.
Nicht alles, was von den „Klassikern“ der Theorie der Dienstleistungsgesellschaft prophezeit wurde, bewahrheitete sich. Doch wurde durch diese - positiven wie negativen - Überlegungen eine Diskussion vom Zaun gebrochen, der sich in heutiger Zeit viele Wissenschaftler weder entziehen können noch wollen. Werfen wir einen Blick auf die bedeutendsten Beiträge.
2.3 Ursachen für die tertiÄre Expansion
Der Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft wird in heutiger Zeit besonders von zwei wissenschaftlichen Disziplinen mit immer grösserem Interesse betrachtet, von der Ökonomie und der Soziologie. In der Ökonomie interessiert dabei vor allem, inwiefern Dienstleistungen zu Wohlstandssteigerungen in der Gesellschaft führen. Dabei kommt einem Problem stärkere Bedeutung zu: Durch den Wandel kann es nur zu Wohlstandssteigerungen kommen, wenn Dienstleistungen produktiv sind, also dadurch wirklich potentielle Beschäftigungszuwächse erreicht werden können. In der soziologischen Diskussion dagegen ist entscheidend, welche gesellschaftlichen Funktionen durch die Expansion des tertiären Sektors erfüllt werden und wie dies geschieht.
2.3.1 Ökonomische Theorien
Ökonomen haben erkannt, dass es ein gesteigertes Bedürfnis nach Dienstleistungen gibt, welches sich in erhöhter Nachfrage nach diesen niederschlägt.
Folge wäre ökonomisches Wachstum und damit mehr Beschäftigung. Einzig entscheidend ist dabei die Frage nach der Produktivität tertiärer Produkte. Produktiv sind in der Regel investive Güter, da diese unmittelbar auf die Produktion einwirken und so auch unmittelbar multiplikative Wachstumseffekte erzielen. Sollten sich Dienstleistungen allerdings auf rein konsumptive Nachfrage beziehen, so wären höchstens Nachfrageeffekte zu erwarten, die sich, wenn überhaupt, nur mittelbar auf das Wachstum einer Gesellschaft auswirken. Bei der Unterteilung, die die einzelnen Ökonomen hierbei vornehmen, wird eines besonders deutlich: Je nach dem, welche Prämissen man zugrunde legt, ergeben sich unterschiedliche Ergebnisse.
Smith bescheinigt der Tätigkeit produktiven Charakter, die in einer verkäuflichen Ware mündet. Damit spricht er nicht die Beschaffenheit des Produktes an, sondern die Art seiner Verwendung. Auch Mill und Marx folgen bei ihrer Unterteilung dem Verwendungszusammenhang.
Mill sieht z.B. nur die Arbeit als produktiv an, die „...eine permanente Quelle des Genusses“19 schafft. Dem stofflichen Charakter lässt Mill dabei keine Bedeutung zukommen. Für ihn ist allein entscheidend, ob sich der „Genuss“, der sich aus der Benutzung des Produktes ergibt, von Dauer ist oder nicht. Am Beispiel der Madame Pasta macht er dies unmissverständlich deutlich: Die musikalische Vorführung ist gänzlich unproduktiv, da sie nur dem Augenblick der Veranstaltung selbst Genuss verschafft, danach jedoch verbraucht ist. Ihre Ausbildung zur Sängerin dagegen ist ein produktives Gut, da das ganze Leben der Madame Pasta davon gezehrt werden kann20.
Für Marx dagegen ist entscheidend, in welchem Arbeitsverhältnis das Gut erbracht wurde. Handelt es sich um Arbeit unter den Bedingungen der kapitalistischen Warenproduktion, so ist auch die Ware produktiv. Wurde das Erzeugnis dagegen in informeller Arbeit erbracht, spricht er von unproduktiver Arbeit.
Say schaffte in dieser Diskussion den Bezug zu den Dienstleistungen. Er spricht davon, dass tertiäre Produkte im Millschen und auch im Marxschen Sinne sowohl produktiv als auch unproduktiv sein können, dass ist ihm, trivial gesagt, egal. Entscheidend ist allein, dass es sich um immaterielle Güter handelt. Für ihn ist also der stoffliche Charakter entscheidend. Denn immaterielle Güter haben laut Say den Nachteil, dass sie nicht den Rationalisierungsmechanismen erliegen und so auch deren Produktivität leidet. Das dies nicht unkommentiert bleiben kann, versteht sich von selbst, doch komme ich darauf später noch zurück.
Entscheidend für die ökonomische Rolle der Dienstleistungen bleibt trotz allem die Frage nach der Produktivität. Hier antworten Häußermann/Siebel mit einer einfachen Unterscheidung: produktionsorientierte Dienstleistungen, also solche, die dem Produktionsverlauf direkt vorgeschaltet sind bzw. ihn „betreuen“, sind produktiv, konsum- oder personenorienterte dagegen nicht. Denn, wie schon eingangs erklärt, verschwinden diese im privaten Verbrauch, ohne jegliche Wachstumswirkung zu entfalten.
Ökonomische Theorien grenzen Dienstleistungen mit einer Reihe von Axiomen (uno-actu Prinzip, Spiel zwischen Personen, Immaterialität, Rationalisierungsresistenz) ab, die als nicht veränderbar angesehen werden. Doch lassen sich bei jedem der Merkmale Gegenbeispiele finden, die dem jeweiligen Merkmal fehlende Trennschärfe nachweisen. Also ist auch die Ansicht von Say, Dienstleistungen wären durch ihre Immaterialität nicht rationalisierbar, nicht allgemeingültig. Häußermann/Siebel kommen zu der Erkenntnis, dass Dienstleistungen keine statischen Gegebenheiten sind, sondern einem dynamischen Prozess unterliegen, sie sind als „soziale Arrangements“ wandelbar21. Dieser Wandel wird auch als Lebenszyklus der Dienstleistungen bezeichnet. Ist eine gewisse Dienstleistung relativ neu (z.B. ein Stand, der Frikadellen verkauft), so ist der Prozess der Herstellung durch eine sehr geringe Produktivität gekennzeichnet. Nun breitet sich die Dienstleistung aus, unterliegt einem Rationalisierungsprozess, wird zur Massenware (hier die Massenproduktion von Frikadellen durch Mc Donalds), so dass sich auch die Produktivität der Frikadellenherstellung erhöht. Im dritten Stadium wird dann die Frikadelle als Fertiggericht aus der Kühltruhe vollständig technisch substituiert, also als Industrieprodukt zur eigenen Zubereitung hergestellt. In diesem Stadium herrscht höchste Produktivität. Damit stimmen Häußermann/Siebel mit Gershunys These von der Substituierbarkeit tertiärer Produkte überein.
Im Prinzip, so die These Häußermann/Siebels, kann jede Dienstleistung diesen Lebenszyklus durchlaufen, doch sind dem in einigen Fällen sowohl kulturelle als auch moralische Grenzen gesetzt.
2.3.2 Die soziologische Betrachtung des Problems
Nun will ich mich damit befassen, wie Soziologen das Phänomen des Wandels zur tertiären Gesellschaft erklären. Allerdings unterliegen sie dabei - übrigens genau wie die Ökonomen - dem Problem der Definition von Dienstleistung. Meist beschränkt man sich darauf zu erläutern, was Dienstleistungen nicht sind, sie sind ein Residualphänomen (siehe Kapitel A). Allein Berger/Offe brachten eine Definition heraus, die versucht, den Begriff in eine etwas exaktere Form zu kleiden. Sie stützen sich dabei auf die Theorie des Funktionalismus. Für sie sind Dienstleistungen all jene Tätigkeiten, die formbeschützend für eine Gesellschaft wirken, also die Irrationalitäten und Defekte, die eine Gesellschaft hervorbringt, auffangen. Beispielsweise ersetzen viele personenorientierten Dienstleistungen die fehlende soziale Kontrolle in Zeiten der individuellen Freiheit und des Liberalismus industrieller Gesellschaften (z.B. Polizei oder Sozialamt). Funktionen, die in vorkapitalistischer Zeit durch Religion und die absolute Herrschaft hierarchischer Strukturen erfüllt wurden, sind durch die darauf folgende säkularisierte kapitalistische Entwicklung aufgelöst und entweder den Familien überlassen oder durch Institutionen ersetzt worden. Dabei kommt der Herausbildung der Arbeitsteilung entscheidende Bedeutung zu. Durch sie ist es im Zuge der Industrialisierung erst zu den Auslagerungen und Auflösungserscheinungen ordnungstiftender Funktionen gekommen.
Allerdings merken Häußermann/Siebel an, dass es durchaus auch Dienstleistungen gibt, die nicht nur systemerhaltend durch das Auffangen von Defekten wirken, sondern dadurch, dass sie dem Produktionsprozess vorgeschaltet sind, ihn verbessern und rationalisieren. Sie entstanden also nicht aus den Reparaturen der Irrationalitäten, sondern zur Verbesserung der Rationalitäten. Diese Dienstleistungen werden von Häußermann/Siebel ergänzend zur Berger/Offe-Definition als „innovativ“ bezeichnet.
Berger/Offe beschränkten sich bei ihrer funktionalen Betrachtung auf produktionsorientierte Dienstleistungen. Nun möchte ich noch einige weitere Erklärungsversuche vorstellen, die sich dadurch von der Berger/Offes unterscheiden, dass sie nicht von der Prämisse der Systemerhaltung ausgehen und sich auch hauptsächlich auf konsumorientierte Dienstleistungen beziehen.
Gorz z.B. unterscheidet erstens die Dienstleistungen, die die Hausarbeit professionalisieren; zweitens die „Fun-Dienste“, die der Unterhaltung dienen. Erstere schaffen Zeitgewinn, insbesondere für Frauen; letztere sind zur Ausfüllung der entstandenen Freizeit erdacht. Grund für die Expansion in diesem Gebiet sind die allgemeine Reichtumssteigerung und die zunehmende Professionalisierung, also Arbeitsteilung.
Weitere Quellen für Dienstleistungen bieten der kompensatorische Konsum, der dadurch gekennzeichnet ist, dass psychische Probleme durch den Konsum von Dienstleistungen, z.B. dem regelmässigen Besuch einer Kneipe ausgeglichen werden, und der positionale Konsum, von Veblen auch „conspicious consumption“22 genannt, der wiederum dazu dient, sich abzugrenzen oder zuzuordnen (z.B. könnte der regelmässige Besuch klassischer Konzerte allein dem Zweck dienen, sich einer bestimmten Schicht zugehörig zu präsentieren).
Auch schafft der demographische Wandel in den entwickelten Industrieländern, vor allem der steigende Anteil alter Menschen und die immer höhere Lebenserwartung neue Potentiale für tertiäre Elemente. Hiervon wird besonders die Intensität personenbezogener Dienstleistungen beeinflusst.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Dienstleistungen einem Prozess der Verstofflichung und der Trennung von Produktion und Konsum unterliegen. Auf diese Weise ist es möglich geworden, ihre Produktivität zu steigern und sie damit billiger anzubieten. Sie werden immer mehr dem Prozess der Vergesellschaftung ausgesetzt.
Der so bezeichnete Wandel informeller Arbeit in formelle, betrieblich organisierte und dadurch rationalisierte Tätigkeiten ist überall zu beobachten, er läuft scheinbar in Lebensphasen ab und ist charakterisiert durch eine allgemeine Reichtumssteigerung und erhöhte Produktivität. Dienstleistungen werden erschaffen durch die Möglichkeit eines Individuums, jemanden gegen Bezahlung etwas tun zu lassen, was es selbst nicht mehr möchte. Dienstleistungen sind anfangs immer ein Luxus. Sie werden allerdings durch Produktivitätssteigerung und erhöhten allgemeinen Reichtum billiger und zur Massenware. Dies gipfelt in der totalen Rationalisierung der Dienstleistungen durch Verstofflichung der Tätigkeit. Dadurch wird sie wieder zurück an die informelle Hausarbeit gegeben (siehe Bsp. Frikadellen).
2.4 Exkurs - Der flexible Mensch: Wandel individueller Lebensführung durch gesellschaftlichen Wandel
2.4.1 Drift und Scheitern
Es sind genug Worte darüber gefallen, was die wirtschaftlichen Veränderungen der Gegenwart gesamtgesellschaftlich bedeuten. Es ist von neuen Formen der Tätigkeit in neuen Organisationsformen gesprochen worden. Was aber hat dies auf mikrosoziologischer Ebene für Konsequenzen? Mit welchen Widrigkeiten muss der Mensch heutzutage kämpfen, welche Vorteile entstehen ihm daraus?
Mit dieser Frage beschäftigt sich Sennett in seinem Buch „Der flexible Mensch“23. Er arbeitet anhand von Einzel- und Gruppeninterviews und Beobachtungen die Erfordernisse des „neuen Kapitalismus“ heraus und wie diese - oder eben nicht - von den Menschen verarbeitet und angenommen werden.
Im Zuge der Veränderung wirtschaftlicher Strukturen diagnostiziert Sennett einen Wandel in der individuellen Lebensführung. Anhand des Vergleichs von Enrico, einem Hausmeister in den Siebzigern und seinem Sohn Rico, der es „geschafft“ hat und nun am oberen Ende der Lohnskala lebt, arbeitet er die Unterschiede in den Einstellungen der beiden Epochen heraus. Wichtigste Erkenntnis dabei: Die Vorhersagbarkeit der Lebensläufe entfällt durch die zunehmende Kurzlebigkeit sozialer Bindungen und Arrangements. Enrico war in der Lage, klar zu sagen, was war und was kommen würde, wie sein Leben also in Zukunft aussehen würde. Er konnte mit Sicherheit sagen, wann er im pensionsfähigen Alter sein würde und wann genau er die Schulden für sein Haus abbezahlt hätte. Diese Sicherheit war symptomatisch für die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg. Soziale Institutionen, starke Gewerkschaften und grosse Unternehmen, die umfangreiche Sozialleistungen anboten ermöglichten ein geradliniges Leben, das zwar durch eben diese Institutionen und Organisationen vorbestimmt, aber auf Jahrzehnte hinaus berechenbar war.
Der heutige Mensch, dargestellt durch Rico, unterliegt einem Trugschluss. Die neue Generation, zu der auch Rico gehört, kämpfte für den Gewinn an Selbstbestimmung des eigenen Lebenswandels, also zunehmende Selbstverantwortung auf Kosten fehlender Sicherheit. Tatsächlich scheint Rico sein Leben fest im Griff zu haben. Doch liegt besagter Trugschluss darin, dass dieses Leben nur scheinbar in seinen Händen liegt. In Wahrheit wird deutlich, dass der Lebensweg nun durch den Wandel zum Fusions- und Finanzkapitalismus fremdbestimmt wird. Der einzelne Mensch ist nur noch reagierender Statist auf äussere Einflüsse, obwohl nie eine grössere Selbstbestimmung und Eigenverantwortung möglich schien. Rico befindet sich, wie viele andere Menschen auch, im Zustand der „Drift“ durch sein Leben, einem Dahintreiben ohne der Möglichkeit wirklicher Kontrolle. Bemerkenswert erscheint dabei jedoch, dass Rico seine Handlungen trotzdem selbst verantwortet. Er steht zu seinen Entscheidungen, auch wenn sie ihm von aussen
vorgegeben waren. Er spricht also nicht davon, dass ihm gekündigt wurde, sondern sagt: „Ich stand einer Krise gegenüber und musste eine Entscheidung treffen.“24 Aus Angst, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren, versucht er die Fremdbestimmung durch die bewusste Eigenverantwortung der Konsequenzen seiner Entscheidungen zu überspielen.
Hauptgrund für diesen Wandel in den Lebensläufen ist die Dominanz kurzfristiger Bindungen, die den flexiblen Kapitalismus charakterisiert. Im Gegensatz zu den Siebzigern, in denen traditionelle Werte wie Loyalität, Vertrauen und Sicherheit die Langfristigkeit der Bindungen und Arrangements gewährleistete, führt die heute erkämpfte Liberalität zu einem Dilemma zwischen gelebten und vermittelten Werten. Enrico war in der Lage, Rico seine Wertvorstellungen nicht nur zu predigen, sondern sie auch vorzuleben. Rico steht nun in Zeiten, in denen Begriffe wie „Job“ oder „Stelle“ durch „Projekte“ ersetzt werden, in der prekären Situation, dass er, um Halt zu finden, traditionelle Werte in seinem Denken hervorhebt, sie seinen Kindern auch immer wieder versucht nahezubringen, dass die Realität ihn jedoch zwingt, eben diese Werte zu verleugnen und mit der Flexibilität und Kurzfristigkeit der Zeit mitzugehen. Verweigert er sich den Ansprüchen der Wirtschaft an Flexibilität und Mobilität, scheitert er beruflich. Gibt er nach, lebt er ein karriereorientiertes Leben, so muss er als Ehepartner oder Vater scheitern.
Das berufliche Scheitern ist nach Sennett nicht mehr nur den Unterpriviligierten vorbehalten. In Zeiten der grossen Fusionen (man denke im Moment an die Bankenfusion in Deutschland) fallen den Rationalisierungen auch höherbezahlte Jobs und damit auch Menschen zum Opfer, die ihren Job aufgrund ihrer höherer Bildung immer für krisenfest hielten. Scheitern ist also ein gesamtgesellschaftliches Phänomen geworden, vor dem niemand mehr sicher ist. Sehr gut macht Sennett dies an drei ehemaligen IBM-Mitarbeitern deutlich, drei Programmierern, die im Zuge der Umstrukturierung des Unternehmens Anfang der Neunziger Jahre ihren Job verloren. Anfangs machen sie höhere Gewalt für ihr Versagen verantwortlich, so in der Reihenfolge die Firmenpolitik von IBM und die globale Wirtschaft. Doch stellen sie im Laufe des Gespräches fest, dass letztendlich sie für ihr Fehlverhalten verantwortlich sind. Sie haben im entscheidenden Augenblick nicht den Sprung von IBM, dem damals schon sinkenden Schiff, geschafft. Das rächt sich nun, ist jedoch nicht rückgängig zu machen.
2.4.2 Fazit
Sennetts Analyse der Auswirkungen gesellschaftlichen Wandels auf die sozialen Beziehungen macht folgendes deutlich: Die Kurzfristigkeit des neuen Kapitalismus erfordert einen flexiblen Menschen, der keine festen sozialen Bindungen mehr eingehen kann und langfristige Werte wie Vertrauen und Loyalität nicht imstande ist zu leben. Die scheinbare völlige Selbstbestimmung löst sich auf in ein Reagieren auf gesellschaftlich ökonomischen und damit individuell sozialen Wandel.
3 Bürokratie und Dienstleistung
Nach dieser eher skizzenhaften Darstellung der wichtigsten Theorien und Ansätze zur Dienstleistungsgesellschaft möchte ich nun ausführlich einen weiteren soziologischen Versuch zur Erklärung der Expansion tertiärer Elemente vorstellen, den Wandel der Dienstleistungsgesellschaft aus der Bürokratie heraus von Rönsch.
Rönsch stellt in seiner - allerdings recht schemenhaften - historischen Gesellschaftsanalyse fest, dass ähnlich dem Wandel von der Feudalgesellschaft zur Industriegesellschaft auch diese sich durch die Herausbildung der Bürokratie veränderte, und in den letzten Jahrzehnten aufgrund steigender Komplexität Kontrollverluste im Bereich der rationalen Herrschaft der bürokratischen Industriegesellschaft entstehen, die seiner Meinung nach in der Konstitution tertiärer Strukturen in derselben münden. Aus den Defekten der Bürokratie entsteht die Dienstleistungsgesellschaft. Dies klingt im ersten Moment recht verwegen, ist jedoch nach eingehender Studie des Ansatzes durchaus logisch. Allerdings beschränkt sich Rönsch auf die rein soziologische Betrachtung des Sachverhaltes, also der Erklärung sozialer Phänomen mit Sozialem. Das lässt ihn einige Dimensionen des Wandels ausblenden. So bezieht sich seine Betrachtung grösstenteils auf personenorientierte Dienstleistungen im staatlichen Bereich. Doch werden Phänomene erklärt, die - auf Mikro- und Makro-Ebene - gesamtgesellschaftliche Wirkung zeigen und dadurch seiner Meinung nach auch gesamtgesellschaftlichen Wandel hervorrufen.
Um den Rönschen Ansatz in seiner Komplexität vollständig verstehen zu können, sind vorher einige Positions- und Begriffsbestimmungen nötig. So werde ich anfangs den Weberschen Bürokratiebegriff aufarbeiten, da dieser dem Ansatz zugrundegelegt wurde. Danach lege ich ausführlich die Rönschen Überlegungen samt seiner verwendeten endogenen Erklärungsweise des Phänomens dar, um dann, vor der Präsentationen der Konsequenzen für den gesellschaftlichen Wandel, einen weiteren Exkurs zu Ehren Webers zu unternehmen, nämlich seine Methode des Idealtypus näher zu beleuchten.
3.1 Begriff der Bürokratie nach Weber
Nun also erst zu Weber. Weber hat in seiner Herrschaftssoziologie25 ausführliche Studien über historische und zu der Zeit gegenwärtige Herrschaftsformen durchgeführt. Ihn interessierte besonders die Stabilität der Herrschaft und die Gründe für ihre Dauerhaftigkeit oder eben Kurzlebigkeit.
Wiswede sieht in dem Weberschen Begriff der Herrschaft „...eine institutionalisierte Form der Macht, wobei der Anspruch der „Herrschenden“ als rechtmässig anerkannt wird.“26 Dieser Anspruch kann z.B. aus Sitte, Neigung oder einfachen rationalen Erwägungen heraus entstehen, ist jedoch noch sehr labil. Stabilität erlangt Herrschaft erst durch Rechtmässigkeit, also Legitimation. Weber unterscheidet drei Formen legitimierter Herrschaft: Die traditionelle Herrschaft, oft in
Monarchien konstituiert, äussert sich im uneingeschränkten Recht der Erbfolge der königlichen Familie. Dieses Recht würde nie angefochten, denn die Tradition verbietet es. In der charismatischen Herrschaft ist der Herrscher - übrigens schon Anfang des Jahrhunderts verwendete Weber hierfür den Begriff „Führer“ - dadurch legitimiert, weil dieser durch sein Können, durch seine Ausstrahlung die Untergebenen dazu bringt, ihm zu folgen und auch über längeren Zeitraum hinaus zu gehorchen. Allerdings ist diese Form der legitimerten Herrschaft personenabhängig und überdauert diese Person in den meisten Fällen nicht. Die legale Herrschaft schliesslich verdankt ihren Legitimitätsanspruch einzig der Anerkennung seitens der Untergebenen, dass diese Form der Herrschaft die angestrebten Ziele einfacher, schneller - eben rationaler verfolgen bzw. erreichen kann.
Bürokratie ist dabei die reinste Form der legalen Herrschaft. Sie ist vollständig durch Zweckrationalität begründet. Diese äussert sich in Form einer Satzung, auch bürokratischer Gedanke oder die Regel genannt. Die Regel verfolgt dabei zwei Prinzipien, das Prinzip des Voluntarismus und das der Systematisierung.
Als Voluntarismus wird die Handlungsweise beschrieben, durch die das Schaffen und Ausserkraftsetzen von Recht innerhalb formal klarer Grenzen - eben der Regel - beliebig variiert werden kann. Diese „relative Beliebigkeit der Handlung“ ist der Mittelpunkt allen Handelns und der Kontrolle innerhalb der Bürokratie, denn so kann abweichendes klar von regelkonformem Verhalten getrennt werden. Um die Erfordernisse der Realität zu berücksichtigen, sind der Leitung durch den Voluntarismus also Spielräume eingeräumt, innerhalb dessen sie Regelungen verändern oder hinzufügen kann, die wiederum das gesamte Handeln des Verwaltungsapparates bestimmen.
Durch die Systematisierung werden die Tatbestände, Personen oder Entscheidungen, mit dem sich der Verwaltungsapparat konfrontiert sieht, verallgemeinert und vereinheitlicht, so dass allgemeines Recht auf jeden „Vorgang“ uneingeschränkt anwendbar ist.
Die Realität kennt diese reine Form der legalen Herrschaft nicht. Es herrschen immer nur Mischformen vor, in denen auch Tradition oder affektive Gesichtspunkte eine Rolle spielen, allerdings ist nach Weber entscheidend, „...dass die kontinuierliche Arbeit überwiegend und zunehmend auf den bürokratischen Kräften ruht.[...] Der Anteil der bürokratischen Herrschaftsformen steigt überall.“27
Das Bürokratiemodell nach Weber ist in der folgenden Grafik dargestellt. In der Spitze sitzt die Leitung, die den bürokratischen Gedanken verfolgt. Ihr untergeordnet ist der Verwaltungsapparat, der aus Beamten besteht. Diese zeichnen sich durch eine hohe Spezialisierung aufgrund hoher Arbeitsteilung aus. Sie sind kraft Vertrag in ihr Amt berufen und werden nicht nach Leistung, sondern nach Rang bezahlt. Sie unterliegen, und dies ist wichtig, der Amtspflicht, d.h. die Behandlung der Vorgänge hat - impliziert durch die Systematisierung - streng nach Regel ohne Ansehen der Person zu erfolgen. Der Verwaltungsapparat ist in vertikale Hierarchieebenen unterteilt, zwischen denen der Weg der Entscheidung und der - umgekehrte - Weg der Beschwerde klar geregelt sind.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Bürokratie wird in der Literatur oft mit Begriffen wie z.B. „...maschinisierte Organisation...“ umschrieben, was verdeutlichen soll, dass sie einem dynamischen Prozess unterliegt. Dieser dynamische Prozess, die Bürokratisierung, schafft Rationalität und erhöht diese ständig. Konsequenz ist die Sklerose der Bürokratie 28, eine Wechselbeziehung, die Bürokratie immer komplexer und reiner entstehen lässt. An diesem Punkt beginnt die Argumentation Rönschs.
3.2 Koordinierungsfalle der Bürokratie - die Makro-Ebene
Laut Rönsch kam es Ende des 19. Jahrhunderts zur Herausbildung des bürokratischen Wohlfahrtsstaates aus den Defekten der Industrialisierung heraus. Dies bedarf natürlich einiger Sätze zur Erklärung.
Ähnlich wie Berger/Offe sieht Rönsch den Prozess der Tertiarisierung unter dem Mantel der endogenen Erklärungsweise, als der Erklärung sozialer Phänomene durch Soziales. Auch fertigt er eine historische Zeitanalyse des Wandels der Gesellschaft an, analog zu Berger/Offe. Eine Gesellschaftsform hat sich danach selbst überlebt, wenn die Prämissen oder Grundsätze, nach denen sie sich entwickelt hat, überholt sind und die gewandelte Gesellschaft als „Zerfallsprodukt“29 der vorherigen Ordnung erscheint. So kann der Wandel feudaler Strukturen zur Industriegesellschaft dargestellt werden, und so erklärt Rönsch auch den Wandel von dieser zur bürokratischen Wohlfahrtsgesellschaft.
Im Zuge der immer intensiveren Industrialisierung war es unverzichtbar für den Einzelnen und auch die Unternehmung, überflüssige Strukturen oder Bereiche abzustossen. Die schon von Berger/Offe genannte Auflösung von Kirche und hierarchischer Ordnung des Feudalismus sowie die „Abfallprodukte“ der Industrialisierung mussten von der Gesellschaft aufgefangen werden. Ein Teil wurde auf die Familie übertragen, doch der Grossteil wurde mit Hilfe neuer Institutionen bürokratischen Charakters durch den Staat gesichert. Diese ab Ende des 19. Jh. anhaltende Bürokratisierung führte nun laut Rönsch zu einem Wandel des grundlegenden Prinzips der Gesellschaft. Nun dominierte die Hierarchie der Bürokratie über die Liberalität des Marktes, was Rönsch dazu brachte, die Gesellschaftsform als neu entstandene bürokratische Wohlfahrtsgesellschaft zu titulieren.
Nun allerdings sieht Rönsch auch das Ende dieser Gesellschaftsordnung, denn die oben schon angesprochene Sklerose der Bürokratie, die zur permanenten Expansion bürokratischer Strukturen und damit zum immer grösser werdenden Verwaltungsapparat führt, lässt Defekte innerhalb der Strukturen auftreten, die durch die bürokratische Ordnung nicht mehr zu lösen sind, da sie zu einer Dilemmasituation führen, der Koordinierungsfalle der Bürokratie.
Diese Koordinierungsfalle äussert sich in zwei Merkmalen:
Aufgrund der Überlastung durch die anhaltende Bürokratisierung immer neuer „Grauzonen“ ist die Leitung nicht mehr in der Lage, Koordinierungsleistungen zu erbringen.
An der Basis jedoch, also an der Schnittstelle zwischen der Institution und den Klienten, sind eben diese Koordinierungsleistungen nicht erlaubt, da die Leitung sonst keine Kontrolle mehr über die Basis hat.
Beide Merkmale führen zum Kontrollverlust. Durch Verstärkung dieser Dilemmasituation sind drei Konsequenzen erkennbar, die eine Lösung des Problems herbeiführen: die Katastrophe (z.B. die Auflösung der Institution durch eine ranghöhere), die Externalisierung von Koordinierungsleistungen und die Intra- Tertiarisierung. Es erscheint, denke ich, logisch, sich mit der Konsequenz der Katastrophe nicht weiter auseinanderzusetzen. Doch was genau steckt hinter den letzten beiden Begriffen?
3.2.1 Externalisierung
Externalisierung bedeutet, dem Kunden der Bürokratie die nicht erbrachte Koordinierungsleistung zu überlassen. Die eingangs durch das Prinzip des Voluntarismus beschriebene Anpassung des Regelwerks auf spezielle Situationen kann nicht mehr durchgeführt werden, so dass der Kunde, auf sich allein gestellt, dies selbst übernehmen muss. Koordinierungsleistungen werden also externalisiert. Daraus entstanden und entstehen tertiäre Strukturen, die dem Kunden solche Leistungen abnehmen, so z.B. in Form der Steuerberatertätigkeit oder auch der Finanzberatung. Natürlich, und das gibt Rönsch zu, gab es schon immer selbständige beratende Institutionen, die den Menschen den „Gang zum Amt“ erleichterten, doch „...lässt sich festhalten, dass aus bürokratischer Externalisierung ein erheblicher Tertiarisierungsschub in Wirtschaft und Gesellschaft folgt.“30
3.2.2 Intra-Tertiarisierung
Die eben angesprochene Externalisierung schafft jedoch, in Augen der Bürokratie, keine Lösung des Problems: der Kontrollverlust bleibt, hat sich gar verschlimmert, da die Kunden nun Hand in Hand mit Spezialisten auf der anderen Seite des Bearbeitungsschalters stehen. Darum versucht die bürokratische Organisation entgegen den Prinzipien der Bürokratie, durch Umstrukturierung Platz für tertiäre Elemente zu schaffen, um die „verlorenen“ Koordinationsleistungen wieder zu integrieren. Das nennt Rönsch Intra-Tertiarisierung und liefert gleich noch eine ausführliche Definition mit:
„ Intra-Tertiarisierung hingegen soll den Prozess bezeichnen, in dessen Rahmen wiederum internalisiert wird, was an Koordinierungsleistungen aus Gründen bürokratischer KomplexitÄtsreduktion zuvor externalisiert werden musste. “ 31
Die Intra-Tertiarisierung führt zu einer Stärkung der horizontalen Koordination auf Kosten hierarchiegebundener Anweisungen und damit vertikaler Kontrolle. Statt dem Prinzip der Systematisierung weiter zu folgen, wird über die direkte Aushandlung eines bestimmten Problems die Lösung „ad hoc“ durch Kompromiss und Symbiose geschaffen, nach dem Grundsatz: Kooperation statt Kontrolle. Dabei stehen der Beamte und der Klient in direkter Kommunikation zueinander, laut Nerdinger das entscheidende Merkmal für die direkte personenbezogene Dienstleistung (siehe Definition in Abschnitt II.A).
Auf welche Art und Weise werden diese tertiären Elemente im bürokratischen Apparat integriert? Die Antwort darauf bleibt uns Rönsch weitgehend schuldig, einzig verweist er auf die Bildung von netzwerkähnlichen Strukturen und Aufgabenbündelungen auf einzelne Abteilungen oder Beamte. Dies führt im Extrem, so Rönsch, „zur weitgehenden Auflösung von bürokratischen Strukturen“32.
3.3 Stil statt Rolle - die Mikro-Ebene
Nach Analyse gesamtgesellschaftlichen Wandels stellt sich nun die Frage nach dem Individuum in diesem System. Ist es denkbar, dass die Entwicklung auf der Makro-Ebene auch Konsequenzen für den einzelnen Menschen mit sich bringt? Oder ist es gar so, dass die Veränderung der Ansichten und Lebensweisen der Menschen diesen gesamtgesellschaftlichen Wandel unterstützte?
Um diese Frage beantworten zu können, sind die Dimensionen zu bestimmen, in denen wir uns auf der Mikro-Ebene bewegen. Als Pendant zur bürokratischen Organisation soll uns die Rolle oder das Rollenbündel dienen. Als Rolle bezeichnet Rönsch die Anhäufung von Verhaltenserwartungen auf bestimmten Positionen, die im Zuge des Erreichens gesteckter Ziele durch Arbeitsteilung geschaffen wurden. Innerhalb bürokratischer Strukturen ist eine solche Rolle entscheidend, wird durch sie in Form von Kompetenz- und Aufgabenverteilung doch das bürokratische Prinzip verkörpert. Die Person variiert, die Rolle bleibt.
3.3.1 Rollenerosion
Nun stellt Rönsch eine Auflösung der Rolle, eine Rollenerosion, fest, bedingt durch rollenendogene und -exogene Strukturveränderungen.
Rollen werden unter Anpassungsstress gesetzt, durch den schnellen Wandel und das Auftauchen von aussergewöhnlichen, durch die Rollendefinition nicht geklärte Situationen. Dadurch wird diese Rollendefinition in Frage gestellt und immer wieder überdehnt. Das Individuum verbringt immer mehr Zeit mit der Koordinierungsleistung innerhalb seiner Rolle, bedingt durch die steigende Komplexität des Alltags. Auch die immer komplizierteren arbeitsteiligen Strukturen fordern mehr Koordination und Selbstdefinition der Rolle. Und nicht zuletzt wird das Individuum durch einerseitige Zunahme von Pflichten und die gleichzeitige Widersprüchlichkeit dieser Pflichten in eine Position gedrängt, die „kühlen Kopf“ erfordert, um die gestellten Aufgaben zu meistern.
Aber auch exogene Faktoren beeinflussen die bürokratisch definierten Rollenbündel. So erfordern gewisse Problemlösungen den Einsatz irrationaler Denkschemata, um die bestmögliche Lösung zu erreichen. Dazu gehört nicht nur Kreativität oder Spontaneität, sondern auch der so schwammig erscheinende Begriff des „sechsten Sinnes“. Ausserdem bescheinigt Rönsch dem „modernen“ Menschen eine gewisse „Maklermentalität“33, die die aus der Organisationskomplexität neu erwachsenden Aufgaben erforderlich machen.
3.3.2 Von der Aussen- zur Innenleitung
Durch die genannten Phänomene ist also durchaus eine Veränderung der „alten“ Rolle feststellbar. Wie kann das Individuum, das diesen Veränderungen gerecht werden muss, charakterisiert werden?
Hier greift Rönsch auf die These von Riesman aus den Vierziger Jahren zurück, der damals davon ausging, dass der Mensch sich vom innengeleiteten Individuum, welches sich durch Engagement und Selbstbestimmung auszeichnete (der typische Mensch, den Weber durch die protestantische Ethik beschrieb), zum aussengeleiteten Individuum wandelte, dessen Handlungen durch feste Rollen(-muster) definiert war.
Nun stellt Rönsch den gegenteiligen Effekt fest. Der aussengeleitete Mensch, der in der bürokratischen Wohlfahrtsgesellschaft effektive Arbeit nach Vorschrift leistete, ist verschwunden oder besser verdrängt worden vom innengeleiteten Individuum, das sich wiederum durch Eigendynamik auszeichnet. Es wird immer wichtiger, wer eine bestimmte Position bekleidet, immer weniger kommt die Unabhängigkeit zwischen Individuum und der von diesem ausgefüllten Rolle zum Tragen.
Auch hier relativiert Rönsch seine Ergebnisse, indem er nicht von einem Verschwinden der Rolle oder des Rollenbündels im aussengeleiteten Sinne spricht, sondern der Rolle eine Aufweichung prognostiziert, die durch die persönliche Färbung der sie ausfüllenden Person immer stärker beeinflusst wird.
3.4 Idealtypus der DienstleistungsrationalitÄt
Ist es Rönsch bis hier gut gelungen, sowohl auf der Makro- als auch auf der Mikro- Ebene Krisen der bisherigen Handlungs- und Organisationsprinzipien festzumachen, so fehlt es, diesen Veränderungen den „Status quo“ folgen zu lassen, also eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Situation anzustellen. Inwiefern, so die nun zu behandelnde zentrale Frage, sind diese Veränderungen in den Rollenmustern und bürokratischen Organisationsformen wirklich durchdrungen von tertiären Strukturmerkmalen?
Um mit der schweren Aufgabe fertig zu werden, Mikro- und Makro-Ebene zu verschmelzen und zu einer homogenen Darstellung des Ist-Zustandes zu generieren, bedient er sich einer methodologischen Methode Max Webers. Das Konzept des Idealtypus34 erlaubte es Weber, Typen von Handlungsrationalitäten verschiedener Epochen in Verbindung zu der jeweils vorherrschenden Herrschaftsrationalität zu setzen. Rönsch versucht nun, eben solche Rationalitätstypen aus den verschiedenen Gesellschaftstypen herauszufiltern. Ich möchte mich bei der Darstellung auf die beiden wichtigsten Typen beschränken: den „bürokratischen Menschen“ und den „Dienstleister“. Vorher jedoch folgt ein kurzer Exkurs zur methodologischen Vorgehensweise.
3.4.1 Konzept des Idealtypus nach Weber
Max Weber interessierte sich für das Konzept des Idealtypus schon in seinen frühen Veröffentlichungen. Seiner Meinung nach seien klare wissenschaftliche Begriffe als Werkzeug bei der Erfassung und wissenschaftlichen Verarbeitung der Realität unverzichtbar. Denn „...gerade weil er die Sicht von der Wirklichkeit als einem ungeordneten „Chaos“ voll teilte, vertrat er die Forderung nach „scharfen“ Begriffen um so nachdrücklicher...“35. Doch was genau steckt hinter den „scharfen Begriffen“, die Weber angesichts der immer vielfältiger werdenden Gesellschaft forderte?
Weber versuchte, eine gedachte Ordnung in die vielschichtige Realität zu projizieren, wobei nicht die Quantität über die Trennschärfe eines Merkmals entschied, sondern die Qualität. Je polarisierender ein Merkmal, je „typischer“ es für eine gewisse Unterscheidung war, desto besser war es zur Abgrenzung geeignet. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen.
An der Lüneburger Universität werden sechs verschiedene Studiengänge angeboten. Allerdings studieren etwa siebentausend Studenten hier auf dem Campus, die in ihren Einstellungen und Charakteren völlig verschieden sind. Bei dieser heterogenen Masse sind keine Einordnungen der Einstellungen in die einzelnen Studiengänge wie „BWL“ oder „Sozialpädagogik“ möglich. Doch wenn man nun eine gedachte Ordnung zur Klassifikation verwendet, wird alles sofort etwas klarer. Man schaut sich an, welche Merkmale den typischen BWLer ausmachen, was ihn hundertprozentig von Studenten anderer Studiengänge trennt. Aus dem Pool realer Typen von BWL-Studenten kreiert man den „absoluten Betriebswirt“, der in keiner seiner Charakterzüge oder Einstellungen zweideutig erscheint. Dieses Konstrukt erlaubt nun, alle Betriebswirte mehr oder weniger diesem Ideal zuzuordnen. Man kann bestimmen, wer sich dem Idealtypus besonders annähert und wer eher weiter davon entfernt ist. Um nun einen zweiten Pol zu erhalten - dies erleichtert den Vergleich - wird auch ein Konstrukt, ein Idealtypus, für den typischen Sozialpädagogen kreiert. Auf diese Weise lässt sich eine relativ klare Ordnung an der Universität Lüneburg schaffen, innerhalb der jeder Student seinen Platz zwischen den Idealtypen innehat. Nun lässt sich beispielsweise die Frage klären, welches Einstellungsmuster derzeit an der Universität Lüneburg dominiert. Klar wird an dem Beispiel folgender wichtiger Punkt: Es handelt sich bei dem Idealtypus immer um ein Konstrukt. Die Realität nähert sich dem bloss an, kann mit dessen Eigenschaften mehr oder weniger übereinstimmen. Nähme man die Zeitdimension mit in die Betrachtung auf, macht das Beispiel deutlich, dass zu jeder Zeit die Tendenz zu einem Idealtypus gegeben ist, also immer nur ein Idealtypus überwiegt. Vollständig verdrängt werden die einzelnen Rationalitäten jedoch nie.
In Webers Untersuchung zu jeweils dominierenden Handlungsmustern innerhalb verschiedener Herrschaftsstrukturen war bis Anfang des 19. Jh. der traditionelle Mensch der Ständegesellschaft vorherrschend. Dann jedoch stellte sich der homo oeconomicus der Industrialisierung in den Vordergrund. Diesem folgte nun laut Rönsch der bürokratische Mensch ab Anfang des letzten Jahrhunderts, dessen Rollenverständnis und Grundprinzipien des Handelns nun ausführlich erläutert und mit denen des typischen Dienstleisters verglichen werden.
3.4.2 Bürokratischer Mensch vs. Dienstleister
Mit Hilfe der Weberschen Methode ist es Rönsch nun möglich, einen Vergleich der in den einzelnen Gesellschaften vorherrschenden Rationalitäten, man könnte auch sagen Mentalitäten anzustellen.
Da wäre zuerst natürlich der bürokratische Mensch genannt, entstanden aus den Defekten und der, wie Rönsch sehr treffend bemerkt, „...Tendenz zum sozialen Wildwuchs...“36 der industriellen Entwicklung des 19. Jh. Was charakterisiert ihn?
Der bürokratische Mensch ist durch Unabhängigkeit von Individuum und Rolle gekennzeichnet. Im Zuge der schon von Riesman in den 40ern beschriebenen Aussenleitung löst sich die Rollendefinition immer mehr von der sie ausfüllenden Person. Der Bürokrat wird durch die Regel oder besser den bürokratischen Gedanken kontrolliert und ist geschaffen, vorgegebene Aufgaben zu erledigen, solange sie innerhalb des Schemas der jeweils zugrundegelegten Ordnung zu lösen sind. Die dominierende Orientierung ist eine Subjekt-Objekt-Beziehung, da durch das Prinzip der Systematisierung sowohl Produkte als auch Personen auf Vorgänge reduziert werden. Die sehr hohe Arbeitsteilung erfordert die einwandlose Bearbeitung dieser Vorgänge, ohne Kenntnis des Zielzustandes derselben.
Der Bürokrat stellt das Ideal zum Funktionieren im Rahmen vorgeprägter Rollen und klarer Organisationsmuster dar. Am deutlichsten kommt dieses Ideal in Form der Angestellten und Beamten und natürlich der Arbeiter der Tayloristischen Massenproduktion zutage.
Dem Dienstleister hingegen, dessen Bedeutungsgewinn im Rahmen der schon erwähnten Krisen im bürokratischen System zwingend notwendig erschien und immer noch erscheint, ist der durch Kommunikation erreichte Konsens die höchste Orientierung. Im Rahmen der Rollenmuster werden durch diesen individuell herbeigeführten Konsens die Eigenschaften der Person gegenüber der Rollendefinition immer wichtiger. Als Kontrollmechanismus fungiert, im Gegensatz zur Regel der bürokratischen Verwaltung, die Symbiose, also die Erkenntnis der Abhängigkeit der Mitglieder einer Gesellschaft untereinander bei der konstruktiven Verfolgung der Organisationsziele. Die vorherrschende Subjekt-Subjekt-Beziehung von Klient und Berater bei der Lösung eines Problems verdeutlicht dies eindrucksvoll. Auch für Rönsch ist eines der wichtigsten Merkmale tertiärer Handlungsprinzipien der Einfluss des Kunden bei der Zielerreichung. Die Vorstellung des potentielle Zielzustand ist dem Dienstleister dabei, und dies sei nur der Vollständigkeit halber genannt, völlig bewusst. Ja, es ist sogar die Hauptmotivation der eigentlichen tertiären Tätigkeit.
Das Ideal des Dienstleisters, geprägt durch individuelle Handlungsprinzipien im Rahmen neuer, spezifischer Organisationsformen, die Kooperation und Symbiose vor Verwaltung und Kontrolle stellen, wird besonders deutlich in der psychischen und sozialen Betreuung von Menschen und durch die Medienberufe.
Anzumerken wäre noch der für Rönsch wichtige Fakt, dass der bürokratische Mensch nie vollständig vom Dienstleister verdrängt wird. Er bemerkt einzig die Tatsache des Bedeutungszuwachses neuer Mentalitäten in der Gesellschaft, die grosse Ähnlichkeit mit dem zuvor beschriebenen Idealtypus des Dienstleisters aufweisen.
4 Zusammenfassung
Rönsch gelingt es nicht nur, die Expansion tertiärer Tätigkeiten aus den Strukturdefiziten bürokratischer Organisationen heraus zu erklären, er führt ansatzweise eine Gesellschaftsanalyse durch. Es kommt dem Begriff der Kontrolle entscheidende Bedeutung zu. Aufgrund dessen schafft er eine soziologische Erklärung für das große Aufkommen bürokratischer Elemente während der Industrialisierung Ende des 19. und Anfang des 20. Jh. Dabei lehnt er sich stark an die Erkenntnisse Webers an. Rönsch sieht, ähnlich wie dieser, die Expansion der Bürokratie als notwendige Kontrollinstanz zum, wie er sagt, „sozialen Wildwuchs“37 damaliger Industriegesellschaften. Durch die Sklerose der Bürokratie aufgrund steigender Komplexität lagert diese nun unbewusst Koordinierungsleistungen aus, die dann privat in Form tertiärer Tätigkeiten erbracht werden. Um den bürokratischen Apparat nicht durch den damit einhergehenden Kontrollverlust zu gefährden, werden die externalisierten Leistungen nun wieder internalisiert. Innerhalb der Bürokratie werden dementsprechend - wohlgemerkt unter Beibehaltung bürokratischer Prinzipien - tertiäre Strukturen etabliert. Rönsch sieht an der bürokratischen Basis die Tendenz zu kooperativen Mustern statt strikter Anweisungen „von oben“. Die Flexibilität steigt, da es nun möglich ist, Koordinierungsleistungen direkt in der Interaktion zwischen Beamten und den Kunden zu erbringen. Der Kunde muss beispielsweise nicht mehr, wie Rönsch sich ausdrückte, „von Pontius zu Pilatus“38 laufen. Das Problem wird direkt und mit seiner Hilfe gelöst. Damit wäre das uno-actu Prinzip gegeben, ein für einige Wissenschaftler (hier seien vor allem Nerdinger und Gartner/Riesman genannt) notwendiges Merkmal tertiärer Tätigkeiten. In seiner Art der Erklärung kommt Rönsch dabei sehr dem Ansatz von Berger/Offe nahe. Beide erklären den Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft unter dem Deckmantel des Strukturfunktionalismus.
Interessant dabei ist jedoch: Die Argumentation ist sowohl bei Berger/Offe als auch bei Rönsch die gleiche. Beide sehen Dienstleistungen aus den Defekten vorheriger Strukturen erwachsen. Berger/Offe nennen sie „formbeschützend“, Rönsch unternimmt den Umweg über die Bürokratie. Folgen wir der Definition Berger/Offes, so ist dieser Umweg eigentlich sinnlos. Die staatliche Bürokratie, wie Rönsch sie beschreibt, ist aufgrund ihrer formbeschützenden Tätigkeit als Dienstleistung zu deklarieren. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären?
Der Widerspruch besteht nur insofern, als Rönsch sich weigert, den bürokratischen Elementen der Gesellschaft ihren tertiären Charakter anzuerkennen. Im Prinzip hat er dieselbe Sichtweise wie Berger/Offe: Aus dem Konkurrenzdruck (Rönsch) oder der Rationalisierung unproduktiver Tätigkeiten (Berger/Offe) entstehen Irrationalitäten und aus diesen systemerhaltende Strukturen, die die eigentliche industrielle Produktion unterstützen. Berger/Offe nennen diese neuen Strukturen oder Tätigkeiten - auch die bürokratischen -„Dienstleistungen“, Rönsch dagegen „Bürokratie“.
Nun wird, etwa hundert Jahre später, ein neues Phänomen beobachtet: Die Sklerose der Bürokratie aufgrund des Koordinierungsmangels. Es entstehen neue tertiäre Elemente durch Externalisierung und Intra-Tertiarisierung, also unfreiwilliger Auslagerung von Koordinationsleistungen und dem Bestreben, sie in produktiverer Form wieder innerhalb des bürokratischen Apparates zu erbringen. Nach Berger/Offe führt dies nicht unbedingt zu der von Rönsch diagnostizierten Steigerung tertiärer Elemente in der Gesellschaft, denn Bürokratie ist Dienstleistung39, sie ist formbeschützend. Allenfalls ändert sich die Art der Bereitstellung der Dienste (durch Privatisierung bzw. Strukturwandel innerhalb der Organisation). Es entstehen nur insofern zusätzliche Dienstleistungen neu, als es durch Unterstützung der Internalisierung bislang extern erbrachter Leistungen nötig ist, zusätzliche Tätigkeiten zu etablieren (z.B. den Informationsschalter statt einer Hinweistafel in öffentlichen Ämtern). Rönsch kann also, basierend auf der funktionalen Definition, die er ja eigentlich verwendet, nur die Expansion der Dienstleistungen durch Kontrollverlust der Bürokratie erklären. Jedoch erhebt er den Anspruch, den bisher unter der „Regel“ der Bürokratie durchgeführten Tätigkeiten eine tertiäre Wandlung zu bescheinigen, indem er, zusätzlich zur Formerhaltung, plötzlich gewisse Handlungsprinzipien als typisch tertiär darstellt. Nach Berger/Offe ist dies falsch: Es waren schon immer Dienstleistungen!
Lägen wir also die Bergersche Definition von Dienstleistung zugrunde, so ist die Theorie von Rönsch nur mehr die Beschreibung einer strukturellen Veränderung innerhalb tertiärer Tätigkeiten. Sind Dienstleistungen aber nicht nur durch ihren formbeschützenden Charakter, sondern auch durch den Prozess ihrer Erbringung (Symbiose, Kompromiss statt Kontrolle, Koordinierung statt Anweisung) beschrieben, so wird der Behauptung Berger/Offes, Dienstleistungen wären schon parallel zur Industrialisierung im 19. Jh. massenhaft entstanden40, der Wind aus den Segeln genommen. Letztendlich liegt es mal wieder an der fehlenden allgemeingültigen Definition des Begriffs „Dienstleistung“.
Die eigentliche Qualität der Arbeit von Rönsch liegt in der gleichrangigen Behandlung von Makro- und Mikro-Ebene. Ihn interessiert nicht nur der gesellschaftliche Wandel, auch - und hier wird die Verbundenheit zu Weber wieder deutlich - die Veränderungen auf individueller Ebene werden untersucht. Rönsch stellt ein Aufweichen der Rollendefinitionen fest. Zeitgleich mit der Tertiarisierung bürokratischer Elemente gewinnt das Individuum im Gegensatz zur von ihm eingenommenen Rolle immer mehr an Bedeutung. Die in der bürokratischen Wohlfahrtsgesellschaft vorherrschende strikte Trennung von Rolle und Mensch löst sich zusehends auf. Er diagnostiziert dem ehemals durch bürokratische Elemente außengeleiteten Menschen vermehrte Selbstbestimmung in seinen Entscheidungen. Ursache ist der Stress, dem der Mensch aufgrund steigender Komplexität (analog zur Makro-Ebene) aus seiner Umwelt ausgesetzt ist. Konsequenz ist ein innengeleitetes Individuum mit hoher Flexibilität und Mobilität, das den „neuen“ Tätigkeitsbereichen im bürokratischen Sektor durchaus entgegenkommt.
Zwangsläufig stellt sich auch hier die Frage nach vergleichbaren Untersuchungen. Jedoch muss zuallererst resigniert festgestellt werden, dass andere Untersuchungen keine oder nur sporadische Versuche unternahmen, sich dem Individuum in der neuen Gesellschaft zu nähern. Einzig Sennett vermag hier Ergebnisse vorzuweisen. In seiner qualitativen Studie befasst sich dieser sogar vorrangig mit dem individuellen sozialen Wandel in der Gesellschaft. Allerdings gehen beide, Rönsch und Sennett, methodisch auf unterschiedliche Weise an das Thema heran. Während Rönsch die objektiv in der Gesellschaft beobachtbaren Veränderungen individuellen Verhaltens erhellt, interessiert Sennett ausschliesslich die subjektive Situation der Menschen. Er fragt danach, wie die Menschen selbst den gesellschaftlichen Veränderungen begegnen, wie sie ihre Situation beurteilen. Dabei wird folgender Unterschied deutlich. Rönsch vermittelt den Eindruck eines sich selbst bestimmenden Individuums, welches nicht mehr oder nur noch schwach an bestehende Muster gebunden ist. Sennett jedoch unterstellt dieser objektiven Selbstbestimmung scheinbaren Charakter. In diversen Interviews (die Geschichte von Rico macht dies deutlich) empfinden die Menschen ihre Lage als weiterhin fremdbestimmt. Sie sind nicht in der Lage, nach ihren eigenen Wertvorstellungen zu leben. Der „neue“ Kapitalismus zwingt sie vor immer neue Entscheidungen zu treten, denen sie, obwohl scheinbar selbst erwählt, hilflos gegenüber stehen. Sie ergeben sich in ihr Schicksal und versuchen so gut wie möglich, nach den geforderten Bedingungen zu leben. Sie befinden sich im Zustand der „Drift“ (siehe Kapitel in dieser Arbeit). Der „innere Kompass“, dem Rönsch so große Bedeutung beimisst, dient nur noch der Reaktion auf vorgegebene Tatsachen. Demnach hat laut Sennett keineswegs die Innenleitung an Bedeutung gewonnen, auch wenn die Gesellschaft uns das suggeriert.
Vielleicht liegt dies am unterschiedlichen Stellenwert, dem beide Autoren der Mikro-Ebene beimessen. Rönsch sieht die Entwicklungen auf gesellschaftlicher und individueller Ebene getrennt und unabhängig voneinander. Er beobachtet einen steigenden Bedarf des von ihm beschriebenen innengeleiteten Menschen in den neuen Organisationsstrukturen und umgekehrt auch, dass „...Dienstleistungstätigkeiten eine spezifische organisatorische Umgebung voraussetzen,...“41, die durch die Einführung tertiärer Strukturen nun einmal gegeben ist. Weder gesteht er den Ebenen ein einseitige, noch eine Wechselbeziehung zu. Den Grund, warum beide Veränderungen zeitgleich vonstatten gehen und warum sie kompatibel sind, bleibt er uns schuldig. Vage Andeutungen auf externe Prozesse und Einwirkungen (Wertewandel) vermögen dieses Dunkel nicht ausreichend zu erhellen.
Sennett erfasst dagegen, ausgehend von gesellschaftlichem Wandel, die Konsequenzen auf subjektiv individueller Ebene. Für ihn sind die Veränderungen im Leben der Menschen direkte Folge dieses Wandels. Diese Kausalbeziehung ist nur tragbar, weil sie empirisch in den Gesprächen mit verschiedenen Personen ermittelt wurde. Inwiefern sie dadurch mehr Gültigkeit hat als die rein theoretische Analyse von Rönsch, dies sei dahingestellt.
Doch schliessen sich die Thesen bei näherer Betrachtung nicht aus. Im Prinzip haben beide recht. Natürlich etabliert sich zwangsläufig der „driftende“, demnach außengeleitete Mensch in der heutigen Zeit. Er wird vom derzeitigen gesellschaftlichen Wandel gefordert, will man sich unter dem Druck der Schnelllebigkeit behaupten. Andererseits werden, objektiv betrachtet, die Entscheidungen für gewisse Alternative an den Menschen zur freien Wahl vergeben. Die Liberalisierung, nicht nur des Wirtschaftslebens, ist einzig mit einem emanzipierten Individuum möglich. Die Alternativen dieser freien Wahl jedoch schränkt die Gesellschaft von vornherein ein, im Extremfall auf das Minimum. Das innengeleitete Selbstmanagement der Individuen (Rönsch) erscheint einem dadurch wie eine leere Worthülse.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Begriff der Dienstleistung ein sehr dehnbarer ist, der, bezeichnend für sozialwissenschaftliche Forschung, schon seit der Pionierarbeit eines Fourastié oder eines Bell durch die unterschiedliche Verwendung zu unterschiedlichen Ergebnissen führt. Voll bestätigen lässt sich keine Theorie. Ansatzweise sind sowohl negative Tendenzen zu beobachten, wie sie beispielsweise Baumol mit seiner Kostenkrankheit vorhergesagt hat, doch lassen sich empirisch belegte Ergebnisse vorweisen, die genau das Gegenteil erkennen lassen. So vergrößert sich das Angebot an unproduktiven, weil teuren Dienstleistungen in den USA oder auch Schweden weiterhin, trotz der Kostenkrankheit. Es steht außer Frage, dass sie auch in diesen Staaten existiert, aber es gibt scheinbar Mechanismen, die dem entgegenwirken. Auch allzu positive Szenarien wie die Bellsche postindustrielle Gesellschaft sind nur teilweise eingetreten. Wahrscheinlich liegt in allen diesen klassischen Theorien über Dienstleistungsgesellschaften ein Körnchen Wahrheit versteckt. Welches dies sein wird, das kann nur die Praxis zeigen.
In neuerer Zeit ist man dazu übergegangen, aufgrund der Komplexität jeweils nur einen Ausschnitt dessen zu beleuchten, was Dienstleistungsexpansion genannt wird.
Entweder man beschränkt sich auf eine eingeengte, aber dafür „saubere“ Erklärungsweise (siehe Rönsch und Berger/Offe und ihre funktionale Herangehensweise) oder erklärt nur einen Teil des vielfältigen Bestands an Dienstleistungen (vor allem Gorz, Gartner/Riesman oder Veblen). Eine allgemeine Theorie der Dienstleistungsgesellschaft zu erstellen, scheint aufgegeben worden zu sein. Dies liegt in erster Linie, wie in dieser Arbeit deutlich wurde, am sehr heterogenen Begriff „Dienstleistung“, an dessen allgemeingültiger Definition man schon scheitert, und an der unterschiedlichen Betrachtung seitens der Autoren.
5 Literatur
Bell, D. (1984; 1972/1974): Die Dimensionen der nachindustriellen Gesellschaft. In: Kern/Lucian (Hrsg.): Probleme der postindustriellen Gesellschaft. Königstein/Ts.
Berger, J./Offe, C. (1984): Die Entwicklungsdynamik des Dienstleistungssektors. In: Offe, C. (Hrsg.): „Arbeitsgesellschaft“: Strukturprobleme und Zukunftsperspektiven. Frankfurt
Breuer, Stefan (1991): Max Webers Herrschaftssoziologie. Frankfurt/New York: Campus
Häußermann/Siebel (1995): Dienstleistungsgesellschaften. Frankfurt: Suhrkamp
Nerdinger, Friedemann W. (1994): Zur Psychologie der Dienstleistung: theoretische und empirische Studien zu einem wirtschaftspsychologischen Forschungsfeld. Stuttgart: Schäffer-Poeschel
Käsler, Dirk (1995): Max Weber. Eine Einführung in Leben, Werk und Wirkung. Frankfurt/M., New York: Campus
Rönsch, H.-D. (1998): Die Geburt der Dienstleistungsgesellschaft aus der Krise des bürokratischen Prinzips. unveröffentlichtes Typoskript
Sennett, Richard (1998): Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus. Berlin: Berlin Verlag
Weber, Max (1964): Soziologie, weltgeschichtliche Analysen, Politik. Stuttgart: Alfred Kröner
Weber, Max (1972): Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: J.C.B. Mohr, vor allem S.125-131 und 551-5
Wiswede, Günter (1991): Soziologie. Ein Lehrbuch für den wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Bereich. Landsberg am Lech: moderne industrie, S.290
[...]
1 Aus Der SPIEGEL 1/98, S.54f.
2 vgl. u.a. Nerdinger, Friedemann W. (1994): Zur Psychologie der Dienstleistung: theoretische und
empirische Studien zu einem wirtschaftspsychologischen Forschungsfeld. Stuttgart: Schäffer-Poeschel, S.8-10
3 vgl. ebenda, S.8-10
4 ebenda, S.28
5 Häußermann/Siebel (1995): Dienstleistungsgesellschaften. Frankfurt: Suhrkamp, S.21
6 Nerdinger, Friedemann W. (1994): Zur Psychologie der Dienstleistung: theoretische und empirische Studien zu einem wirtschaftspsychologischen Forschungsfeld. Stuttgart: Schäffer-Poeschel, S.47
7 vgl. Häußermann/Siebel (1995), S.25
8 Nerdinger (1994), S.54
9 Für eine exakte Betrachtung der Dyade siehe Nerdinger (1994), S.60
10 vgl. Häußermann/Siebel (1995): S.29-37
11 Häußermann/Siebel (1995): S.29
12 Fourastié, Jean (1954): Le Grand Espoir Du Xxe Siècle. Zitiert nach Häußermann/Siebel (1995), S.32
13 Häußermann/Siebel (1995): S.32
14 zu Bell und nachfolgend auch Gartner/Riesman vgl. Häußermann/Siebel (1995): S.37-44
15 Häußermann/Siebel (1995): S.41
16 vgl. Häußermann/Siebel (1995): S.44-48
17 Häußermann/Siebel (1995): S.46
18 vgl. Häußermann/Siebel (1995): S.47
19 Häußermann/Siebel (1995): S.137
20 vgl. das Beispiel in Häußermann/Siebel (1995): S.137
21 vgl. Häußermann/Siebel (1995): S.145
22 Häußermann/Siebel (1995): S.167
23 Sennett, Richard (1998): Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus. Berlin: Berlin Verlag
24 Sennett, Richard (1998), S.34
25 Vgl. ausführlich in Weber, Max (1972): Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: J.C.B. Mohr, vor allem S.125-131 und 551-579
26 Wiswede, Günter (1991): Soziologie. Ein Lehrbuch für den wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Bereich. Landsberg am Lech: moderne industrie, S.290
27 Weber, Max (1964): Soziologie, weltgeschichtliche Analysen, Politik. Stuttgart: Alfred Kröner, S.153f.
28 siehe ausführlich zur Sklerose der Bürokratie in Breuer, Stefan (1991): Max Webers Herrschaftssoziologie. Frankfurt/New York: Campus, S.210-215
29 Rönsch, H.-D. (1998): Die Geburt der Dienstleistungsgesellschaft aus der Krise des bürokratischen Prinzips. unveröffentlichtes Typoskript, S.3
30 Rönsch H.-D. (1998), S.6
31 ebenda
32 ebenda
33 vgl. Rönsch, H.-D. (1998), S.8
34 ausführlich ist das Webersche Konzept des Idealtypus dargestellt bei Käsler, Dirk (1995): Max Weber. Eine Einführung in Leben, Werk und Wirkung. Frankfurt/M., New York: Campus, S.229-235
35 Käsler, Dirk (1995): Max Weber. Eine Einführung in Leben, Werk und Wirkung. Frankfurt/M., New York: Campus, S.231
36 Rönsch, H.-D. (1998), S.10
37 Rönsch, H.-D. (1998), S.10
38 Rönsch, H.-D.(1998), S.5
39 Vgl. Häußermann/Siebel (1995), S.157
40 ebenda, S.158
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptfokus dieses Textes?
Der Text analysiert die Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft, insbesondere im Kontext der Bürokratie. Er untersucht, wie Defekte in bürokratischen Strukturen zur Entstehung und Expansion von Dienstleistungen führen.
Wie definiert der Text den Begriff "Dienstleistungsgesellschaft"?
Eine Dienstleistungsgesellschaft wird als eine Gesellschaft definiert, deren Beschäftigungsstruktur durch ein Übergewicht von Dienstleistungen gekennzeichnet ist. Der Text diskutiert auch sektorale und funktionale Gliederungen des Wirtschaftslebens, um den Begriff genauer zu fassen.
Welche klassischen Ansätze zur Erklärung der Dienstleistungsgesellschaft werden im Text vorgestellt?
Der Text stellt sowohl optimistische als auch pessimistische Theorien vor. Zu den Optimisten gehören Fourastié und Bell, die die steigende Bedeutung von Dienstleistungen und Wissen betonen. Zu den Pessimisten gehören Baumol und Gershuny, die Bedenken hinsichtlich Produktivität und Kosten äußern.
Was ist Baumols "Kostenkrankheit" und wie beeinflusst sie Dienstleistungen?
Baumols Theorie besagt, dass Dienstleistungen tendenziell produktivitätsavers sind und daher im Vergleich zur Industrieproduktion immer teurer werden. Dies kann dazu führen, dass sie vom Markt verschwinden oder staatlich subventioniert werden müssen.
Was sind die Hauptursachen für die tertiäre Expansion laut dem Text?
Die Ursachen werden sowohl aus ökonomischer als auch aus soziologischer Sicht betrachtet. Ökonomisch gesehen spielen Produktivität und Investitionen eine Rolle. Soziologisch werden systemerhaltende Funktionen und innovative Dienstleistungen unterschieden.
Wie erklärt der Text die tertiäre Expansion aus den Defekten der Bürokratie (Rönsch)?
Rönsch argumentiert, dass die Bürokratie im Laufe ihrer Entwicklung aufgrund steigender Komplexität Kontrollverluste erleidet. Dies führt zur Externalisierung von Koordinierungsleistungen (die von externen Dienstleistern übernommen werden) und zur Intra-Tertiarisierung (der Integration tertiärer Elemente in die Bürokratie selbst).
Was bedeutet "Rollenerosion" im Kontext der Bürokratie?
Rollenerosion bezieht sich auf die Auflösung fester Rollen innerhalb bürokratischer Strukturen, bedingt durch schnellen Wandel, ungewöhnliche Situationen und steigende Koordinierungsanforderungen. Dies führt dazu, dass das Individuum mehr Autonomie und Flexibilität benötigt.
Wie beschreibt der Text den "bürokratischen Menschen" im Vergleich zum "Dienstleister"?
Der bürokratische Mensch ist durch Unabhängigkeit von Individuum und Rolle, Regelorientierung und Subjekt-Objekt-Beziehungen gekennzeichnet. Der Dienstleister hingegen orientiert sich am Konsens, betont die Bedeutung der Person, setzt auf Symbiose und pflegt Subjekt-Subjekt-Beziehungen.
Welche Kritik wird an Rönschs Ansatz im Text geäußert?
Die Kritik zielt darauf ab, dass Rönsch die bürokratischen Elemente der Gesellschaft nicht als Dienstleistungen anerkennt, wie es Berger/Offe tun würden. Außerdem wird die Rolle des Individuums bei gesellschaftlichen Veränderungen diskutiert, insbesondere im Vergleich zu Sennetts Analyse des "flexiblen Menschen".
Was ist das Fazit des Textes?
Das Fazit betont die Heterogenität des Begriffs "Dienstleistung" und die vielfältigen Perspektiven auf die Dienstleistungsexpansion. Es wird festgestellt, dass keine Theorie vollständig bestätigt werden kann und dass die Betrachtung der Mikro- und Makroebene wichtig ist, um die Komplexität des Themas zu verstehen.
- Quote paper
- Marco Streibelt (Author), 2000, Bürokratie und Dienstleistung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97980