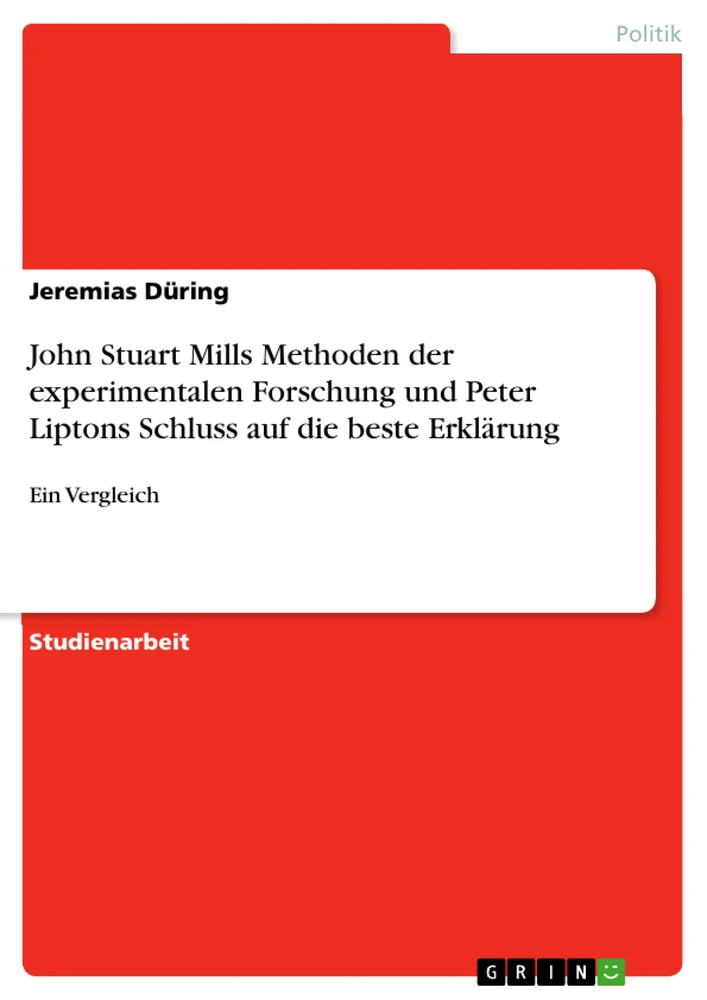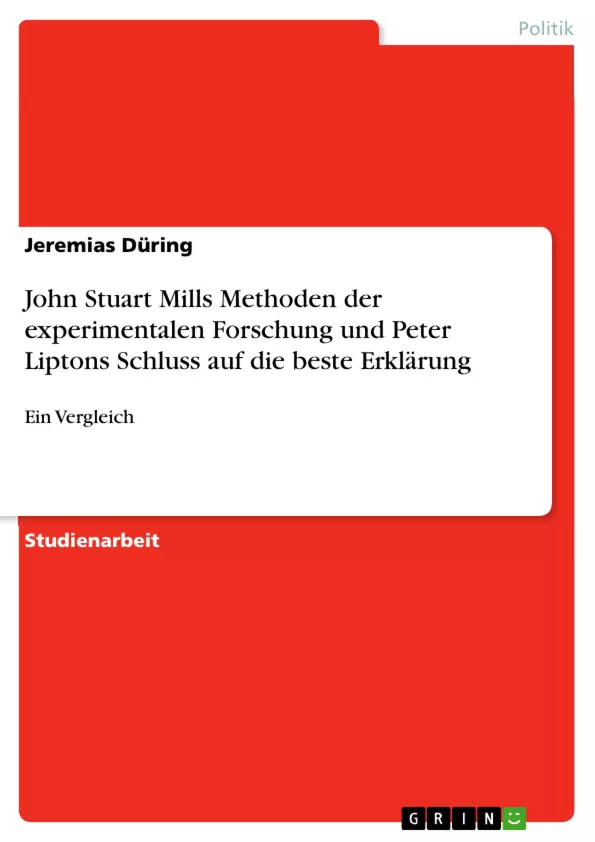Weil der Schluss auf die beste Erklärung bisher mehr einem Slogan als einer klar ausformulierten philosophischen Theorie gleiche, versucht Peter Lipton in seiner Monografie Inference to the Best Explanation, eben jenen Slogan in einen theoretischen Rahmen zu bringen. Zentral für seinen Vorschlag ist die sogenannte Differenzbedingung („Difference Condition“). Ihr zufolge lässt sich die beste Erklärung eines Ereignisses durch den Vergleich zwischen einem Phänomen P und einem weiteren Phänomen Q herausfinden, bei dem sich auf einen Unterschied in der kausalen Vorgeschichte von P und der von nicht-Q berufen wird, der aus einer Ursache von P und der Abwesenheit eines korrespondierenden Ereignisses im Falle von Nicht-Q besteht.
Bereits in der ersten Auflage von Inference to the Best Explanation macht Lipton auf die große strukturelle Ähnlichkeit zwischen seiner Differenzbedingung und der erstmals von John Stuart Mill beschriebenen Differenzmethode aufmerksam. Wegen dieser Nähe sieht Lipton sich dem Einwand ausgesetzt, dass sei- ne Version des Schlusses auf die beste Erklärung womöglich nur eine aufgehübschte Variante eines mit Mills Methoden operierenden Ansatzes des kausalen Schließens ist. Ich werde in diesem Aufsatz darlegen, dass die von Lipton als Reaktion behaupteten Vorzüge des Schlusses auf die beste Erklärung gegenüber Mills Differenzmethode nicht ausreichen werden, um diesen Einwand zurückzuweisen.
Hierzu werden im nachfolgenden Kapitel die wichtigsten Aspekte von Liptons Version des Schlusses auf die beste Erklärung rekonstruiert, nachdem zuvor kurz darauf eingegangen wird, inwiefern sich Lipton durch seinen Ansatz einen Fortschritt gegenüber alternativen Modellen des induktiven Schließens erhofft hat. Anschließend werden im nächsten Kapitel Mills vier Methoden mit ihren Anwendungsmöglichkeiten und Einschränkungen vorgestellt. Darauf aufbauend erfolgt im abschließenden Kapitel eine Gegenüberstellung von Mills Methoden und Liptons Schluss auf die beste Erklärung, bei der die von Lipton behaupteten Probleme der Differenzmethode im Hinblick auf geschlussfolgerte Unterschiede („inferred differences“) und mehrfache Unterschiede („multiple differences“) zurückgewiesen wird. Am Ende der Gegenüberstellung wird besprochen, was zu Liptons bisherigen Ausführungen zum Schluss auf die beste Erklärung hinzukommen müsste, um tatsächlich einen merklichen Vorteil gegenüber dem kausalen Schließen darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Induktion und der Schluss auf die beste Erklärung
- Mills Methoden
- Liptons Schluss auf die beste Erklärung versus Mills Methode
- Geschlussfolgerte Unterschiede
- Mehrfache Unterschiede
- Explanatorische Tugenden
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz untersucht die Beziehung zwischen John Stuart Mills Methoden der experimentellen Forschung und Peter Liptons Schluss auf die beste Erklärung. Der Fokus liegt darauf, zu analysieren, ob Liptons Ansatz als eine bloße Aufwertung von Mills Methoden angesehen werden kann, oder ob er tatsächlich einzigartige Vorteile gegenüber traditionellen induktiven Schlussfolgerungen bietet.
- Analyse von Liptons Schluss auf die beste Erklärung und dessen Bezug zur Differenzbedingung.
- Rekonstruktion der zentralen Argumente von Liptons Modell und dessen Vergleich mit alternativen Modellen des induktiven Schließens.
- Vorstellung von Mills vier Methoden und deren Anwendungsmöglichkeiten sowie Einschränkungen.
- Gegenüberstellung von Mills Methoden und Liptons Ansatz, wobei die vermeintlichen Vorteile des Schlusses auf die beste Erklärung im Hinblick auf geschlussfolgerte und mehrfache Unterschiede diskutiert werden.
- Abschließende Bewertung der Argumente und Analyse der Anforderungen, die an Liptons Theorie gestellt werden müssen, um einen klaren Vorteil gegenüber Mills Methoden zu demonstrieren.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt Liptons Werk "Inference to the Best Explanation" vor und skizziert das Problem der Unterscheidung zwischen seinem Ansatz und Mills Methoden. Der Aufsatz wird strukturiert und die zentralen Argumente und Fragestellungen werden vorgestellt.
- Induktion und der Schluss auf die beste Erklärung: Dieses Kapitel erläutert das Problem der Unterdeterminiertheit und diskutiert verschiedene Modelle des induktiven Schließens. Dabei wird auf die Herausforderungen eingegangen, die sich aus der Suche nach einer einheitlichen Beschreibung unserer induktiven Praxis ergeben.
- Mills Methoden: Dieses Kapitel stellt Mills vier Methoden der experimentellen Forschung vor, einschließlich ihrer Anwendungsmöglichkeiten und Einschränkungen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Differenzmethode, die im Folgenden mit Liptons Ansatz verglichen wird.
- Liptons Schluss auf die beste Erklärung versus Mills Methode: In diesem Kapitel wird ein direkter Vergleich zwischen Liptons Ansatz und Mills Methoden durchgeführt. Die von Lipton geltend gemachten Vorteile des Schlusses auf die beste Erklärung werden im Hinblick auf geschlussfolgerte Unterschiede und mehrfache Unterschiede untersucht.
Schlüsselwörter
Induktion, Schluss auf die beste Erklärung, Differenzbedingung, Mills Methoden, Differenzmethode, kausales Schließen, wissenschaftliche Erklärung, Unterdeterminiertheit, Hypothetico-deduktives Modell, Bayesianisches Wahrscheinlichkeitstheorem.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Peter Lipton unter dem „Schluss auf die beste Erklärung“?
Es handelt sich um ein Modell des induktiven Schließens, bei dem aus einer Reihe von Fakten auf diejenige Hypothese geschlossen wird, die diese am besten erklären würde.
Was ist John Stuart Mills Differenzmethode?
Die Differenzmethode besagt: Wenn ein Phänomen in einem Fall auftritt und in einem anderen nicht, und sich beide Fälle nur in einem Umstand unterscheiden, dann ist dieser Umstand die Ursache oder ein notwendiger Teil der Ursache.
Wo liegen die Ähnlichkeiten zwischen Lipton und Mill?
Liptons „Differenzbedingung“ ähnelt strukturell stark Mills Differenzmethode, da beide auf dem Vergleich von Fällen basieren, um kausale Unterschiede zu identifizieren.
Welche Kritik wird an Liptons Ansatz geäußert?
Kritiker hinterfragen, ob Liptons Modell tatsächlich einen theoretischen Fortschritt gegenüber Mills klassischen Methoden darstellt oder lediglich eine moderne Umformulierung ist.
Was ist das Problem der Unterdeterminiertheit?
Es bezeichnet die Situation, in der die verfügbaren Daten nicht ausreichen, um eindeutig zwischen verschiedenen konkurrierenden wissenschaftlichen Theorien zu entscheiden.
- Arbeit zitieren
- Jeremias Düring (Autor:in), 2019, John Stuart Mills Methoden der experimentalen Forschung und Peter Liptons Schluss auf die beste Erklärung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/979861