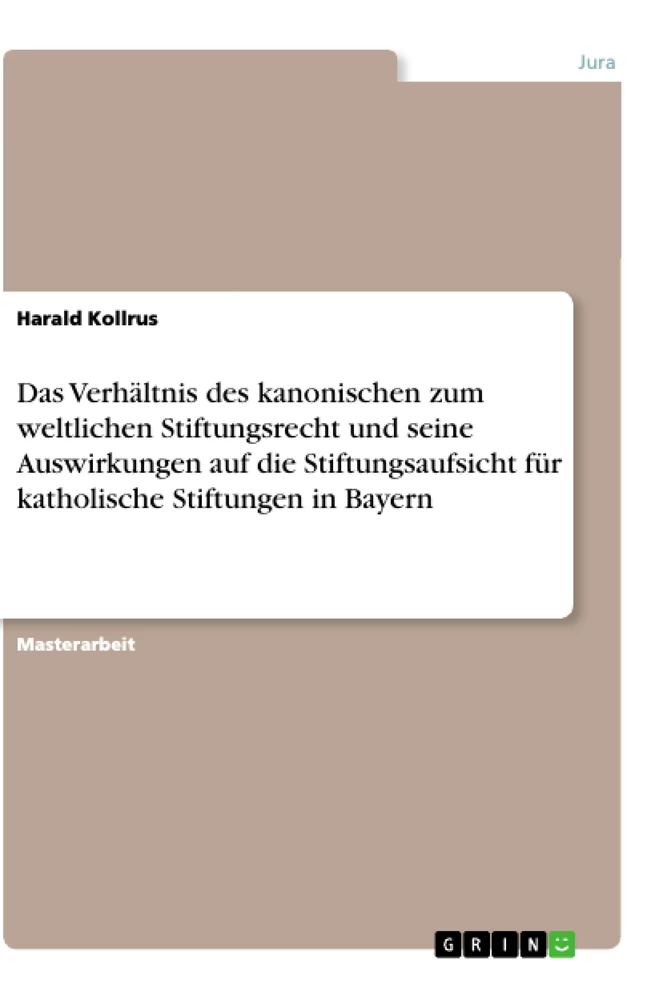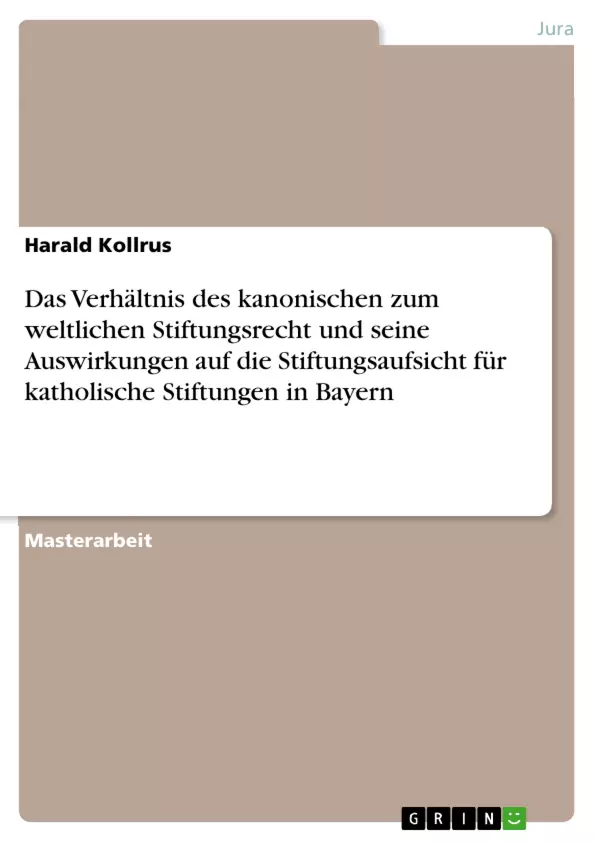Gegenstand der Master-Thesis ist eine Untersuchung des Verhältnisses von kanonischem zu weltlichem Stiftungsrecht und ihre Auswirkungen auf die Stiftungsaufsicht für katholische Stiftungen in Bayern. Kanonisches Recht muss infolgedessen die Voraussetzungen schaffen, dass die Kirche über die notwendigen zeitlichen Güter rechtssicher verfügen kann. Insoweit regelt Art. 2 KiStiftO abschließend, welche Vorschriften für kirchliche Stiftungen in Bayern gelten. Kraft der Selbstbestimmungs- und Selbstverwaltungsautonomie entfalten dabei kanonische Regelungen, welche eigene Angelegenheiten kirchlicher Stiftungen als Teil der Kirche zum Gegenstand haben, Rechtswirkung für das weltliche Recht.
Streitig ist, welches Gewicht der Autonomie im Rahmen der verfassungsrechtlichen Güterabwägung beigemessen wird. Die Kirchengutsgarantie ergänzt dieses Selbstbestimmungsrecht. Im Wege der praktischen Konkordanz führt die Garantie je nach Nähe zum Sendungsauftrag zum abgestuften besonderen Vermögensschutz. Soweit diese Autonomie nicht greift, setzt kanonisches Recht umgekehrt in weiten Bereichen die Einhaltung der weltlichen Rechtsordnung voraus, um am weltlichen Rechtsverkehr wirksam teilzunehmen. Das weltliche Vermögensrecht wird kanonisiert. Auf die Stiftungsaufsicht übertragen führt das dazu, dass die Kirche als eigene Angelegenheit im Wesentlichen die Stiftungsaufsicht über kirchliche Stiftungen autonom ausübt. Weil sie nicht nur die Rechts-, sondern auch die Fachaufsicht ausübt, sind einzelne Stiftungen versucht, sich als weltliche Stiftung zu verstehen und sich so dieser Aufsicht zu entziehen.
Die dafür erforderliche Unterscheidung zwischen weltlichen und kirchlichen Stiftungen lässt sich in Grenzfällen nicht allein anhand der gesetzlichen Vorgaben treffen. Dafür bietet die historisch-kasuistische Methode nach K. Meyer einen Prüfungsrahmen. Als Alternative stellt der Autor eine entsprechende Anwendung eines Stärke-Schwäche-Tools vor, welches für objektiviertere Entscheidungen in der Unternehmensberatung Anwendung findet.
Abschließend wird die dezentralisierte gestufte Stiftungsaufsicht dargelegt, womit die Kirche auf die Säkularisierungstendenzen reagiert. Sofern ein stiftungsinternes Aufsichtsgremium gebildet wird, dass bestimmten Anforderungen entspricht, wird die Stiftungsaufsicht weitgehend auf dieses Gremium übertragen und die gesetzliche Stiftungsaufsicht beschränkt sich nur noch auf die Überwachung dieses Gremiums und auf die bedeutsamen Fälle.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Unterscheidung zwischen weltlichen und kirchlichen Stiftungen
- 1.2. Säkularisierungstendenzen bei Stiftungen
- 1.3. Vielschichtigkeit des Stiftungsrechts für kirchliche Stiftungen
- 1.4. Weitere aktuelle Themenfelder für kirchliche Stiftungen
- 1.5. Zielsetzung der Arbeit
- 1.6. Verlauf der Untersuchung
- 2. Rechtsdualismus von weltlichem und kanonischem Stiftungsrecht
- 2.1. Vielschichtigkeit der Stiftungsverfassung
- 2.1.1. Vorrang des Stiftungsgeschäfts innerhalb des zwingend vorgegebenen Rechtsrahmens
- 2.1.2. Rechtliche Rahmenvorschriften für das Stiftungsgeschäft
- 2.1.2.1. Weltliches Stiftungsrecht
- 2.1.2.2. Kanonisches Stiftungsrecht
- 2.1.3. Rangverhältnis der unterschiedlichen Rechtsvorschriften zueinander
- 2.2. Die Kirche als staatliches Rechtssubjekt
- 2.3. Das kirchliche Selbstbestimmungsrecht
- 2.3.1. Kirchen und anerkannte Religionsgemeinschaften i. S. v. Art. 137 Abs. 3 WRV/ Art. 142 Abs. 3 Satz 1 BV
- 2.3.2. Besonderheiten bei Auslegung von Verfassungsrechten, insbes. des GG
- 2.3.3. Stiftung als Untergliederung der Kirche
- 2.3.4. Das kirchliche Stiftungswesen als Gegenstand des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts
- 2.3.5. Bestimmung des Sendungsauftrags im Hinblick auf die Interpretation der eigenen Angelegenheiten
- 2.3.6.
- 2.4. Die Stiftung als Finanzierungsinstrument der Kirche
- 2.4.1. Interpretatorische Wechselwirkung von Glaubensfreiheit und Selbstbestimmungsrecht
- 2.4.2. Gerichtliches Bewertungsverbot für kirchliche Abwägungsentscheidungen
- 2.4.3. Resümee aus der Rechtsprechung des BVerfG
- 2.4.4. Aktuell gegenläufige Tendenzen in der Rechtsprechung zur Höhergewichtung einfacher Gesetze und von Grundrechten der EMRK
- 2.4.5. Fazit
- 2.5. Kirchengutsgarantie Art. 140 GG i.V.m. Art. 138 Abs. 2 WRV
- 2.5.1. Inhalt und Bedeutung der verfassungsmäßigen bzw. konkordären Eigentumsgarantie
- 2.5.2. Regelungsadressaten der Kirchengutsgarantie nach Rspr. des BVerfG
- 2.5.3. Stiftungen als Träger der Kirchengutsgarantie
- 2.5.4. Umfang und Reichweite des Eigentumsschutzes
- 2.5.5. Stellenwert der Kirchengutsgarantie in der weltlichen Rechtssystematik
- 2.6. Einfluss weltlicher Rechtsordnung, u. a. durch Kanonisierung weltlichen Rechts (c. 22 CIC)
- 2.6.1. Intendierte Kongruenz mit dem weltlichen Recht
- 2.6.2. Dynamische Verweisung im kanonischen Recht auf weltliches Recht durch Kanonisation
- 2.6.3. Resümee
- 3. Aufsichtskonkurrenz zwischen staatlicher und kirchlicher Aufsicht
- 3.1. Aktualität der Frage nach der Abgrenzung staatlicher und kirchlicher Stiftungsaufsicht
- 3.1.1. Aufsichtsfreiheit sog. fiduziarischer unselbständiger Stiftungen
- 3.1.2. Das verfassungsmäßige Begründung der Aufsichtskonkurrenz
- 3.2. Rechtssystem im Stiftungsaufsichtsrecht im Gründungsstadium von Stiftungen
- 3.2.1. Errichtung selbständiger Stiftungen
- 3.2.2. Errichtung unselbständiger Zustiftungen
- 3.2.3. Stiftungsannahme als besondere weitere Voraussetzung für die kanonische Stiftungserrichtung
- 3.2.4. Staatlicher Teil der Anerkennung
- 3.2.5. Kirchlicher Teil der Anerkennung von Stiftungen nach weltlichem Recht
- 3.2.6. Zwischenergebnis zur Errichtung von Stiftungen
- 3.3. Rechtliche Beurteilung von Stiftungen, die nur nach einer der beiden Rechtsordnungen rechtsfähig sind
- 3.3.1. Keine Geltung von kanonischem Gesellschaftsrecht für den weltlichen Rechtskreis
- 3.3.2. Zivilrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten für juristische Personen kanonischen Rechts in der Praxis
- 3.4. Aufsicht des Ordinarius als Vollstrecker frommer Verfügungen (c. 1303 CIC)
- 3.5. Kirchliche Stiftungsaufsicht in Form der Rechts- und Fachaufsicht
- 3.5.1. Rechtsaufsichtliche Aufgaben
- 3.5.2. Primat des Stifterwillens für die Rechtsaufsicht
- 3.5.3. Fachaufsichtlicher Aufgabenkreis
- 3.5.4. Umfassende Eingriffsbefugnisse kirchlicher Stiftungsaufsicht
- 4. Die Abgrenzung von weltlichen und kirchlichen Stiftungen
- 4.1. Erfahrungen aus den Rechtsstreitigkeiten Stiftung Liebenau
- 4.2. Gesetzliche Klassifizierungen als kirchliche Stiftung
- 4.2.1. Erkennbarer Stifterwille auf Widmung kirchlicher Zwecke
- 4.2.2. Organisatorische Anbindung
- 4.2.3. Vermutungen organisatorischer Anbindung der Stiftung an die Kirche
- 4.2.4. Zusammenfassung
- 4.3. Unsicherheit über den Rechtsstatus als kirchliche oder weltliche Stiftung
- 4.3.1. Keine Hilfestellung durch den steuerrechtlichen Begriff „Kirchliche Zwecke“
- 4.3.2. Feststellung des Rechtsstatus in zwei Schritten nach der historisch-kasuistischen Methode nach Meyer
- 4.3.2.1. Stufe 1: Ermittlung eindeutiger unproblematischer Konstellationen
- 4.3.2.2. Stufe 2: Umfassende Sachverhaltsrecherche mit Gesamtbetrachtung aller Indizien
- 4.3.2.3. Analyse der historisch-kasuistischen Methode
- 4.3.3. Inhaltliche Bewertung von Abgrenzungskriterien
- 4.3.3.1. Mathematische Gewichtung der Kriterien
- 4.3.3.2. Stellungnahme zu den aktuell herrschenden Abgrenzungstheorien
- 4.3.4. Alternative Bewertungsmethode für eine objektivierte Entscheidungsfindung
- 4.3.4.1. Verfahrensablauf
- 4.3.4.2. Analyse der Klassifizierung des Stiftungszwecks
- 5. Reaktion der Kirche auf Säkularisierungstendenzen
- 5.1. Forderung nach zurückhaltender Ausübung der Aufsichtskompetenzen
- 5.2. Prinzip der gestuften Stiftungsaufsicht
- 5.3. Analyse der gestuften Stiftungsaufsicht
- 5.3.1. Entlastungsfunktion für die gesetzliche Stiftungsaufsicht
- 5.3.2. Befriedungsfunktion der fakultativen dezentralisierten Aufsichtsebene
- 5.3.3. Einklang mit den Richtlinien für die Verwaltung der kirchlichen Güter der Institute des geweihten Lebens und der Gesellschaften apostolischen Lebens
- 5.3.4. Einfluss der aktuell veröffentlichten ethischen Grundsätze auf den materiell-rechtlichen Prüfungsmaßstab für die Stiftungsaufsicht
- 5.3.5. Analyse des Prüfungsmaßstabs
- 6. Ergebnis
- 6.1. Das Konkurrenzverhältnis zwischen kanonischem und weltlichem Stiftungsrecht
- 6.2. Regelungen des kanonischen Rechts mit Wirkung für den weltlichen Rechtskreis
- 6.3. Abgestufter Eigentumsschutz für kirchliche Güter
- 6.4. Sicherung der rechtssicheren Teilnahme von Stiftungen am weltlichen Rechtsverkehr
- 6.5. Stiftungsaufsicht als eigene Angelegenheit der Kirche
- 6.6. Abgrenzung weltlicher und kirchlicher Stiftungen
- 6.7. Gestufte dezentralisierte Stiftungsaufsicht als Reaktion der Kirche auf Säkularisierungstendenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das komplexe Zusammenspiel zwischen kanonischem und weltlichem Stiftungsrecht in Bayern, insbesondere seine Auswirkungen auf die Aufsicht katholischer Stiftungen. Sie analysiert die Rechtsgrundlagen, die Aufsichtsstrukturen und die Herausforderungen, die sich aus dem Dualismus der Rechtsordnungen ergeben.
- Das Verhältnis von kanonischem und weltlichem Stiftungsrecht
- Die Aufsichtskonkurrenz zwischen staatlicher und kirchlicher Aufsicht
- Die Abgrenzung zwischen weltlichen und kirchlichen Stiftungen
- Die Reaktion der Kirche auf Säkularisierungstendenzen im Stiftungsbereich
- Der Eigentumsschutz kirchlicher Güter
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, indem es die Unterscheidung zwischen weltlichen und kirchlichen Stiftungen erläutert, Säkularisierungstendenzen beschreibt und die Komplexität des Stiftungsrechts für kirchliche Stiftungen aufzeigt. Es benennt aktuelle Themenfelder und definiert die Zielsetzung sowie den methodischen Ablauf der Arbeit. Die Einleitung legt den Grundstein für die anschließende detaillierte Analyse des Rechtsdualismus und der daraus resultierenden Herausforderungen für die Stiftungsaufsicht.
2. Rechtsdualismus von weltlichem und kanonischem Stiftungsrecht: Dieses Kapitel analysiert den Rechtsdualismus, der durch das Nebeneinander von weltlichem und kanonischem Recht entsteht. Es untersucht die Vielschichtigkeit der Stiftungsverfassung, das Verhältnis der verschiedenen Rechtsvorschriften zueinander, das kirchliche Selbstbestimmungsrecht und dessen Schranken, die Kirchengutsgarantie und ihren Einfluss auf die Rechtssystematik. Der Fokus liegt auf der Interaktion und dem Spannungsverhältnis zwischen den beiden Rechtsordnungen im Kontext des Stiftungswesens. Der Einfluss der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und die aktuell gegenläufigen Tendenzen in der Rechtsprechung werden kritisch beleuchtet.
3. Aufsichtskonkurrenz zwischen staatlicher und kirchlicher Aufsicht: Dieses Kapitel befasst sich mit der Konkurrenz zwischen staatlicher und kirchlicher Stiftungsaufsicht. Es untersucht die Aktualität der Abgrenzungsfrage, die verfassungsmäßige Begründung der Aufsichtskonkurrenz, die rechtlichen Rahmenbedingungen im Gründungsstadium von Stiftungen (selbständige und unselbständige Stiftungen) und die Anerkennungsprozesse durch Staat und Kirche. Die Aufsicht des Ordinarius und die Aufgaben der kirchlichen Rechts- und Fachaufsicht werden detailliert analysiert.
4. Die Abgrenzung von weltlichen und kirchlichen Stiftungen: Dieses Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung zwischen weltlichen und kirchlichen Stiftungen. Es analysiert die Erfahrungen aus Rechtsstreitigkeiten (z.B. Stiftung Liebenau), gesetzliche Klassifizierungskriterien, die Unsicherheiten im Rechtsstatus und verschiedene Abgrenzungsmethoden. Es präsentiert und bewertet verschiedene Abgrenzungstheorien und schlägt eine alternative Bewertungsmethode für eine objektivere Entscheidungsfindung vor.
5. Reaktion der Kirche auf Säkularisierungstendenzen: Dieses Kapitel beschreibt die Reaktionen der Kirche auf Säkularisierungstendenzen im Stiftungsbereich. Es analysiert die Forderung nach zurückhaltender Ausübung der Aufsichtskompetenzen, das Prinzip der gestuften Stiftungsaufsicht und deren Funktionen (Entlastung und Befriedung). Der Einfluss von Richtlinien und ethischen Grundsätzen auf den Prüfungsmaßstab der Stiftungsaufsicht wird ebenfalls untersucht.
Schlüsselwörter
Kanonisches Recht, Weltliches Recht, Stiftungsrecht, Kirchliche Stiftungen, Stiftungsaufsicht, Rechtsdualismus, Selbstbestimmungsrecht der Kirche, Kirchengutsgarantie, Säkularisierung, Abgrenzungskriterien, Rechtsprechung, Bundesverfassungsgericht, Eigentumsschutz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Untersuchung des Zusammenspiels von Kanonischem und Weltlichem Stiftungsrecht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das komplexe Zusammenspiel zwischen kanonischem und weltlichem Stiftungsrecht in Bayern, insbesondere die Auswirkungen auf die Aufsicht katholischer Stiftungen. Analysiert werden die Rechtsgrundlagen, Aufsichtsstrukturen und Herausforderungen, die aus dem Dualismus der Rechtsordnungen resultieren.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Verhältnis von kanonischem und weltlichem Stiftungsrecht, der Aufsichtskonkurrenz zwischen staatlicher und kirchlicher Aufsicht, der Abgrenzung zwischen weltlichen und kirchlichen Stiftungen, der Reaktion der Kirche auf Säkularisierungstendenzen im Stiftungsbereich und dem Eigentumsschutz kirchlicher Güter.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Rechtsdualismus von weltlichem und kanonischem Stiftungsrecht, Aufsichtskonkurrenz zwischen staatlicher und kirchlicher Aufsicht, Abgrenzung weltlicher und kirchlicher Stiftungen, Reaktion der Kirche auf Säkularisierungstendenzen und Ergebnis. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas und baut auf den vorherigen Kapiteln auf.
Was wird im Kapitel "Rechtsdualismus von weltlichem und kanonischem Stiftungsrecht" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert den Rechtsdualismus durch das Nebeneinander von weltlichem und kanonischem Recht. Es untersucht die Stiftungsverfassung, das Verhältnis verschiedener Rechtsvorschriften, das kirchliche Selbstbestimmungsrecht, die Kirchengutsgarantie und den Einfluss der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.
Was ist der Fokus des Kapitels zur "Aufsichtskonkurrenz"?
Hier wird die Konkurrenz zwischen staatlicher und kirchlicher Stiftungsaufsicht untersucht. Es werden die Abgrenzungsfragen, die verfassungsmäßige Begründung der Aufsichtskonkurrenz, die rechtlichen Rahmenbedingungen im Gründungsstadium von Stiftungen und die Anerkennungsprozesse durch Staat und Kirche beleuchtet. Die Aufsicht des Ordinarius und die Aufgaben der kirchlichen Rechts- und Fachaufsicht werden detailliert analysiert.
Wie werden weltliche und kirchliche Stiftungen abgegrenzt?
Das Kapitel zur Abgrenzung beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Unterscheidung. Es analysiert Erfahrungen aus Rechtsstreitigkeiten, gesetzliche Klassifizierungskriterien, Unsicherheiten im Rechtsstatus und verschiedene Abgrenzungsmethoden. Verschiedene Abgrenzungstheorien werden präsentiert und bewertet, und eine alternative Methode für eine objektivere Entscheidungsfindung wird vorgeschlagen.
Wie reagiert die Kirche auf Säkularisierungstendenzen?
Dieses Kapitel beschreibt die Reaktionen der Kirche auf Säkularisierungstendenzen im Stiftungsbereich. Es analysiert die Forderung nach zurückhaltender Ausübung der Aufsichtskompetenzen, das Prinzip der gestuften Stiftungsaufsicht und deren Funktionen. Der Einfluss von Richtlinien und ethischen Grundsätzen auf den Prüfungsmaßstab der Stiftungsaufsicht wird untersucht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kanonisches Recht, Weltliches Recht, Stiftungsrecht, Kirchliche Stiftungen, Stiftungsaufsicht, Rechtsdualismus, Selbstbestimmungsrecht der Kirche, Kirchengutsgarantie, Säkularisierung, Abgrenzungskriterien, Rechtsprechung, Bundesverfassungsgericht, Eigentumsschutz.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zum Konkurrenzverhältnis zwischen kanonischem und weltlichem Stiftungsrecht, zu Regelungen des kanonischen Rechts mit Wirkung für den weltlichen Rechtskreis, zum Eigentumsschutz kirchlicher Güter, zur rechtssicheren Teilnahme von Stiftungen am weltlichen Rechtsverkehr, zur Stiftungsaufsicht als Angelegenheit der Kirche, zur Abgrenzung weltlicher und kirchlicher Stiftungen und zur gestuften dezentralisierten Stiftungsaufsicht als Reaktion auf Säkularisierungstendenzen.
- Arbeit zitieren
- Prof. Dr. Harald Kollrus (Autor:in), 2019, Das Verhältnis des kanonischen zum weltlichen Stiftungsrecht und seine Auswirkungen auf die Stiftungsaufsicht für katholische Stiftungen in Bayern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/980353