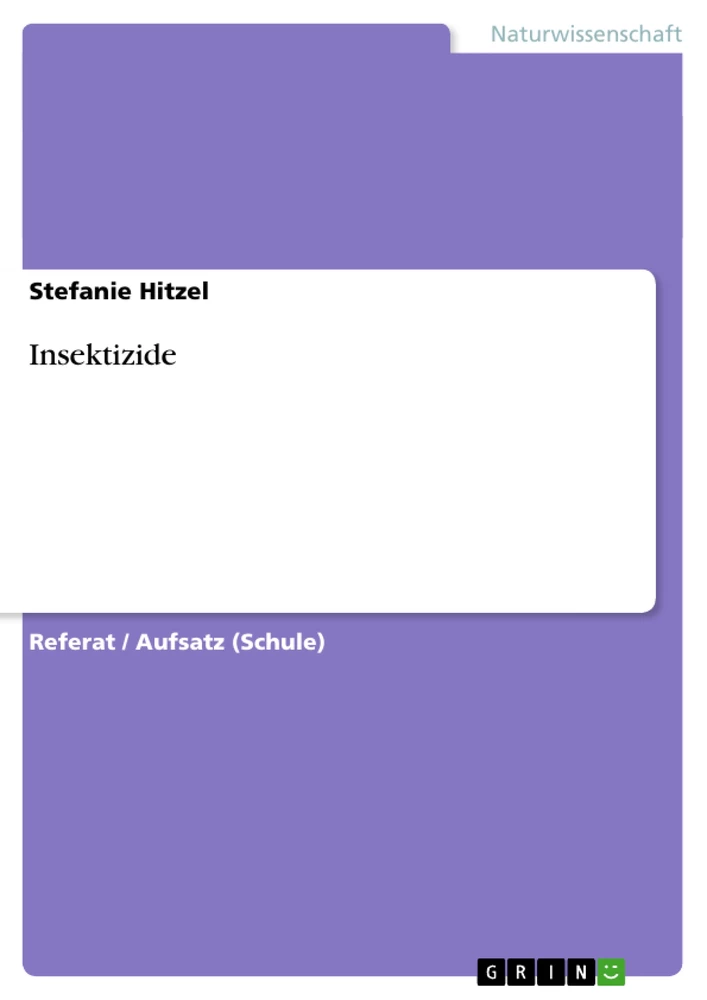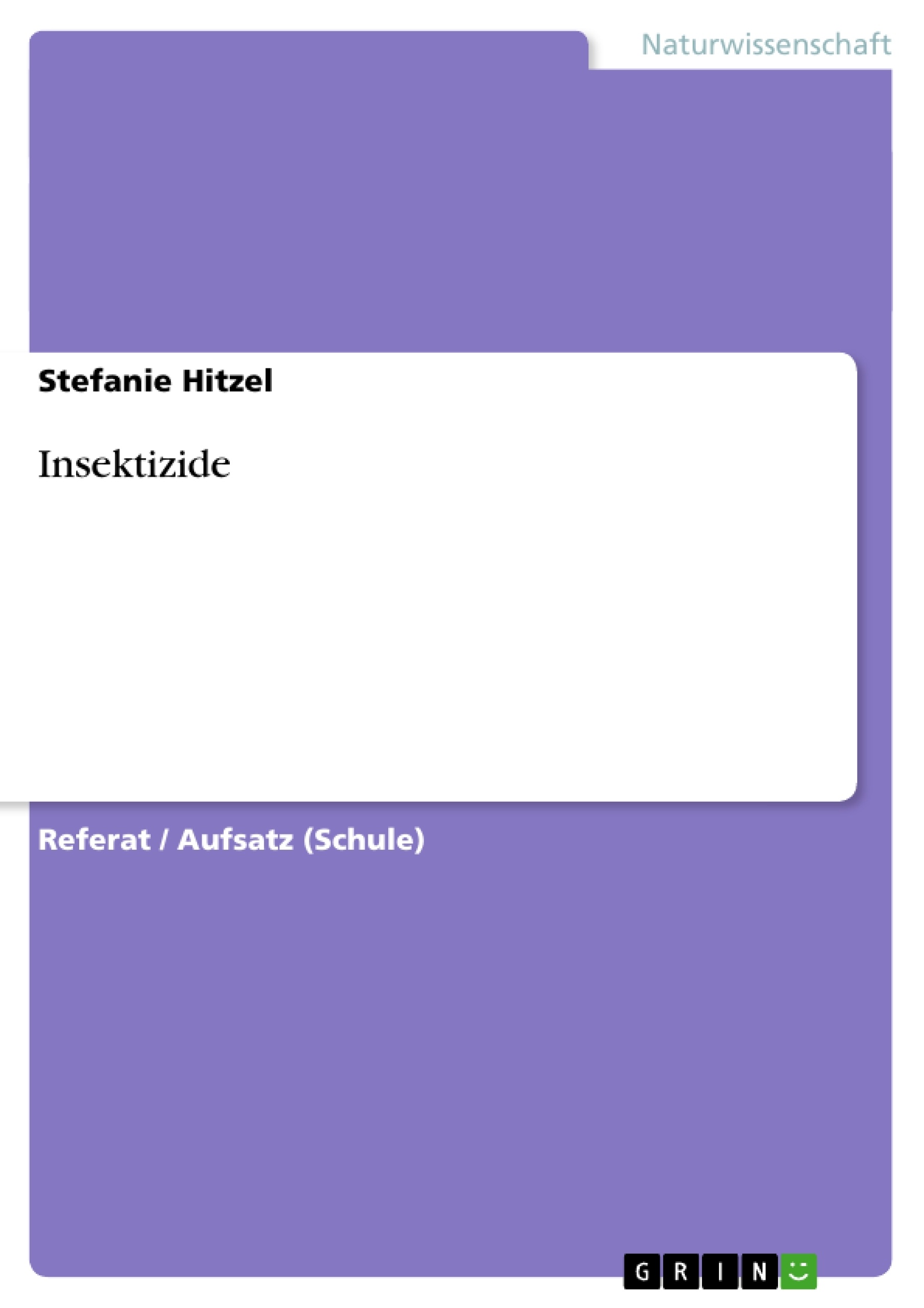Inhaltsverzeichnis:
I Einleitung
- Anforderungen an Pflanzenschutzmittel
II Wirkungsweise
III Insektizide
1. Geschichte
2. Chlorierte cyclische Kohlenwasserstoffe
- Allgemeines, Wirkungsweise
- Beispiele, speziell DDT
3. Organische Phosphorverbindungen
- Allgemeines, Wirkungsweise
- Beispiele, speziell E 605
4. Carbamate
- Allgemeines, Wirkungsweise
- Beispiele
5. Pyrethroide
a) natürliche, Pyrethrum
b) künstliche Pyrethroide
- Allgemeines, Wirkungsweise
- Beispiele
6. weitere Insektizide
IV Nutzen versus Risiko
I Einleitung
Anforderungen
In den letzten Jahren und Jahrzehnten werden an moderne Pflanzenschutzmittel immer mehr Anforderungen gestellt:
Sie sollen immer besser und gezielter wirken, dabei mit möglichst wenig Wirkstoff
auskommen, weder den Anwender gefährden noch die Umwelt belasten, zwar die Schädlinge beseitigen, aber die Nützlinge schonen, und sie sollen sich möglichst rückstandslos abbauen, nachdem sie ihre Aufgabe erfüllt haben.
Ein effektives gutes Pflanzenschutzmittel zeichnet sich aus durch:
- hohe Aktivität gegenüber Schaderregern
- geringe Aktivität gegenüber der Kulturpflanze
- geringe Toxizität gegen Warmblütern
- spezifische Aktivität gegenüber Schädlingen
- wirtschaftliche Rentabilität
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
II Wirkungsweise
Wichtige Faktoren für die Wirkungsweise sind:
- Kontakt zwischen Wirkstoff und Schadorganismus
- Eindringen des Wirkstoffes in den Schadorganismus
- Transport des Wirkstoffes im Schadorganismus
- Metabolismus des Wirkstoffes im Schadorganismus
- Angriff auf den Wirkort im Schadorganismus
- Konsequenz des Angriffes auf den Wirkort
III Insektizide
Insektizide sind die wichigste Gruppe der Pestizide. Darunter versteht man chemische Mittel zur Bekämpfung schädlicher Organismen, die die Nahrung des Menschen - direkt oder indirekt - sowie andere Lebensgüter angreifen oder Krankheiten durch Übertragung von Mikroben (Vektoren) oder durch Biß und Stich verursachen. Neben Insektiziden unterscheidet man je nach bekämpfter Schädlingsart: Rodentizide, Akarizide, Nematozide, Molluskizide, Fungizide, Herbizide. In manchen Gebieten werden mehr als 80% der Erntegüter durch fressende Insekten und/oder Nager (vor allem Ratten) vernichtet. Erkrankungen und Todesfälle durch Insekten als Vektoren, vor allem die Malaria, stehen noch immer an der Spitze aller Krankheitsursachen auf der Erde. Pestizide werden daher zur Sicherung der Ernährung einer ständig wachsenden Erdbevölkerung und zur Verhütung von Krankheiten als unentbehrlich angesehen
1.Geschichte
In den sechziger Jahren entwickelten Chemiker verschiedene Wirkstoffe, um gegen die übermäßige Ausbreitung von Schadinsekten vorzugehen. Vor allem Phosphorsäureester wie E 605, Malathion, Trichlorfon und Chlorkohlenwasserstoffe wie Lindan gehörten in der Landwirtschaft bald zu den häufigsten eingesetzten Insektiziden.
In den siebziger Jahren, als es galt, die landwirtschaftliche Produktion möglichst schnell zu erhöhen, gehörten Chlorkohlenwasserstoffe zusammen mit den Phosphorsäureestern zu den weltweit meisteingesetzten Insektiziden.
Im Rahmen weiterer Laborexperimente stellten Forscher fest, daß einige Insektizide der ersten Generation in ihren Eigenschaften Nachteile aufwiesen. Bei der Erforschung neuer chemischer Klassen suchten verantwortungsvolle Hersteller nach wirksameren Substanzen, die ein noch günstigeres Nebenwirkungsspektrum aufwiesen. D.h. Substanzen, die noch selektiver gegen die Schädlinge eingesetzt werden konnten und gleichzeitig eine geringere Wirkung auf die sogenannten Nichtzielorganismen (Non-targets) aufwiesen.
Eine weitere Wirkstoffgruppe, die etwa zeitgleich mit den Phosphorsäureestern entwickelt wurde, sind Carbamate. In den vergangenen 30 Jahren ist diese Wirkstoffgruppe durch umfangreiche Laborstudien weiterentwickelt worden.
Unter den Insektiziden nehmen die chlorierten Verbindungen und Phosphorsäureester eine dominierende Stellung ein. Aber auch andere Wirkstoffgruppen wie Carbamate, organische Nitroverbindungen, anorganische Substanzen oder auch Insektizide pflanzlicher Herkunft (Pyrethrum-Derivate) sind in dieser Gruppe vertreten. Aus den Pyrethrumverbindungen sind inzwischen die auf chemischen Weg produzierten Pyrethroide hervorgegangen, die Gruppe mit den höchsten Zuwachszahlen.
Aus chemischer Sicht unterscheidet man mehrere Insektizidgruppen, die sich in ihrer Persistenz unterscheiden. Die Gesamtmenge der deutlich stärker persistenten chlorierten Kohlenwasserstoffe - sie werden heute noch verwendet - übersteigt diejenige der anderen Wirkstoffgruppen.
Chlorkohlen- > Harnstoff- > Carbamate > PhosphorsäureWasserstoffe derivate ester
2 - 5 Jahre 2 - 18 Monate 2 - 12 Wochen
2. Chlorierte cyclische Kohlenwasserstoffe
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Hauptvertreter ist das DDT. Es wurde1874 zum erstenmal synthetisiert. P. Müller erhielt 1939 den Nobelpreis für die Entdeckung der insektiziden Wirkung. DDT ist am Warmblüter vergleichsweise wenig toxisch. Aldrin und Dieldrin sind an der Ratte fünffach stärker wirksam, ebenso Endosulfan, das 1969 durch massive Verunreinigung im Rhein ausgedehntes Fischsterben verursachte. Hexachlorcyclohekan (HCH) tritt in 4 Isomeren auf; HCH ist als technisches Gemisches aller Formen in Gebrauch, während das (hochwirksame) _-Isomere als Lindan eingesetzt wird. Von diesen drei Grundtypen gibt es zahlreiche Abwandlungen. Methoxychlor ist ähnlich DDT jedoch ist die Warmblütertoxizität geringer, und es wird auch kaum im Fettgewebe gespeichert.
Alle chlororganischen Insektizide sind gut fett-, aber nur minimal wasserlöslich. Sie werden entweder als verstäubte Trockenpulver, als wäßrige Verdünnungen mit Emulgatoren oder in organischer Lösung als Spray angewendet. Gemeinsames Merkmal ist die hohe Resistenz gegenüber physikalischen und chemische Einflüssen.
Technische Produkte sind in der Regel mit relativ hohen Anteilen von Verunreinigungen belastet, die z.T. stärker toxisch als die Reinsubstanzen sind.
Wirkungsweise
Insektizide Organochlorverbindungen sind Nervengifte. Sie erzeugen an den Nervenmembranen in geringeren Konzentrationen Überregbarkeit, in höheren Lähmung. Eine Hypothese besagt, das Fremdstoffmolekül lagere sich so in die Lipidmembran ein, daß die für den Na+ -Einstrom vorgesehenen Öffnungen am Wiederschluß in der Repolarisierungsphase gehindert würden; die den aktiven Rücktransport bewerkstelligende Na+-Pumpe könne so nicht wirksam werden.
Eine Stütze findet diese Auffasung in Untersuchungen über Struktur-Wirkungs-Beziehungen mit DDT und analogen Verbindungen, wonach eine bestimmte räumliche Anordungen der Diphenylalkan-Gruppierung zur Wirksamkeit gegeben sein muß; im DDT selbst findet sie ihr Optimum.
Die Erregbarkeitssteigerung, die in allen nervalen Elementen gezeigt werden kann, erfaßt im intakten Organismus zuerst die motorischen Bahnen im Gehirn. Spinale Bahnen folgen erst bei hohen Konzentrationen. Doch können - von Spezies zu Spezies offenbar stark schwankend - auch sensorische Nerven frühzeitig beteiligt sein.
DDT
Das wohl bekannteste, in seinem Verhalten am besten untersuchte und das am weitesten verbreitete Insektizid. Es wurde ab 1945 sehr erfolgreich zur Bekämpfung von Malariamücken eingesetzt, was Millionen von Menschen vor Krankheit und Tod bewahrt hat. DDT und Verwandte werden nicht nur enteral, sondern auch dermal rasch und komplett resorbiert, sofern sie gelöst sind. Die hohe Giftigkeit für Kerbtiere ist nicht - wie lange Zeit angenommen - auf eine besondere gute Penetrierbarkeit von deren Chitincuticula zurückzuführen (,,Kontaktgift"); auch die Warmblüterhaut wird glatt überwunden. Resorbiertes DDTverteilt sich überwiedend in die Fettdepots, aus denen es nur sehr langsam mobilisiert wird. Die Eliminationscharakterisitik ist kompliziert und erklärt sich aus dem Metabolismus: aus DDT kann enzymatisch HCl abgespalten werden, einmal unter der Bildung des DDE´s , zum anderen reduktiv unter Bildung des Ethananalogen DDD, welches sich in mehreren Schritten relativ rasch zur entsprechenden Essigsäure DDA oxidativ dechloriert wird. Dieser Metabolit sowie phenolische Oxidationsprodukte sind leicht nierengängig. Im Fett wird neben DDT das schlecht abbaubare DDE gespeichert. Es kann aber auch reine Dechlorierung der HCl-Abspaltung vorausgehen; das gebildete DDMU ist dem Vinylchlorid vergleichbar und wird wie dieses in ein reaktives Epoxid umgewandelt, das für die an Mäusen beobachtete krebserzeugende Wirkungen von DDT verantwortlich sein können.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
¬ die Metaboliten schädigen hauptsächlich die Nervenendungen und das Zentralnervensystem und führt schließlich zum Tod der Insekten.
Aufgrund seiner Persistenz stiegen die DDT-Mengen in der Umwelt seit seinem Ersteinsatz ständig an. Darüber hinaus erhöht sich die DDT-Konzentration in manchen der exponierten Organismen bei jeder höheren trophischen Stufe der Nahrungskette. Kleine Organismen wie Plankton oder Wasserflöhe resorbieren DDT passiv oder über ein Ausfiltern von Nahrung aus Fluß- oder Seewasser. So gelangt es in ihr Körperfett. Die Konzentration in den Geweben dieser Organismen kann vielhundert- oder -tausendfach höher sein als in dem sie umgebenden Wasser. Wenn Insekten oder kleine Fische diese Lebewesen fressen, wird das DDT in ihrem Fettgewebe gespeichert. Dieser Vorgang wiederholt sich entlang der Nahrungskette, bis das fettlösliche DDT schließlich in das Fett von Fleischfressern oder Tieren an der Spitze der Nahrungskette gelangt - und dies kann der Mensch sein. In Tieren, die an der Spitze der Nahrungskette stehen, können folglich relativ hohe DDT-Konzentrationen gefunden werden, obwohl die Anfangskonzentration im Wasser gering war. Dies geschieht über einen fortgesetzten Anreicherungprozeß.
BILD
Beim Menschen befindet sich die größte Menge des DDT´s im Körperfett. Die Konzentration im Fett ist proportional zur Aufnahme und erreicht mit einer Halbswertzeit von etwa sechs Monaten ein Plateau. Das DDT wird über Lebensmittel tierischen Ursprungs und gespritztes oder sonstwie kontamiertes Gemüse und Obst aufgenommen.
Das DDT im Körperfett scheint für Tiere nicht schädlich zu sein, und es gibt kein Korrelation zwischen der Konzentration im Fettgewebe und Vergiftungserscheinungen. Die Plasmakonzentration und -noch wichtiger - die Konzenztration im Gehirn sind für toxische Effekte relevanter. Wird der Fettgehalt des Körpers reduziert, so steigt die Konzentration im Blut.
Inzwischen ist DDT ubiqitär: Sogar im Schnee der Antarktis wurde es gefunden.
3. Organische Phosphorsäureester
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1937 hat Schrader den ersten Phosphorsäureester mit insektiziden Eigenschaften synthetisiert. Phosphorsäureester haben wesentliche Vorteile gegenüber den cxhlorierten Kohlenwasserstoffen:
a) gute Wirksamkeit nicht nur gegenüber fressenden, sondern vor allem gegenüber saugenden Insekten und gegenüber Milben
b) einige Verbindungen dringen schnell durch die Wurzel in die Pflanze ein, verteilen sich schnell mit dem Transpirationsstrom und wirken so effektiv als Systeminsektizid
c) die Stoffe sind biologisch abbaubar und werden weder außerhalb noch innerhalb der Organismen gespeichert
d) ABER: diese Vorteile werden werden erkauft durch eine hohe Toxizität auch an Warmblütern
Es handelt sich um Ester der Phosphorsäure. Sie werden als Kontaktinsektizide und Systeminsektizide im Pflanzenschutz eingesetzt. Einige Verbindungen wurden aufgrund ihrer Toxizität und Flüchtigkeit als Kampfstoffe eingesetzt.
Wirkungsmechanismus:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Alkylphosphate lassen sich auf die folgende, alle Wirkungserfordernisse einschließende Grundstruktur zurückführen:
Der elektrophile Phosphorrest bietet sich in biologischen Systemen als nukleophile Reaktanten vor allem an Wasser und katalytische Zentren in Esterasen. Alkylphosphate sind starke Inhibatoren der Acetylcholinesterase.
BILD Seite 154
Bild 1:
- Acetylcholin bildet mit dem Enzym einen Komplex
- Der Acetylrest wird auf das Serin übertragen: Das Enzym wird acetyliert. Cholin diffundiert ab
- Die Essigsäure-Serin-Esterbindung wird sehr schnell hydrolysiert, mit einer Halbwertszeit von Mikrosekunden. Das freie Enzym wird dadurch regeneriert. Acetat diffundiert ab
Bild 2:
- Das Acetylphosphat bildet mit dem Enzym einen Komplex.
- Der Diisopropyl-phosphoryl-Rest wird auf das Serin übertragen: das Enzym wird phosphoryliert; der Rest diffundiert ab
- Die Phosphorsäure-Serin-Esterbindung wird extrem langsam hydrolysiert, mit einer Halbwertszeit von Tagen. Das Enzym wird extrem langsam regeneriert. Diisopropylphosphat diffundiert ab
- Im Laufe der Zeit spaltet sich aus den Dialkylphosphorsäure-Resten phosphorylierter Cholinesterasen eine Alkylgruppe ab. Die so entstehenden
Monoalkylphosphorsäureester sind so stabil, daß sie nicht reaktiviert werden.
Bei den meisten Phosphorsäureestern ist diese Enzymhemmung jedoch nicht direkt möglich, sie müssen im Organismus zunächst zur wirksamen Verbindung umgewandelt werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Parathion Paraoxon
Zahlreiche Befunde sprechen dafür, daß im Insekt der Eingriff in das Nervensystem in ähnlicher Weise wie beim Warmblüter erfolgt. Acetylcholinesterase wurde in vielen Insekten nachgewiesen und kann hier durch organische Phosphorverbindungen gehemmt werden. Andererseits liegt z.B. bei den Schaben kein cholinerisches System der Reizübertragen vor, trotzdem sind Phosphorsäureester auch hier insektizid wirksam.
Die Reaktionskette von der Hemmung der Cholinesterase durch organische Phosphate und der Anreicherung von Acetylcholin zur unmittelbaren Todesursache der Insekten ist jedoch noch weitgehenden unbekannt. Außer der motorischen Erregung und nachfolgenden Lähmung kommt es auch zu histologischen Veränderungen der Nervenzellen und Sinnesorgane. Zur letalen Wirkung tragen offenbar starke Störungen des Wasserhaushalts, Verlagerung der Leibeshöhlenflüssigkeit in den Verdauungstrakt und Abgabe von Hämolymphe durch die Mundöffnung bei.
Bei dem Insektizid Malathion kommt es im Warmblüter und Insektenorganismus zu verschieden Metabolisierungen, dadurch wirkt Malathion stark weniger toxisch
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4. Carbamate (Carbaminsäureester)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ester der Carbaminsäure, bei denen ein oder zwei Wasserstoffe am Aminostickstoff durch Alkyl substituiert sind, hemmen Acetylcholinesterase stark.
BILD ENZYMHEMMUNG
- Carbamat bildet mit dem Enzym einen Komplex
- Der Dimethylcarbaminsäurerest wird auf das Serin übertragen: Das Enzym wird carbamyliert. Rest diffundiert ab
- Die Carbaminsäure-Serin-Esterbindung wird mittelschnell hydrolysiert, mit einer Halbwertszeit von Minuten. Das freie Enzym wird dadurch regeneriert. Dimethylcarbamat diffundiert ab
Die Hemmung durch Carbamate nennt man daher auch reversibel, im Gegensatz zu der Hemmung durch Alkylphosphate
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Wirksamkeit der Carbamate gegenüber Insekten mit Resistenz gegen chlorierte Kohlenwasserstoffe und Organophosphate trug zu ihrer schnellen Einführung als Insektizid bei. Allerdings ist auch bei Carbamten inzwischen Resistenzentwicklung bekannt. Carbaryl ist mittlerweile in Deutschland verboten. Es wirkt gegen saugende Insekten, nicht aber gegen Spinnmilben und Blattläusen
Propoxur ist in erster Linie ein Kontakt- und Fraßgift mit einer besonders guten Wirkungsdauer. Der durch Propoxur erzielte Austreibungseffekt - "flushing-effect" - bewirkt, daß die Insekten nach einer gezielten Anwendung ihre Schlupfwinkel verlassen und sich somit selbst dem Insektizid aussetzen. Außerdem zeigt Propoxur eine gute Wirkung gegen chlorkohlenwasserstoff- und phosphorsäureesterresistente Insekten.
5. Pyrethroide
Die Wirkstoffklasse der Pyrethroide - der synthetische Nachbau des Pyrethrums
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wissenschaft und Forschung sehen den Vorteil synthetisch hergestellter Pyrethroide darin, daß sie eine selektive Wirkung gegen Insekten besitzen und ein günstiges toxikologisches Potential aufweisen. Aufgrund ihrer gezielten, hohen Wirksamkeit und Sicherheit werden Pyrethroide heute weltweit als Schädlingsbekämpfungsmittel in der Land-, Garten- und Forstwirtschaft aber auch im Haushalt, im Hygiene- und Veterinärbereich verwendet. Die WHO (World Health Organization) und FAO (Food And Agriculture Organization of the United Nations) messen dieser chemischen Klasse, im Rahmen von Vektorkontrolle (z. B. in tropischen Ländern), große Bedeutung bei.
Natürliche:
Der Name der Pyrethroide leitet sich von der Pflanzengattung Pyrethrum ab. In dieser Pflanzengattung und anderen findet man natürliche Insektizide: die Pyrethrine.
Pyrethrum wird aus den Blüten verschiedener Chrysanthenum-Arten gewonnen. Schon zu Beginn des 19. Jhrd war es bekannt
Die Pyrethrine wirken überwiegend als Kontaktgifte.
Synthetische Pyrethroide
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Für die Wirkung ist die substituierte vinylische Gruppe essentiell, sie kann sich bei den synthetischen Derivaten im aromatischen Ring verbergen. Die synthetischen Abkömmlinge sind nicht nur billiger, sondern um ein Vielfaches wirksamer und beständiger als die Naturstoffe. Die akute Toxizität an Warmblütern, gemessen als LD 50 an der Ratte, schwankt zwischen 100 und 5000mg/kg, ist also gering im Vergleich zu den Organophosphaten und vielen Organochlorininsektiziden, d.h. die Gefährdung des Menschen beim praktischen Umgang ist - bei hoher insektizider Wirksamkeit - gering. Dies hat den Pyrethroiden eine führende Position unter den Insektiziden verschafft.
Pyrethroide sind wie die Organochlorininsektizide Nervengifte. Sie verzögern an der Nervenmembran die Schließung des bei der Rerregungsübertragung geöffneten Natriumkanals und erzeugen so am motorischen Nerven eine Hyperpolarität. Sie manifestiert sich als Überregbarkeit nach sensorischen Reizen und mündet in Krampfzustände. Pyrethroide dringen nicht in die Pflanze ein und haben daher keine systemische Wirkung. Dies erfordert eine gute Verteilung auf den zu schützenden Pflanzen oder den direkten Kontakt mit dem Schädling. Da die insektizide Wirksamkeit schon bei außerordentlich geringen Dosierungen gegeben ist, ermöglicht dies eine sehr starke Herabsetzung der Aufwandsmengen beim praktischen Einsatz, dadurch wird auch die absolute Höhe der Rückstände auf dem Ernteprodukt gering, zumal die synthetischen Pyrethroide relativ gut auf der Pflanze oder im Boden abgebaut werden.
Die synthetischen Pyrethroide haben eine außerordentliche große Wirkungsbreite gegenüber Fliegen sowie beißenden und saugenden Insekten und teilweise auch Spinnmilben. Allerdings werden nützliche Insekten gleichfalls erfaßt, so daß in Kulturen, in denen auf Nützlingsschonung Wert gelegt wird, der Einsatz möglichst unterbleiben sollte.
6. Weitere Insektizidklassen
a) acylierte Harnstoffe Diflubenzuron
Greift in die Entwicklung der Insektenlarven ein in dem sie die Chitinsynthetase hemmen
b) Arsenverbindungen
Kupferarsenitacetat (Schweinfurter Grün) In der BRD verboten
c) Alkaloide
Pflanzliche Inhaltsstoffe z.B. Nicotin, Morphin
IV Nutzen versus Risiko
Pestizide können neben den erwünschten auch unerwünschte Eigenschaften haben:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Massenvergiftung durch Pestizide:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Versehentliche Vergiftungen von Menschen mit Pestiziden gibt es, seit diese Substanzen zum Einsatz kommen. In vielen Fällen waren versehentlich kontaminierte Nahrungsmittel oder die unsachgemäße Verwendung von Pestiziden die Ursache.
Für die Bevölkerung der Industriestaaten liegt die Hauptgefahr in einer möglichen Verseuchung der Nahrung und des Trinkwassers. Für die Bevölkerung der Dritte-Welt-Länder sind allerdings noch andere noch andere Gefährdungen von Bedeutung:
- orale Aufnahme durch Verwechslung von nicht gekennzeichneten Pestizidbehältern oder zweckentfremdeten Behältern, da keine ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen vorhanden sind
- dermale Vergiftungen, sind weniger Unglücksfälle, sondern eingeplantes Risiko bei den Anwendern der Pestizide. Schutzkleidung ist kaum verfügbar bzw. in dem Klima kaum zumutbar, Unkenntnis über Umgang, Gefährlichkeit der Spritzgeräte und Pestizide, weit verbreitetes Analphabetentum
Die Argumentation der Pestizidhersteller, daß bei ordnungsgemäßem Umgang mit Pestiziden praktisch keine Gefahr für den Menschen zu erwarten ist, mag zwar zutreffen, ist aber angesichts der derzeitigen Situation in den Ländern der dritten Welt realitätsfremd. Auch in den Industriestaaten vergiften sich mangels Information bzw. Aufklärung Menschen, da die Empfehlungen der Pestizidhersteller nicht immer mit der nötigen Sorgfalt beachtet werden. Oftmals kommt es zur falschen Wahl des einzusetzenden Mittels, zu falschen Dosierungen, zur Anwendung zum falschen Zeitpunkt bis hin zum Wegschütten des restlichen, nicht verbrauchten Pestizids. Wegen der intensiv genutzten landwirtschaftlichen Fläche ist in den Industriestaaten der Pestizideinsatz pro Hektar besonders hoch und damit die Gefahr einer Belastung von Böden und Gewässern mit Pestiziden. Dazu kommtder ökonomische Druck, die Ernteerträge ständig steigern zu müssen, um bei den niedrigen Preisen, zu denen die Landwirte ihre Produkte verkaufen müssen, in ihrem Einkommen mit der allgemeinen Steigerung der Lebenshaltungskosten Schritt halten zu können. Probleme der Schädlingsresistenz zwingen oftmals dazu, mehr und stärker wirksame Pestizide einzusetzen. Eine Folge davon sind Nahrungsmittelbelastungen. Vor allem Vegetarier, kranke Menschen und Kinder können unverhältnismäßig stark belastet werden.
Auch in importierten Nahrungsmitteln sind Pestizide enthalten, von denen einige bei uns schon lange nicht mehr zugelassen sind.
Eine weitere Folge ist, daß häufig Nutztiere getötet werden. Dadurch werden die ökologischen Verhältnisse landwirtschaftlich genutzter Flächen nachhaltig gestört. 38% des Artenrückgangs in der BRD wird der Landwirtschaft zugeschrieben.
Eine weitere und viel schwerwiegende Folge des Einsatztes von Pestiziden ist die Belastung des Bodens und des Grundwassers.
Literatur:
Rudolf Heitefuß
Pflanzenschutz
Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1987
Pflanzenschutznachrichten Bayer
Wirkstoffe in Pflanzenschutz- & Schädlingsbekämpfungsmittel Industrieverband Pflanzenschutz e.V.
Forth et al
Pharmakologie und Toxikologie
Spektrum Verlag, Heidelberg, 1996
Birgersson, Sterner, Zimerson
Chemie und Gesundheit
VCH Verlag, Weinheim, 1988
J.A.Timbrell
Toxikologie
Spektrum Verlag, Heidelberg, 1993
Claus Bliefert
Umweltchemie
VCH Verlag, Weinheim, 1997
A.Heintz, G. Reinhard
Chemie und Umwelt
Vieweg Verlag, Braunschweig, 1996
Internet.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Anforderungen an moderne Pflanzenschutzmittel?
Moderne Pflanzenschutzmittel sollen gezielter und mit weniger Wirkstoff wirken, weder Anwender noch Umwelt belasten, Schädlinge beseitigen, Nützlinge schonen und sich rückstandslos abbauen.
Welche Faktoren sind für die Wirkungsweise von Pflanzenschutzmitteln wichtig?
Wichtige Faktoren sind Kontakt, Eindringen, Transport, Metabolismus und Angriff des Wirkstoffes im Schadorganismus sowie die Konsequenz des Angriffs auf den Wirkort.
Was sind Insektizide?
Insektizide sind chemische Mittel zur Bekämpfung schädlicher Organismen, die die Nahrung des Menschen oder andere Lebensgüter angreifen oder Krankheiten verursachen.
Welche Insektizidgruppen gibt es?
Zu den Insektizidgruppen gehören chlorierte cyclische Kohlenwasserstoffe (z.B. DDT, Lindan), organische Phosphorverbindungen (z.B. E 605), Carbamate, Pyrethroide (natürliche und künstliche) und weitere.
Wie wirken chlorierte cyclische Kohlenwasserstoffe?
Sie sind Nervengifte, die an den Nervenmembranen in geringeren Konzentrationen Überregbarkeit, in höheren Lähmung erzeugen.
Was ist DDT und welche Probleme sind mit seiner Verwendung verbunden?
DDT ist ein bekanntes Insektizid, das erfolgreich zur Bekämpfung von Malariamücken eingesetzt wurde. Aufgrund seiner Persistenz reichert es sich in der Umwelt und in der Nahrungskette an.
Wie wirken organische Phosphorsäureester?
Sie hemmen die Acetylcholinesterase und sind biologisch abbaubar, aber oft auch toxisch für Warmblüter.
Was sind Carbamate und wie wirken sie?
Carbamate sind Ester der Carbaminsäure, die Acetylcholinesterase hemmen. Die Hemmung ist reversibel.
Was sind Pyrethroide?
Pyrethroide sind synthetische Nachbauten des Pyrethrums mit selektiver Wirkung gegen Insekten und geringer Toxizität.
Welche unerwünschten Eigenschaften können Pestizide haben?
Pestizide können Massenvergiftungen verursachen, Nahrungsmittel und Trinkwasser verseuchen, Nutztiere töten und Böden sowie Grundwasser belasten.
Welche Gefahren bestehen bei der Verwendung von Pestiziden in Entwicklungsländern?
Es bestehen Gefahren durch orale Aufnahme, dermale Vergiftungen und mangelnde Sicherheitsvorkehrungen.
Wie können die Risiken des Pestizideinsatzes minimiert werden?
Durch ordnungsgemäßen Umgang, Information, Aufklärung und die Wahl geeigneter Mittel und Dosierungen.
Was sind die Auswirkungen des Pestizideinsatzes auf die Umwelt?
Der Pestizideinsatz kann zu Artenrückgang, Belastung von Böden und Grundwasser sowie zu Nahrungsmittelbelastungen führen.
- Quote paper
- Stefanie Hitzel (Author), 2000, Geschichte und Arten von Insektiziden. Nutzen versus Risiko, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98064