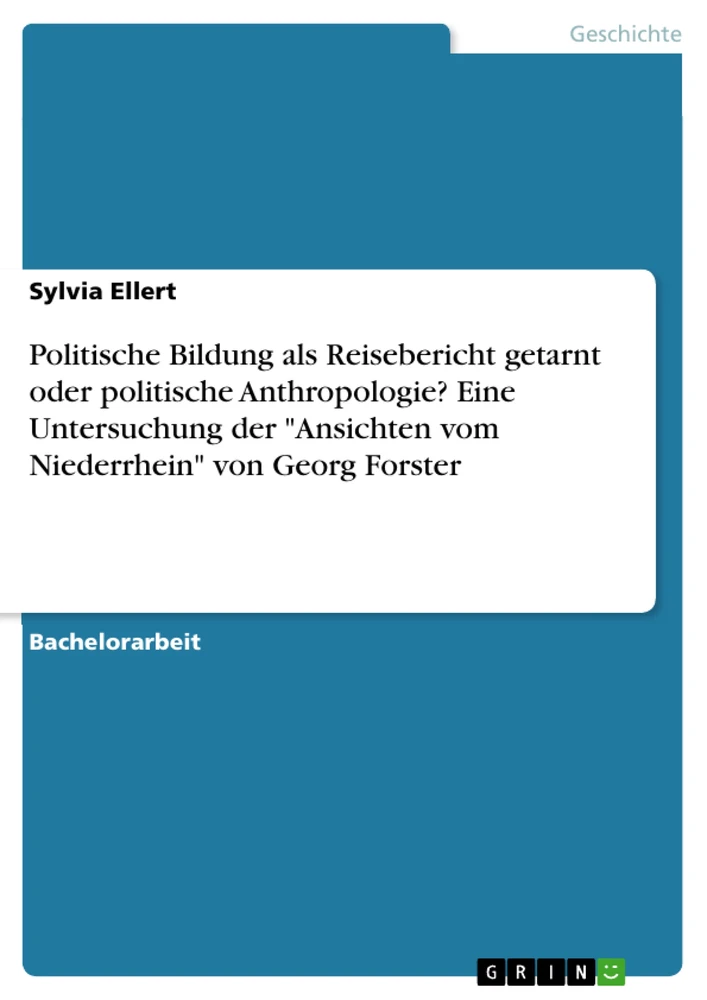In dieser Arbeit soll herausgearbeitet werden, ob Georg Forster mit Hilfe einer als unterhaltsamen Reisebericht getarnten politischen Bildungsschrift bei seinen Lesern ein Bewusstsein für die herrschende politische Situation und für bestehende Missstände in Deutschland schaffen wollte.
Kann darüber hinaus sichtbar gemacht werden, ob Forster gegebenenfalls diese Vorgehensweise wählte, um seine Leser zu mündigen und aktiven Staatsbürgern zu bilden sowie sie zu befähigen und zu motivieren, mögliche Handlungsoptionen für Veränderungen eigenständig zu entwickeln? Oder spiegelte sich lediglich Forsters Verständnis von Anthropologie in seinem Werk „Ansichten vom Niederrhein“ wider? Georg Forster war zum Zeitpunkt des Erscheinens der ersten beiden Bände seines Werkes „Ansichten vom Niederrhein von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich im April, Mai und Junius 1790“ längst als Wissenschaftler und Reiseliterat bekannt.
Bereits sein erstes Werk „Reise um die Welt“ hob sich von der zeitgenössischen Reiseliteratur ab. Der Autor formulierte mit der ihm größtmöglichen Unvoreingenommenheit wissenschaftlich genaue, sachlich fundierte und einfühlende Beobachtungen so objektiv wie möglich, aber dennoch in einer, seine breite Leserschaft ansprechender Prosa. Seine Beschreibungen von Landstrichen, Flora, Fauna und Klima unterbrach er dabei regelmäßig, um das Aufgenommene zu reflektieren. Insbesondere seine völkerkundlichen, ethnographischen Beobachtungen und seine darauf bezogenen Reflexionen fanden großes Interesse. An spezifischen Untersuchungen zu Forsters Wirkungsintention sein Werk betreffend und gerade vor dem Hintergrund seiner eigenen wissenschaftlichen Prägung sowie dem des gesellschaftlichen Wandels in revolutionärer Zeit mangelt es jedoch.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Reiseintentionen und Reisebeschreibungen im 18. Jahrhundert
- Reiseintentionen im 18. Jahrhundert
- Reisebeschreibungen im 18. Jahrhundert
- Der Mensch als Desiderat
- Biografische Vorstellung Georg Forsters
- Wissenschaftliche Bildung
- Die Weltumseglung (1772 – 1775)
- Der Reisebericht ,,Reise um die Welt“
- Forsters Netzwerke – Anstellungsverhältnisse und Freimaurerei
- Reisebeschreibung „Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich, im April, Mai, Junius 1790“
- Forsters Reiseintention
- Reisebericht,,Ansichten vom Niederrhein“
- Briefe, 1790 1791
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Georg Forsters Reisebericht „Ansichten vom Niederrhein“ und analysiert, ob er darin politische Bildung in Form eines unterhaltsamen Reiseberichts vermittelt. Das Ziel ist es, zu ergründen, ob Forster seine Leser durch diese Vorgehensweise zu mündigen und aktiven Staatsbürgern aufrufen wollte, die in der Lage sind, selbstständig Handlungsoptionen für gesellschaftliche Veränderungen zu entwickeln. Darüber hinaus wird die Frage gestellt, ob Forsters Werk lediglich seine anthropologische Sichtweise widerspiegelt.
- Reisebeschreibungen und ihre Funktion im 18. Jahrhundert
- Forsters Reiseintentionen und seine politische Haltung
- Politische Bildung in Forsters Reisebericht
- Die Rolle der Anthropologie in Forsters Werk
- Die Bedeutung von Forsters „Ansichten vom Niederrhein“ für die deutsche Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt Georg Forster als bekannten Wissenschaftler und Reiseliterat vor und führt den Kontext seiner Reisebeschreibungen im 18. Jahrhundert ein. Sie hebt Forsters wissenschaftliche und ethnographische Vorgehensweise hervor und skizziert die Forschungslandschaft zu „Ansichten vom Niederrhein“ sowie die Forschungslücke, die diese Arbeit füllt.
- Reiseintentionen und Reisebeschreibungen im 18. Jahrhundert: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung der Reisemotive und die literarische/wissenschaftliche Aufbereitung von Reiseberichten im 18. Jahrhundert. Es beleuchtet die Rolle der Aufklärung und deren Einfluss auf die Entstehung von Reiseberichten als wissenschaftliche und literarische Genres.
- Der Mensch als Desiderat: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Anthropologie in der Forschung und untersucht verschiedene Definitionen des Begriffs. Es kritisiert die einseitige Fokussierung auf Ernst Platners Anthropologie-Begriff und betont die interdisziplinäre Denkweise von Wissenschaftlern im 18. Jahrhundert.
- Biografische Vorstellung Georg Forsters: Dieses Kapitel bietet eine biographische Darstellung Georg Forsters, die seine wissenschaftliche Bildung, die Weltumseglung und seine Reiseberichte beleuchtet. Es zeigt seine empirische Erfahrung als Naturwissenschaftler, Ethnologe, Anthropologe, Übersetzer und Reiseliterat auf.
- Reisebeschreibung „Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich, im April, Mai, Junius 1790“: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Forsters Reisebericht „Ansichten vom Niederrhein“, analysiert seine Reiseintention, untersucht die Struktur und den Inhalt des Reiseberichts und beleuchtet den Aspekt der politischen Bildung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Reisebericht, politische Bildung, Anthropologie, Georg Forster, 18. Jahrhundert, Aufklärung, Deutschland, Staatsbürgerschaft, Missstände, Handlungsoptionen, "Ansichten vom Niederrhein", "Reise um die Welt".
- Arbeit zitieren
- Sylvia Ellert (Autor:in), 2018, Politische Bildung als Reisebericht getarnt oder politische Anthropologie? Eine Untersuchung der "Ansichten vom Niederrhein" von Georg Forster, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/980879