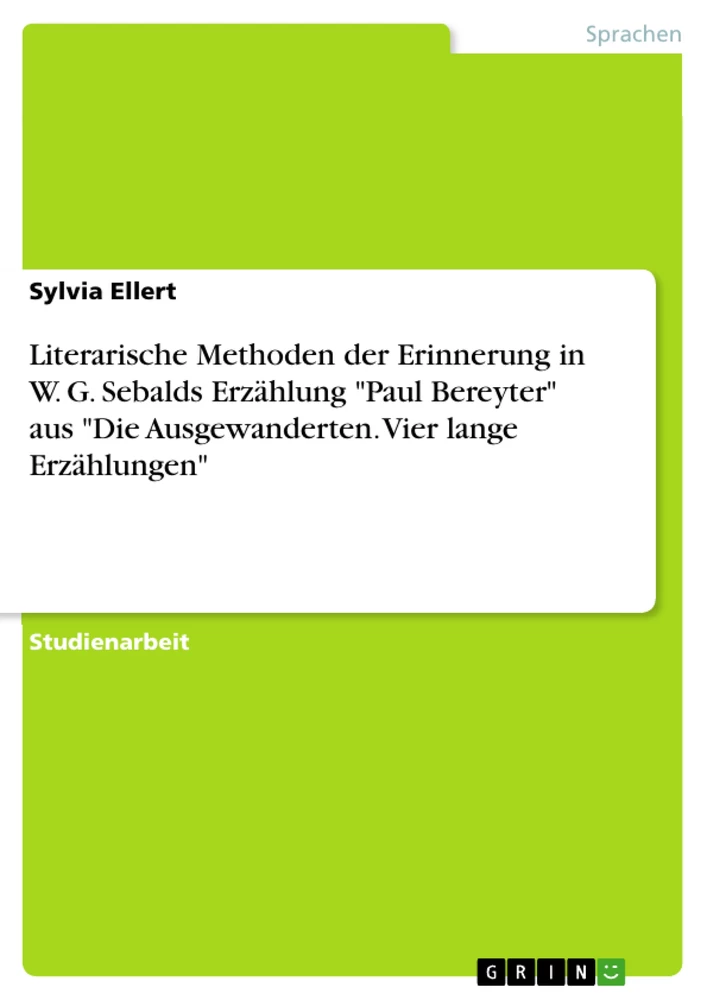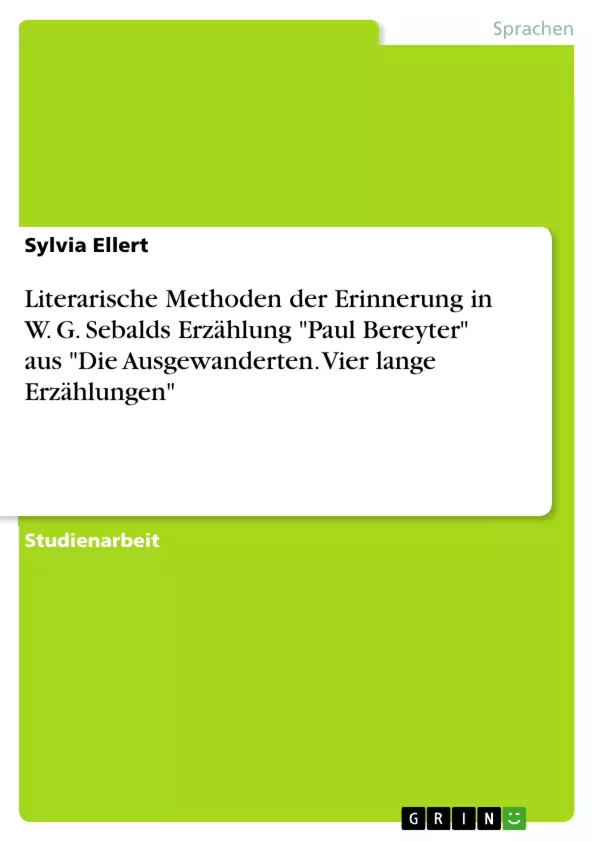Die Grundebene dieser Arbeit bildet die Frage, wie Sebald die Erinnerung in seinen Werken konstituierte. Welche literarischen Methoden der Erinnerung, welche Strategien nutzte Sebald und welche Wirkung wollte, beziehungsweise hat er jeweils mit seiner Auswahl spezifischer Mittel hervorgerufen? Um sich einer Beantwortung dieser Fragen annähern zu können, wird im Folgenden ein Kapitel aus Sebalds Werk „Die Ausgewanderten. Vier lange Erzählungen“ exemplarisch untersucht werden. In einem ersten Schritt wird der Autor selbst vorgestellt sowie sein 1992 veröffentlichtes Werk kurz umrissen werden. Zur Analyse wird lediglich die darin enthaltene Erzählung „Paul Bereyter“ herangezogen. Ihr Inhalt wird daher vorbereitend zusammengefasst dargestellt werden. Anschließend, im Kernkapitel dieser Arbeit, wird der Primärtext zunächst bezüglich der vom Autor gewählten Erzählperspektive analysiert. Es folgt eine Untersuchung des Sprachstils sowie der zur sprachlichen Gestaltung verwendeten Mittel. Im Weiteren wird die Verwendung von Fotografien und Bildern durchleuchtet, wozu exemplarisch zwei der in der Erzählung abgedruckten Abbildungen klassifiziert und hinsichtlich ihrer Qualität, des Dargestellten und ihres Montageortes betrachtet werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Autor W. G. Sebald
- Kurze Vorstellung des Werks „Die Ausgewanderten. Vier lange Erzählungen“
- Kurze Vorstellung der Erzählung „Paul Bereyter“
- Analyse des Primärtextes „Paul Bereyter“
- Zur Erzählperspektive
- Zum Sprachstil
- Zur Verwendung von Fotografien und Bildern
- Schienen oder der letzte Blick?
- Tafelbild oder Sinnbild eines Plans?
- Zur Transtextualität
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, wie W. G. Sebald in seinen Werken Erinnerung konstituierte. Sie analysiert die literarischen Methoden und Strategien, die Sebald zur Darstellung von Erinnerung nutzte, und die damit verbundenen Effekte. Im Fokus steht die Erzählung „Paul Bereyter“ aus „Die Ausgewanderten. Vier lange Erzählungen“, die exemplarisch untersucht wird.
- Die Verwendung von literarischen Methoden zur Darstellung von Erinnerung
- Die Rolle der Erinnerung und des kollektiven Gedächtnisses im Werk von W. G. Sebald
- Die Verbindung von Fakt und Fiktion in Sebalds Prosa
- Die Gestaltung von Sprachstil und Erzählperspektive in „Paul Bereyter“
- Die Bedeutung von Fotografien und Bildern in der Erzählung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz von Vergangenheitsaufarbeitung für Individuen und Gesellschaften dar und führt in die Thematik der Erinnerungskultur ein. Es wird die Bedeutung von literarischen Werken als Medium des kulturellen Gedächtnisses hervorgehoben. Der Fokus liegt dabei auf der Rezeption der Shoa in Deutschland und den Herausforderungen, die sich im Umgang mit dem kommunikativen Gedächtnis ergeben.
Kapitel 2 stellt den Autor W. G. Sebald vor, beleuchtet seine zentralen Themen und seinen literarischen Stil. Es wird auf die Bedeutung von Erinnerung und Gedächtnis in seinen Werken hingewiesen und die besondere Rolle der Melancholie in seiner Prosa hervorgehoben. Der Abschnitt bietet eine kurze Vorstellung des Werks „Die Ausgewanderten. Vier lange Erzählungen“ und der Erzählung „Paul Bereyter“.
Kapitel 3 analysiert die Erzählung „Paul Bereyter“ im Hinblick auf Erzählperspektive, Sprachstil, Verwendung von Fotografien und Bildern sowie Transtextualität. Es werden die in der Erzählung eingesetzten literarischen Mittel und ihre Funktion bei der Darstellung von Erinnerung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Erinnerungskultur, literarische Methoden der Erinnerung, W. G. Sebald, „Die Ausgewanderten. Vier lange Erzählungen“, „Paul Bereyter“, Erzählperspektive, Sprachstil, Fotografien, Bilder, Transtextualität.
- Arbeit zitieren
- B. A. Sylvia Ellert (Autor:in), 2017, Literarische Methoden der Erinnerung in W. G. Sebalds Erzählung "Paul Bereyter" aus "Die Ausgewanderten. Vier lange Erzählungen", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/980882