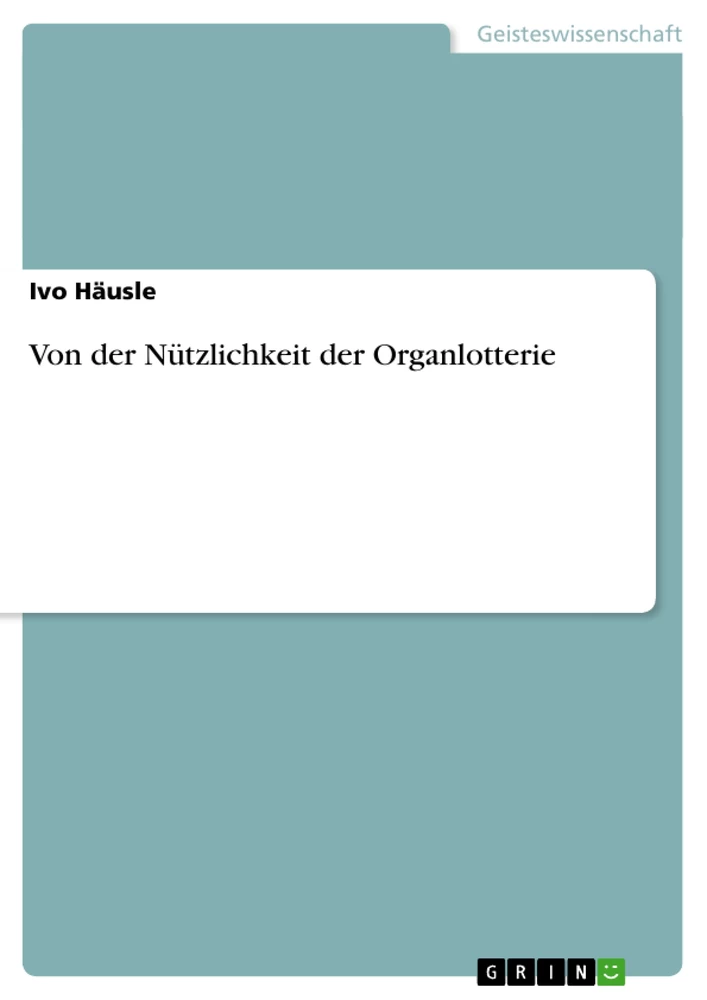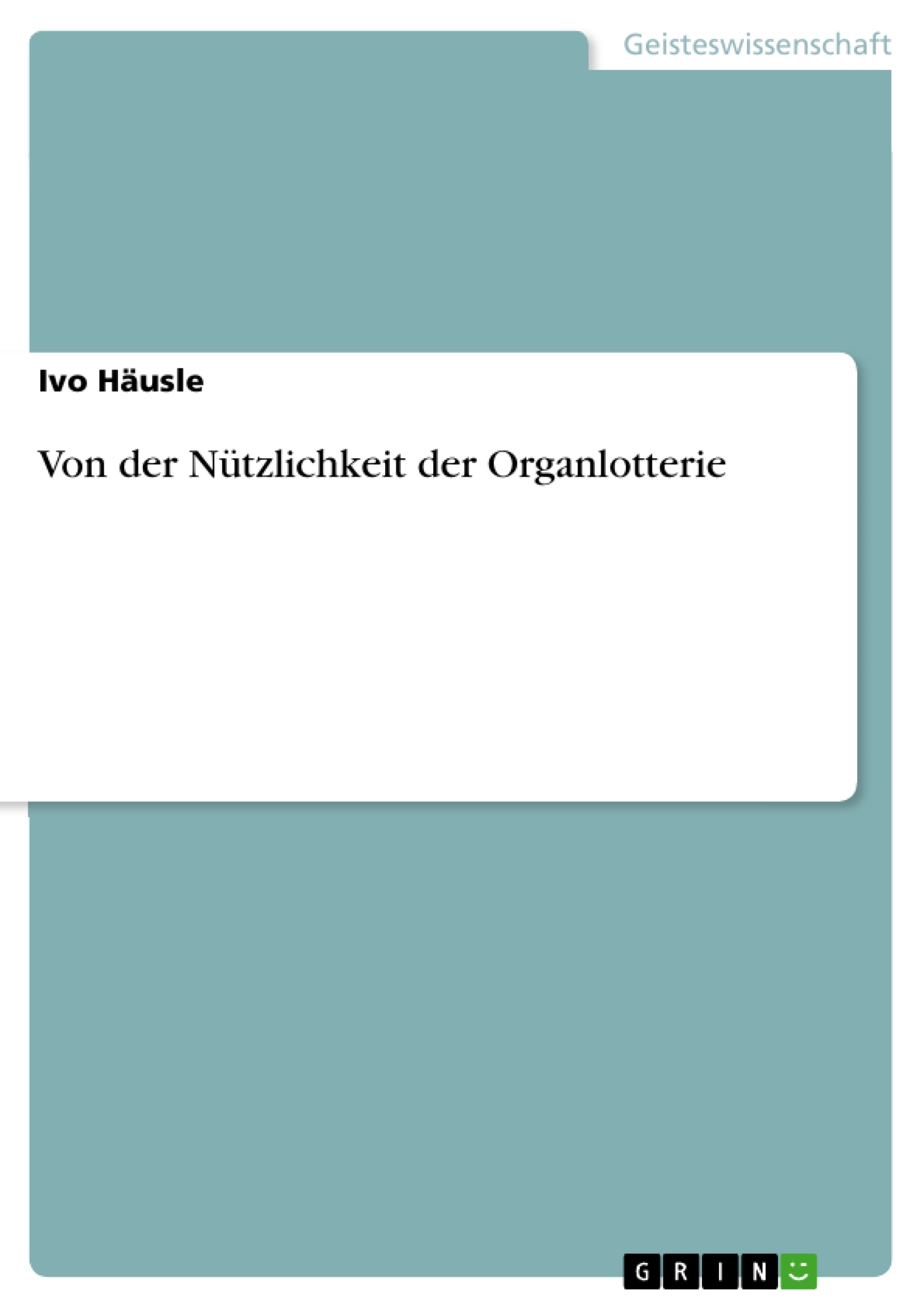Stellen Sie sich eine Welt vor, in der das Leben selbst zur Ware wird, gehandelt und verteilt durch das unberechenbare Schicksal einer Lotterie. Was wäre, wenn wir durch eine staatlich geförderte Organlotterie, die Leben rettet, indem sie andere opfert, dem Organmangel begegnen könnten? Diese provokante ethische Überlegung, angestoßen durch die Werke von Peter Singer und John Harris, entfacht eine Debatte über Utilitarismus, individuelle Rechte und die moralischen Grenzen des menschlichen Handelns. Der Leser wird auf eine gedankliche Reise mitgenommen, die die tiefgreifenden Konsequenzen einer solchen radikalen Lösung erforscht. Von der anfänglichen rationalen Rechtfertigung, Leben durch Organverpflanzung zu retten, bis hin zur erschreckenden Vision einer totalen Überwachung, die notwendig wäre, um Fairness zu gewährleisten, werden die Argumente für und wider dieses kontroverse Konzept aufgedeckt. Welche Auswirkungen hätte eine solche Lotterie auf unsere Gesellschaft, auf unsere persönliche Freiheit und auf unser Verständnis von Leben und Tod? Wäre der vermeintliche Gewinn an geretteten Leben den Verlust der Individualität und die Preisgabe ethischer Grundsätze wert? Der Text analysiert die komplexe Verschränkung von Moral, Medizin und gesellschaftlicher Verantwortung, indem er nicht nur die utilitaristischen Vorteile einer solchen Lotterie untersucht, sondern auch die damit verbundenen Risiken des Missbrauchs, der Manipulation und der unerträglichen Einschränkung der persönlichen Lebensgestaltung beleuchtet. Die Argumente von Singer, Harris und Birnbacher werden kritisch gegenübergestellt, um die ethischen Fallstricke und die praktischen Schwierigkeiten einer Organlotterie aufzuzeigen. Der Leser wird dazu angeregt, seine eigenen Überzeugungen über den Wert des Lebens, die Grenzen der Gerechtigkeit und die Verantwortung des Einzelnen gegenüber der Gesellschaft zu hinterfragen. Tauchen Sie ein in eine Welt ethischer Dilemmata, in der die Grenzen zwischen Leben und Tod, Opfer und Rettung verschwimmen und die Frage aufgeworfen wird, ob der Zweck wirklich alle Mittel heiligt. Eine Auseinandersetzung mit diesem Thema ist eine unverzichtbare Übung in angewandter Ethik, die uns dazu auffordert, über die Grundlagen unserer moralischen Überzeugungen nachzudenken und die Konsequenzen unserer Handlungen in einer komplexen und interdependenten Welt zu erkennen. Erforschen Sie die dunklen Ecken einer Idee, die uns zwingt, unsere tiefsten Werte zu hinterfragen und die wahren Kosten des Fortschritts zu bewerten.
Einleitung
Ich versuche mich in der nachfolgenden Bearbeitung mit dem Gedanken der Organlotterie auseinanderzusetzen. Als Grundlage dient der Text von Peter Singer aus dem Jahre 1977, ,,Utility and the Survival Lottery". Er ist die Antwort von Singer auf das Thema der ,,Organlotterie", welches John Harris mit seinem Gedankenaufbau in dem Text ,,The Survival Lotterie" 1975 ins Leben gerufen hat.
Im ersten Abschnitt setze ich mich mit dem Text von Singer auseinander und versuche seine Sicht der Sachlage darzustellen, dann ziehe ich Parallelen, bzw. ich stelle Gegensätze heraus, zu dem Text von Harris.
Zum Schluß möchte ich noch auf einen dritten Text von Birnbacher eingehen, welcher ebenfalls das Thema einer ,,Organlotterie" von Harris überdenkt und seine eigenen Schlüsse daraus zieht. Sein Text zu dieser Thematik stammt aus dem Werk Birnbacher, 1995 ,,Tun und Unterlassen", Reclam.
1.) Die Idee einer Organlotterie
Es wird die Theorie einer Organlotterie behandelt, bei der aus einer Gruppe von Teilnehmern eine Person ausgelost wird, um getötet zu werden. Der Zweck dieser Tötung ist, die Organe des Auserwählten, mehreren anderen todkranken Personen zu verpflanzen, die ebenfalls an der Lotterie teilnehmen. Auf diese Weise können mehrere Menschenleben für das Opfer eines Einzelnen gerettet werden. Singer geht davon aus, mit einem Spender vier bis fünf andere sterbenskranke Menschen retten zu können. Wir haben es hier also mit einer ,,minimizing violation theory" zu tun. Dabei muß man allerdings von einem perfekten Stand der Transplantationstechnik ausgehen:
,,Since assuming the perfection of transplant technologie, the parts of `one donor` (if that is the right word) could save the lives of four to five others, the proposal appears to be a rational one."
Nach den normalen moralischen Werten und aufgrund der Heiligkeit jeden menschlichen Lebens wirft diese Art des Ansatzes allerdings sehr große Kritik und Empörung auf. Es muß verwerflich sein, das Leben eines völlig gesunden Menschen gegen seine natürliche Lebenserwartung auf so gezielte Art und Weise zu beenden, bewußt eine Tötung in Kauf zu nehmen. Diese Argumente hebeln sich jedoch in dem
Moment von selbst aus, in dem wir von der Heiligkeit und dem unschätzbaren Wert eines jeden Menschenlebens ausgehen. Dann muß man nämlich zugestehen, daß eine Handlung, deren Ziel es ist, eine größere Anzahl von Leben zu retten, eigentlich für ethisch motivierten Menschen wünschenswert sein müßte. Es wird nicht nach moralischen Gesichtspunkten gefragt.
Gefragt ist lediglich nach den Gründen für die Teilnahme oder Nichtteilnahme unter dem Gesichtspunkt individueller prudentieller Rationalität."
Man kann nicht von ,,Unfairness" oder Willkür sprechen, da man ganz gezielt die Todesrate um den Faktor vier verringert. Man kann also davon ausgehen, daß es sich hier um einen utilitaristischen Lösungsansatz des Organmangels handelt. Das ist das Prinzip der größeren Zahl als Chancenmaximierung für den Utilitaristen. Es ist allerdings sehr fragwürdig, inwiefern sich dieser utilitaristische Vorteil auch als solcher behaupten kann, wie später noch im einzelnen erklärt wird.
Zuerst sollte man sich auf eine freiwillige Beteiligung bei der Lotterie einigen, um einen Großteil der Gegenargumente von vornherein auszuschließen. Das würde dann bedeuten, daß sowohl Risiko, als auch die Wohltat der Rettung durch eine Transplantation nur die Freiwilligen trifft. Das bedeutet wiederum, daß man nun keine individuellen Rechte mehr verletzt, da die Auserwählten ja von vornherein mit ihrem Risiko einverstanden waren. Hier können allerdings Zweifel aufkommen, inwiefern man jederzeit für irgendwann getroffene Entscheidungen in unserer Gesellschaft zur Rechenschaft gezogen werden kann. Diese sollen nun jedoch bei Seite gelassen werden, da es sich um eine konstruierte Situation handelt, in der man der Einfachheit halber komplexe ,,Umfeldkriterien" unbeachtet lassen muß, um sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können.
Man hat also in einem solchen Fall für die Gemeinschaft wesentlich weniger Verluste zu beklagen. Wenn man die Ursache des Todeseintrittes der Äpuivalenzthese entsprechend (aktives Sterbenlassen der Kranken mit dem Töten eines Gesunden und somit aktivem Eingreifen) untereinander gleichsetzt, ist der Entwurf unter dem Strich dem ersten Anschein nach empfehlenswert.
Dann fangen die ernsten Probleme an, welche die Theorie von Harris nicht genügend bedacht hat.
2.) Die möglichen Folgen der Lotterie
Die Teilnehmer der Lotterie sind nun abgesichert. Wenn man ein krankes Organ hat, welches das eigene Leben terminiert, braucht man keine Angst mehr zu haben, vergeblich auf Hilfe zu warten. Es ist durch die Lotterie gesichert, daß ein gesunder Ersatz sofort zur Stelle ist. Außerdem sinkt mit der Anzahl der geschädigten Organe im eigenen Körper, das Risiko, daß man für als Spender ausgewählt wird, da dieser ja möglichst viele gesunde Organe haben muß, um den größten Nutzen abzuwerfen. Das bedeutet, daß sich das Leben eines Teilnehmers nicht mehr durch ungesunden Lebenswandel verkürzen kann, da es ihm jederzeit möglich ist, das zu Schaden gekommene Organ auszutauschen. Betrachtet man jedoch die individuelle Situation des Einzelnen, so verringert sich mit einer gesunden Lebensführung die Lebenserwartung, da man davon ausgehen muß, daß ein gesunder Körper eher für eine Tötung als Spender in Frage kommt. Nur dieser ermöglicht es, eine große Anzahl von Leben zu retten. Das kann so weit gehen, daß bestimmte erkrankte Personen von der Lotterie ausgeschlossen werden müßten, da sie als Spender nicht mehr in Frage kommen. Allerdings kann jemandem genauso wenig die Rettung durch ein Transplantat verweigert werden (wenn das gegen die vorherige Absprache ist), wie ein zum spenden Auserwählter in diesem Moment sein vorheriges Einverständnis revidieren kann.
Auch Harris ist sich in seinem Entwurf dieses Dilemmas bewußt. Es ist sehr schwierig zu entscheiden, ob der Einzelne für sein Leiden verantwortlich ist. Nur wer keine Schuld an seiner Situation trägt, darf von der Organlotterie profitieren. Eine Grenzziehung ist bei dieser Schuldfrage kaum möglich. Dies ist auch die Ansicht von Singer:
,,But is such exclusion at all feasible? When we consider this proposal in detail, it rapidly becomes clear that is not."
Die Verurteilung eines Teilnehmers, ihn wegen ungesunden Lebenswandels auszuschließen, wird immer fragwürdiger, je mehr man ins Detail geht. Man müßte alle Aktivitäten eines Jeden zu jedem Zeitpunkt seines Lebens kennen, um auszuschließen, daß er sich irgendwann einmal durch Selbstverschulden die Ursache eines Organschadens zugezogen hat.
Jeder der einer, nach unserem heutigen medizinischen Wissensstand gesundheitsschädlichen Beschäftigung nachgeht, wie z.B. Rauchen, Alkoholkunsum, Kaffee trinken, sogar nur gespritzte Lebensmittel konsumiert oder Mangelernährung, erhöht das Risiko von Organschädigungen. Er müßte somit von der Lotterie ausgeschlossen werden. Nun gibt es Mediziner, die sagen, daß der Konsum von Fleisch das Risiko von Darmkrebs erhöht, andere behaupten das Gegenteil. So gibt es viele verschiedene Meinungen in der Medizin. Die Entscheidung fällt schwer, nach welchen Kriterien die Auswahl stattfinden soll ?!
Man kann den Gedanken auf den gesamten Lebenswandel ausweiten. Sämtliche Betätigungen vom Autofahren, der Berufswahl und sport-Aktivitäten müssen beachtet werden. Der Eine fährt nur Bus, der Andere Auto, der Eine arbeitet auf einer Ölplattform, der Andere im klimatisierten Büro, der Eine spielt Tischtennis und der Andere springt mit dem Fallschirm aus Flugzeugen.
3.) Völlige Kontrolle aller Lebensbereiche
Um die Chancen eines jeden Teilnehmers gleichzusetzen mit den anderen, bräuchte man : die totale Überwachung, daß ein jeder, in jeder Lebenssituation das Gleiche tut. Abgesehen davon, daß eine solche Durchführung rein technisch gar nicht möglich währe, würde sie die persönliche Individualität und Freiheit völlig zerstören. Eine Intimsphäre gäbe es dann nicht mehr, alles würde kontrolliert und vorgeschrieben. Das hat einen ganz einfachen Grund: Früher war jeder für sein eigenes Wohlbefinden verantwortlich, nun trägt er mit jeder aktiven und passiven Handlung seines Körpers die Verpflichtung für alle anderen Teilnehmer der Organlotterie, da man die eigenen Organe als Gegenleistung für die eigene Sicherheit eingebracht hat.
4.) Die Konsequenz
Die Folge ist, daß der eigene intime Aktionskreis, innerhalb dessen man mit einer Handlung nur sich selbst schaden konnte, nun nicht mehr existent ist; er hat sich aufgelöst. Es gibt jetzt nur noch den Aktionskreis sämtlicher Teilnehmer der Lotterie:
Vorherige Aktionskreise : eigener Aktionskreis
A
Person
A
Außerhalb vom eigenen Aktionskreis
Aktionskreis nach Beitritt :
Aktionskreis der Organlotterie
A A
Person A
Person A
Ehemaliger eigener Aktionskreis
Das bedeutet, was auch immer man macht, es hat Auswirkungen für jeden anderen Teilnehmer der Organlotterie! Um also Fehltritte oder Benachteiligungen anderer zu vermeiden, ist eine totale Überwachung des ,,Individuums" notwendig geworden. Aus all diesen Punkten ergibt sich die Schlußfolgerung, daß die ,,Survival Lottery" nicht auf utilitaristischer Basis gerechtfertigt werden kann. Denn die Individualität, auf der die gesamte menschliche Kultur aufgebaut ist, ja durch die erst die Evolution möglich war, ist nicht mehr gegeben, bzw. muß mit einem Überwachungsapparat gigantischen Ausmaßes unterdrückt werden.
Also kann man die Idee der Organlotterie ohne allzu große Opfer nicht verwirklichen. Aber das ist auch nicht das Anliegen dieses Konzeptes. Es geht vielmehr um das Aufzeigen der Irreleitung unserer moralischen Ansichten über das Töten und das Sterbenlassen.
,,(...), since his prime concern seems to be to show that there is something defectivein ourmoral views about killing and letting die; and with this, as I have already said, I agree."
5.) Risikoverteilung
Ein weiterer Grund ist die Aufteilung des Risikos auf mehrere Personen. Sobald sich zwei oder mehrere Personen das Risiko teilen, verkleinert sich der Anreiz des Einzelnen, den Verlust eines Organs zu vermeiden. Das läuft darauf hinaus, daß man am Ende einen größeren Schaden hat, als ohne Lotterie.
Singer zieht Parallelen zu anderen Systemen, die mit dem selben Phänomen zu kämpfen haben. Bei Versicherungen und bei sozialen Hilfssytemen ist dies der Fall.
Das Risiko wird auf mehrere verteilt und es muß ein Anreiz geschaffen werden, um die Vermeidungsbereitschaft zu erhöhen. Dies geschieht bei Versicherungen durch verschlechterte Konditionen im Schadensfall, das heißt, es werden bei einer häufigen, leichtsinnigen (bzw. selbstverschuldeten) Inanspruchnahme der Versicherung die Beiträge erhöht. Bei sozialen Systemen wird das Problem dadurch gelindert, daß man die Lebenshilfe auf eine Überlebenshilfe reduziert, so daß jeder, der ein bißchen ,,komfortabler" leben möchte, Bemühungen in Kauf nehmen muß, um seine Lebenssituation zu verbessern.
6.) Das Mißbrauchs Argument
Birnbacher erwähnt noch eine weitere Möglichkeit, weshalb ein solches System selbst von absolut rationalen Egoisten nicht als lohnend betrachtet wird. Der menschliche Faktor in der Opferentscheidung birgt ein großes Maß an möglichem Mißbrauch durch Dritte.
Das Ergebnis ist nun manipulierbar geworden, im Gegensatz zu der natürlichen Determination des Lebens. Auch spricht Birnbacher die Gewalt an, die bei der Lotterie notwendig wird, um die Vollstreckung des Urteils zu gewährleisten. Denn kaum jemand läßt sich gerne freiwillig ,,schlachten", ungeachtet vorheriger Absprachen. Ein Scharfrichter, der die auserwählten Personen exekutieren muß, hat durch die aktive Tötung des Opfers in unserem Verständnis eine schwerwiegendere Aufgabe, als der Arzt der ein natürliches Organversagen zuläßt.
Schlußbemerkung:
Die Überlebenslotterie überschreitet bei weitem jegliche Grenze der erträglichen Risikoverteilung. Hier hält man nicht nur wörtlich für Andere seinen Kopf hin, indem man höhere Beiträge bezahlt, wie bei einer Autoversicherung, sondern es kann einen wirklich den Kopf und den Rest des Körpers kosten, wenn sich jemand anderes auf seiner Absicherung ,,ausruht" (ungesunder Lebenswandel), somit als Spender wegfällt und sich die Chancen für einen selbst erhöhen, als Spender ausgewählt zu werden! Handeln bedarf verschiedenen Reglements (z.B. ,,Du sollst nicht töten - Du sollst nicht Sterbenlassen"/Das sind Nichtschädigungspflichten). Das bedeutet, es entsteht ein Koordinierungsbedürfniss bei der positiven Handlung. Hier könnte man die Äquivalenz These ins Wanken bringen, welche besagt, daß positives Handeln und Unterlassen gleichwertig sind. Denn für Unterlassen im positiven Sinne benötigen wir keine Reglements.
Die Differenzierung zwischen einer Basishandlung (der ersten aktiven Bewegung des Körpers zu einer Handlungskette, z.B. Finger drückt Knopf) und dem Unterlassen ist moralisch relevant.
Literaturliste:
Ich beziehe mich in meiner Arbeit hauptsächlich auf :
- Singer (1975), Peter, Utility and the survival lottery, in : Philosophie 52, S. 218-222
Als weiteres Textmaterial stand mir zu Verfügung:
- Harris (1975), John, The survival lottery, in : Steinbock/Nocross (1994), S. 257-265
Häufig gestellte Fragen
- Worum geht es in dem Text über die Organlotterie?
- Der Text setzt sich mit der Idee einer Organlotterie auseinander, bei der zufällig Personen ausgewählt werden, um ihre Organe todkranken Menschen zu spenden. Er basiert hauptsächlich auf Peter Singers Antwort auf John Harris' Konzept der "Survival Lottery".
- Was ist die Grundidee der Organlotterie?
- Die Theorie besagt, dass durch die Tötung einer gesunden Person, deren Organe transplantiert werden, mehrere todkranke Menschenleben gerettet werden können. Es wird also ein Menschenleben geopfert, um vier bis fünf andere zu retten.
- Welche Kritik gibt es an der Organlotterie?
- Die Idee stößt auf moralische Bedenken, da sie die Heiligkeit des menschlichen Lebens in Frage stellt und die bewusste Tötung eines gesunden Menschen in Kauf nimmt. Es gibt auch Bedenken hinsichtlich der Freiwilligkeit und der möglichen Konsequenzen für die Teilnehmer.
- Welche möglichen Folgen hätte die Organlotterie?
- Eine Folge wäre, dass Teilnehmer sich weniger um ihre Gesundheit kümmern, da sie im Notfall auf ein Spenderorgan hoffen können. Gesunde Menschen hätten ein höheres Risiko, als Spender ausgewählt zu werden. Es gäbe auch Schwierigkeiten bei der Entscheidung, wer von der Lotterie profitieren darf, insbesondere wenn die Krankheit selbstverschuldet ist.
- Welche Probleme ergeben sich bei der Umsetzung der Organlotterie?
- Um die Chancen der Teilnehmer fair zu gestalten, wäre eine totale Überwachung aller Lebensbereiche notwendig. Dies würde die persönliche Freiheit und Individualität einschränken. Außerdem birgt die Lotterie ein großes Risiko des Missbrauchs.
- Warum ist die Organlotterie utilitaristisch problematisch?
- Obwohl der Ansatz auf dem Utilitarismus basiert (das Prinzip der größeren Zahl), kann er nicht auf utilitaristischer Basis gerechtfertigt werden, da die Individualität und Freiheit der Menschen stark eingeschränkt würden. Die Überwachung des Einzelnen wäre gigantisch.
- Was sind die Kernpunkte der Kritik von Singer?
- Singer stimmt zu, dass die Idee der Organlotterie unsere moralischen Ansichten über Töten und Sterbenlassen in Frage stellt. Er betont aber auch die Probleme bei der Umsetzung, insbesondere die Frage der Risikoverteilung und die Möglichkeit des Missbrauchs.
- Welche Rolle spielt die Risikoverteilung?
- Die Verteilung des Risikos auf mehrere Personen kann den Anreiz verringern, Organversagen zu vermeiden. Dies kann zu einem größerem Gesamtschaden führen, ähnlich wie bei Versicherungen oder sozialen Hilfssystemen.
- Welche Bedeutung hat das Missbrauchsargument?
- Die Möglichkeit der Manipulation und des Missbrauchs bei der Auswahl der Opfer stellt ein weiteres Problem dar. Die zur Vollstreckung des Urteils notwendige Gewalt ist ebenfalls ein ethisches Problem.
- Was ist das Fazit der Auseinandersetzung mit der Organlotterie?
- Die Überlebenslotterie überschreitet die Grenzen der akzeptablen Risikoverteilung. Sie dient vor allem dazu, unsere moralischen Vorstellungen über Töten und Sterbenlassen zu hinterfragen.
- Welche Literatur wird im Text zitiert?
- Der Text bezieht sich hauptsächlich auf Peter Singer, "Utility and the Survival Lottery". Weitere Quellen sind John Harris, "The Survival Lottery" und Dieter Birnbacher, "Tun und Unterlassen".
- Arbeit zitieren
- Ivo Häusle (Autor:in), 1999, Von der Nützlichkeit der Organlotterie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98096