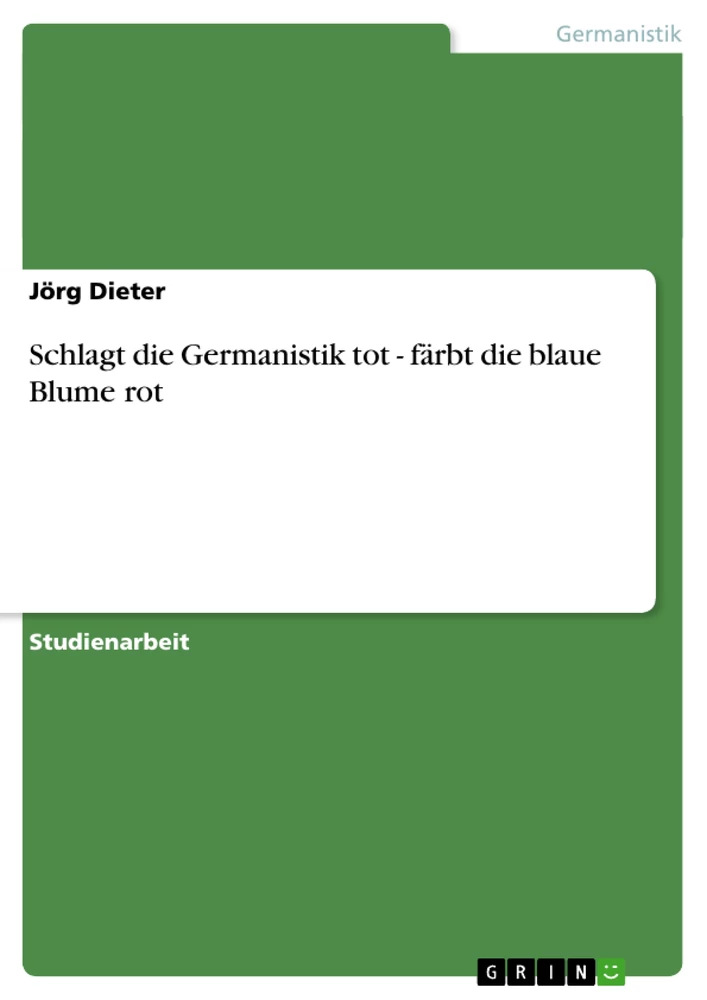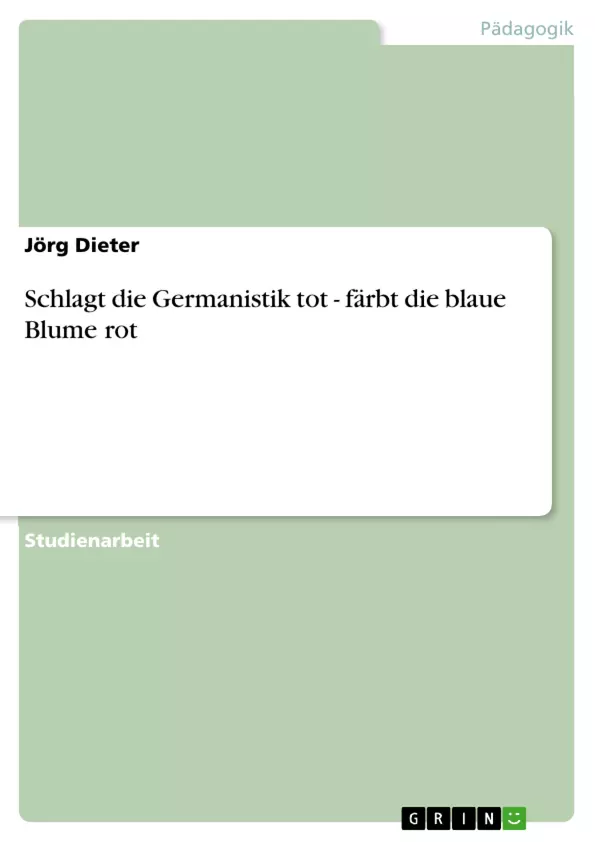“Schlagt die Germanistik tot - färbt die blaue Blume rot”. Was macht diesen Satz so interessant für uns, daß wir für einen Moment im Lesen innehalten, vielleicht schmunzelnd, vielleicht zusammenzuckend? Wollen wir das ergründen, so müssen wir uns mit einem Phänomen beschäftigen, das Germanisten auf den Namen Intertextualität getauft haben. Im weitesten Sinne versteht man darunter den Bezug von Texten auf Texte. Es spiegelt sich in diesem einfachen Satz vielfältig wider, wird von ihm zurückgeworfen wie das Echo in einem langen Tal, dessen ursprüngliche Quelle im Spiel von Hall und Widerhall schließlich nicht mehr auszumachen ist. Dieser Satz fand sich einst, zur Zeit der Studentenbewegung in Deutschland, auf Spruchbänder geschrieben - dies ist der erste intertextuelle Bezug. Die Studenten wendeten sich damit gegen die bestehende, in ihren Augen reaktionäre und muffige Germanistik. Diese wurde für sie versinnbildlicht durch das Symbol der Blauen Blume, die in ihren besten Tagen überhaupt nicht reaktionär und muffig war, sondern eine Fahne, unter der sich eine junge, stürmische, alle Höhen und Tiefen des menschlichen Daseins auskosten wollende Bewegung formierte: die Romantik. Soweit der zweite intertextuelle Bezug. An die Stelle der überkommenen, reaktionären Art Germanistik zu treiben, sollte aus der Sicht der Studenten von damals eine neue treten, die nicht mehr das Steckenpferd alternder Schöngeister sein sollte, sondern ein Mittel des Klassenkampfes. Ob man das Wort “rot” in diesem Zusammenhang als einen dritten intertextuellen Bezug sehen will, oder als bloße Anspielung, hängt unter anderem davon, ab, was man als Bezugstext anerkennt.
Welche Versuche die Germanistik, die, wie wir heute wissen, die damaligen Angriffe überstanden, vielleicht durch sie sogar noch einige interessante Facetten hinzugewonnen hat, unternahm, den Begriff der Intertextualität genauer zu fassen, welche Gründe Autoren haben, Intertextualitäten bewußt zu verwenden, und warum es von Vorteil sein kann, als Leser darüber Bescheid zu wissen, damit setzt sich diese Arbeit auseinander.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Langweilige und interessante Definitionen des Begriffes Intertextualität
- Die langweilige Definition
- Die interessante Definition
- Die Grauzone
- Intertextualität und Anspielung
- Möglichkeiten der Markierung von Intertextualität
- Fünf gute Gründe für die Verwendung von Intertextualitäten
- Ausgrenzung
- Ein Leben ohne Intertextualität?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff der Intertextualität und seine verschiedenen Ausprägungen. Sie beleuchtet unterschiedliche Definitionen, analysiert die Markierung von Intertextualitäten und deren Funktionen in der Kommunikation. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage nach den Gründen für die Verwendung von Intertextualitäten in Texten.
- Definitionen von Intertextualität
- Markierung von Intertextualitäten
- Funktionen von Intertextualitäten (Kommunikation, Ausgrenzung, Identitätsbildung)
- Bewusste und unbewusste Verwendung von Intertextualitäten
- Bedeutung des Intertextualitätsbewusstseins für den Leser
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beginnt mit dem Satz „Schlagt die Germanistik tot - färbt die blaue Blume rot“ und untersucht dessen intertextuelle Bezüge. Sie führt in das Thema Intertextualität ein, definiert es als Bezug von Texten auf Texte und verweist auf die vielfältigen Bedeutungsfacetten, die sich in diesem Satz widerspiegeln. Die Einleitung skizziert die Auseinandersetzung der Arbeit mit verschiedenen Definitionen von Intertextualität, den Gründen für deren bewusste Verwendung und der Bedeutung des Intertextualitätsbewusstseins für den Leser. Der Satz wird in seinen intertextuellen Bezügen zur Studentenbewegung und zur Romantik eingeordnet und die damit verbundenen politischen Implikationen angedeutet. Die Arbeit kündigt die Analyse verschiedener Aspekte der Intertextualität an.
Langweilige und interessante Definitionen des Begriffes Intertextualität: Dieses Kapitel präsentiert zwei gegensätzliche Definitionen von Intertextualität. Die „langweilige“ Definition besagt, dass jeder Text in allen seinen Elementen intertextuell ist, da Sprache ein gesellschaftliches und historisches Phänomen ist. Diese Definition wird als wenig ergiebig für die Analyse einzelner Texte und insbesondere nicht-wörtlichen Sprachgebrauchs kritisiert. Die „interessante“ Definition hingegen betont die bewusste Verwendung und das gegenseitige Bewusstsein von Autor und Leser bezüglich der intertextuellen Bezüge. Dies impliziert eine Markierung der Intertextualität, die den Kommunikationsprozess erst ermöglicht. Der Fokus liegt hier auf der Analyse markierter Intertextualitäten als Formen nicht-wörtlichen Sprachgebrauchs, die durch den Bezug auf andere Texte eine zusätzliche Bedeutungsebene erhalten. Das Kapitel hebt die Grauzone zwischen diesen beiden extremen Definitionen hervor und weist auf die Faszination der dazwischen liegenden Fälle hin – also Situationen, in denen die bewusste Verwendung von Intertextualität nicht eindeutig feststellbar ist.
Schlüsselwörter
Intertextualität, Textbezug, Definitionen, Markierung, Kommunikation, Anspielung, nicht-wörtlicher Sprachgebrauch, Leser, Autor, Studentenbewegung, Romantik, Grauzone.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: [Titel des Textes einfügen] - Eine Analyse der Intertextualität
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Intertextualität. Sie untersucht verschiedene Definitionen, die Markierung von Intertextualitäten und deren Funktionen in der Kommunikation. Ein Schwerpunkt liegt auf den Gründen für die Verwendung von Intertextualitäten in Texten und der Bedeutung des Intertextualitätsbewusstseins für den Leser.
Welche Definitionen von Intertextualität werden behandelt?
Die Arbeit präsentiert zwei gegensätzliche Definitionen: eine „langweilige“, die besagt, dass jeder Text intertextuell ist, und eine „interessante“, die die bewusste Verwendung und das gegenseitige Bewusstsein von Autor und Leser betont. Die Arbeit analysiert auch die Grauzone zwischen diesen Extremen.
Wie wird Intertextualität markiert?
Die Arbeit untersucht verschiedene Möglichkeiten der Markierung von Intertextualität, die den Kommunikationsprozess ermöglichen und die zusätzliche Bedeutungsebene durch den Bezug auf andere Texte hervorheben. Dies ist ein zentraler Aspekt der "interessanten" Definition.
Welche Funktionen haben Intertextualitäten?
Intertextualitäten erfüllen verschiedene Funktionen in der Kommunikation, wie z.B. die Ausgrenzung, Identitätsbildung und die Schaffung zusätzlicher Bedeutungsebenen. Die Arbeit analysiert diese Funktionen im Detail.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, langweiligen und interessanten Definitionen von Intertextualität, Intertextualität und Anspielung, Möglichkeiten der Markierung, fünf Gründen für die Verwendung, Ausgrenzung, und einem Leben ohne Intertextualität. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Intertextualität, Textbezug, Definitionen, Markierung, Kommunikation, Anspielung, nicht-wörtlicher Sprachgebrauch, Leser, Autor, Studentenbewegung, Romantik, Grauzone.
Wie beginnt die Einleitung?
Die Einleitung beginnt mit dem Satz „Schlagt die Germanistik tot - färbt die blaue Blume rot“ und analysiert dessen intertextuelle Bezüge zur Studentenbewegung und der Romantik.
Welche Bedeutung hat das Intertextualitätsbewusstsein für den Leser?
Das Intertextualitätsbewusstsein des Lesers spielt eine entscheidende Rolle beim Verständnis der zusätzlichen Bedeutungsebenen, die durch Intertextualität in Texten geschaffen werden. Die Arbeit untersucht die Bedeutung dieses Bewusstseins.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, die die wichtigsten Punkte und Argumentationslinien zusammenfasst.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Begriff der Intertextualität und seine verschiedenen Ausprägungen. Sie beleuchtet unterschiedliche Definitionen, analysiert die Markierung von Intertextualitäten und deren Funktionen in der Kommunikation und geht der Frage nach den Gründen für die Verwendung von Intertextualitäten nach.
- Quote paper
- Jörg Dieter (Author), 1998, Schlagt die Germanistik tot - färbt die blaue Blume rot, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9812