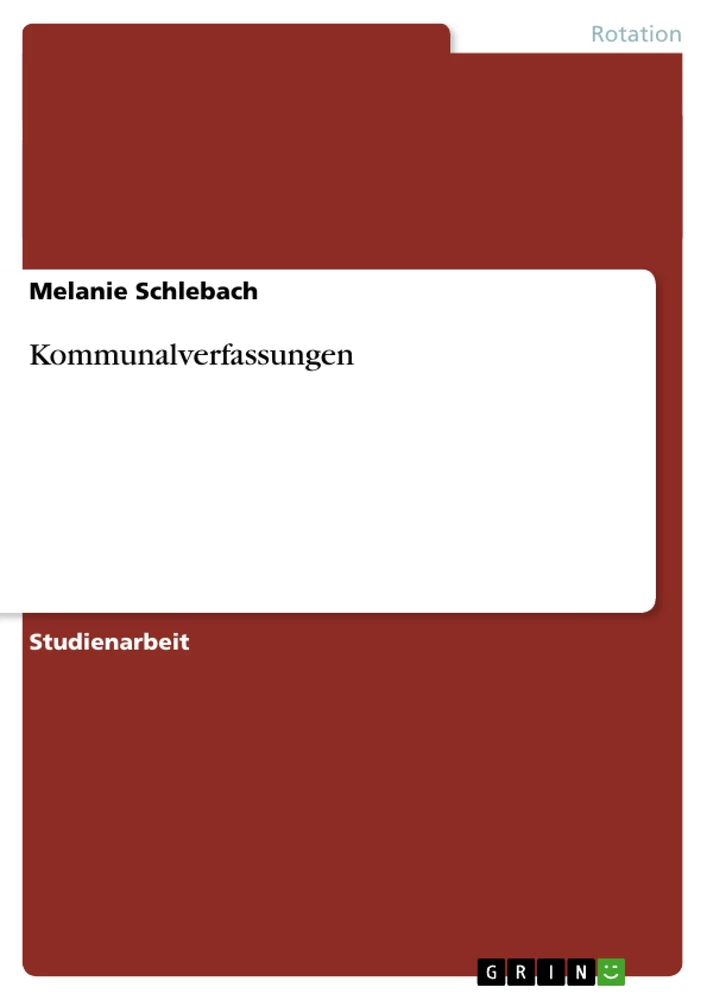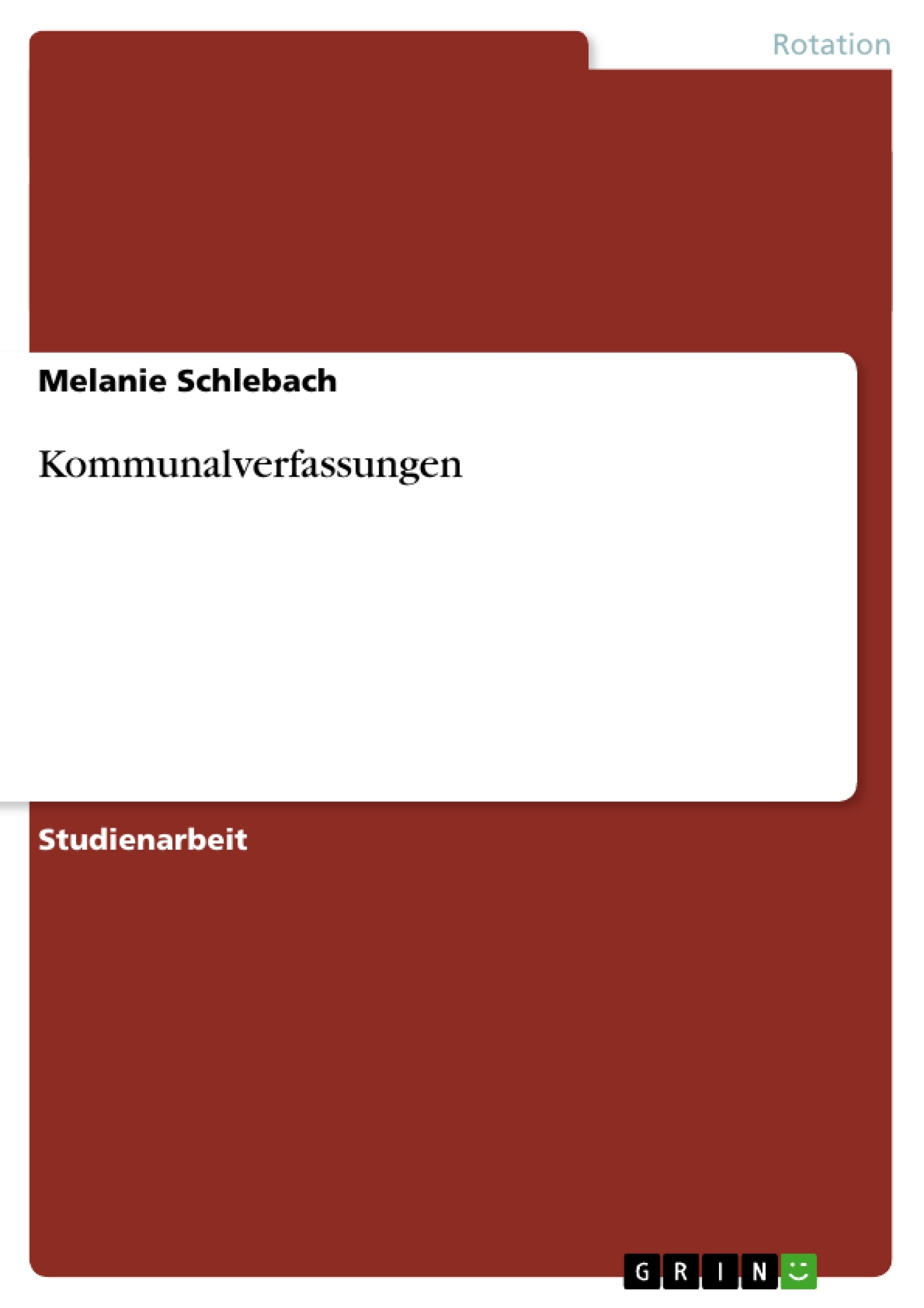Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Wesentliche Änderungen im BBiG
2.1. Flexibilisierung der Teilzeitberufsausbildung
2.2. Berufsschulanrechnung für Volljährige
2.3. Mindestausbildungsvergütung
3. Änderungen im Prüfungsrecht
4. Neuregelungen in der Fortbildung
5. Berufsausbildung in Zeiten der Pandemie
1. Einleitung
Durch das Berufsbildungsgesetz vom 14. August 1969 wurde das Berufsbildungsrecht erstmals umfassend und bundeseinheitlich geregelt.1 Das Berufsbildungsreformgesetz hat mit Wirkung zum 1. April 2005 das BBiG grundlegend reformiert. Mit dem Berufsbildungsmodernisierungsgesetz, welches zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist, erfolgte 3 eine erneute Novellierung.
Ziel des Gesetzes ist die Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung auch im Verhältnis zur akademischen Bildung.4 Wesentliche Kernpunkte sind die Flexibilisierung der Teilzeitberufsausbildung, Verbesserungen für volljährige Berufsschüler bei der Anrechnung auf die Ausbildungszeit, die Einführung einer Mindestausbildungsvergütung sowie Änderungen im Prüfungsrecht und in der Fortbildung.
Durch die Corona-Pandemie ergeben sich auch im Bereich der Berufsbildung eine Reihe von Herausforderungen, die im Rahmen des geltenden Rechtsrahmens zu lösen sind.
2. Wesentliche Änderungen im BBiG
2.1. Flexibilisierung der Teilzeitberufsausbildung
Die Teilzeitberufsausbildung ist erstmals mit der BBiG-Novelle zum 1. April 2005 eingeführt worden (§ 8 Abs. 1 S. 2 BBiG a.F.). Voraussetzung war nach dieser Vorschrift ein berechtigtes Interesse.
Durch § 7a BBiG werden die Möglichkeiten der Teilzeitberufsausbildung deutlich erweitert. Ausbildender und Auszubildender können für die gesamte Ausbildungszeit oder für einen bestimmten Zeitraum der Berufsausbildung die Verkürzung der täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit vereinbaren (§ 7a Abs. 1 S. 2 BBiG). Das Erfordernis des berechtigten Interesses entfällt.
Die Verkürzung kann erfolgen, indem die tägliche oder die wöchentliche Ausbildungszeit um maximal 50% gekürzt wird.
Beispiel: Die betriebsübliche Ausbildungszeit beträgt 8 Stunden pro Tag an 5 Tagen pro Woche (= 40 Wochenstunden).
Eine Teilzeitausbildung kann z.B. vereinbart werden, indem 6 Stunden pro Tag an 5 Tagen pro Woche (= 30 Wochenstunden) vereinbart werden. Möglich wäre aber auch, dass eine Ausbildungszeit von 8 Stunden pro Tag an 4 Tagen pro Woche (= 32 Wochenstunden) vereinbart wird. Die Vereinbarung einer Ausbildungszeit von weniger als 20 Wochenstunden ist in diesem Fall nicht möglich.
Im Falle der Teilzeitausbildung verlängert sich die kalendarische Ausbildungszeit entsprechend auf volle Monate abgerundet (§ 7a Abs. 2 BBiG).
Beispiel: Für eine dreijährige Berufsausbildung bei einer betriebsüblichen Ausbildungszeit von 40 Stunden wird eine Teilzeitausbildung mit 30 Wochenstunden vereinbart.
Die Ausbildungsdauer verlängert sich damit auf 4 Jahre.
Maximal ist die Verlängerung auf das Eineinhalbfache der normalen Ausbildungsdauer begrenzt (§ 7a Abs. 2 BBiG). Auf Verlangen der Auszubildenden kommt darüber hinaus eine Verlängerung bis zur nächstmöglichen Abschlussprüfung in Betracht (§ 7a Abs. 3 BBiG).
Beispiel: Für eine dreijährige Berufsausbildung und einer betriebsüblichen Ausbildungszeit von 40 Stunden wird eine Teilzeitausbildung mit 20 Wochenstunden vereinbart.
Die Ausbildungsdauer verlängert sich damit auf 4,5 Jahre. Finden die Abschlussprüfungen nur jährlich statt, kommt eine Verlängerung auf 5 Jahre in Betracht, wenn der Auszubildende dies verlangt.
Wird eine Teilzeitausbildung vereinbart, kommt auch eine Verkürzung der Ausbildungsdauer nach § 8 Abs. 1 BBiG in Betracht, z.B. aufgrund eines höheren Schulabschlusses (§ 7a Abs. 4 BBiG). Dadurch ist es z.B. auch möglich, dass die wöchentliche Ausbildungszeit unter Beibehaltung der kalendarischen Dauer der Ausbildung gekürzt wird.
2.2. Berufsschulanrechnung für Volljährige
Auszubildende sind zur Teilnahme am Berufsschulunterricht sowie für außerbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen und Prüfungen freizustellen. Nach der bisherigen Rechtslage gab es aber nur Regelungen zur Anrechnung auf die Ausbildungszeit für Minderjährige im Jugendarbeitsschutzgesetz. Diese Anrechnungsregeln des § 9 JArbSchG gelten seit 1997 für Volljährige nicht mehr.
Seit dem 1.1.2020 ist auch für Volljährige die Anrechnung auf die Ausbildungszeit nach § 15 BBiG geregelt. Diese Regelung entspricht der in § 9 JArbSchG:
- vor einem vor 9:00 Uhr beginnenden Unterricht ist keine Beschäftigung zulässig
- an einem Berufsschultag mit mehr als 5 Unterrichtsstunden mit mindestens 45 Minuten ist einmal in der Woche keine zusätzliche Beschäftigung zulässig
- bei Blockunterricht in einer Woche mit mindestens 25 Stunden an 5 Tagen sind maximal 2 Stunden zusätzliche betriebliche Ausbildung zulässig
- im Übrigen zählt die Berufsschulzeit einschließlich der Pausen als Arbeitszeit
Beispiel: Petra Pohl, mit der eine Ausbildungszeit von 8 Stunden pro Tag an 5 Tagen pro Woche vereinbart ist, besucht die Berufsschule dienstags von 8:00 bis 13:00 Uhr (6 Unterrichtsstunden) und freitags von 8:45 bis 12:15 Uhr (4 Unterrichtsstunden). Inwieweit ist eine betriebliche Beschäftigung noch zulässig?
Eine Beschäftigung vor einem vor 9:00 Uhr beginnenden Berufsschultag ist unzulässig, § 15 Abs. 1 Nr. 1 BBiG, also an beiden Tagen. Eine Beschäftigung nach einem mehr als 5 Stunden a 45 Minuten dauernden Berufsschultag (also dienstags) ist ebenfalls unzulässig § 15 Abs. 1 Nr. 2 JArbSchG. Eine Beschäftigung am Freitag Nachmittag ist demgegenüber für bis zu 4^ Stunden zulässig, § 15 Abs. 2 Nr. 1 BBiG.
Auch am Arbeitstag, welcher der schriftlichen Abschlussprüfung unmittelbar vorangeht, ist nunmehr auch der volljährige Auszubildende freizustellen (§ 15 Abs. 1 Nr. 5 BBiG). Das entspricht der Regelung des § 10 JArbSchG.
Beispiel: Findet die schriftliche Abschlussprüfung an einem Dienstag statt, hat ein Auszubildender Anspruch auf Freistellung am Montag. Ist der Prüfungstag ein Montag, geht dem Prüfungstag kein Arbeitstag unmittelbar voran, so dass kein Freistellungsanspruch besteht.
2.3. Mindestausbildungsvergütung
Ausbildende haben den Auszubildenden eine angemessene Vergütung zu gewähren (§ 17 Abs. 1 S. 1 BBiG). Die zentrale Frage ist, wann die Höhe der Ausbildungsvergütung als angemessen gilt. Dabei sind mehrere Aspekte zu beachten.
Das Mindestlohngesetz ist auf Ausbildungsverträge nicht anzuwenden (§ 22 Abs. 2 MiLoG).
Für Ausbildungsverhältnisse, die ab 2020 neu abgeschlossen werden, gelten aber Mindestausbildungsvergütungen, welche Untergrenzen der Angemessenheit darstellen. Die Mindestausbildungsvergütungen werden durch § 17 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BBiG zunächst für den Ausbildungsbeginn in den Jahren 2020 bis 2023 für das erste Ausbildungsjahr festgelegt. Für das zweite bis vierte Ausbildungsjahr werden auf dieser Basis Steigerungen von 18%, 35% und 40% vorgesehen, § 17 Abs. 2 S. 1 Nr. 2-4 BBiG. Daraus ergeben sich folgende Werte:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Höhe der Mindestvergütung des ersten Ausbildungsjahres für den Ausbildungsbeginn ab 2024 wird auf Basis der durchschnittlichen Steigerungen der Ausbildungsvergütungen, die im Berufsbildungsbericht für die zwei Jahre vor der Bekanntgabe erfasst wurden, fortgeschrieben, § 17 Abs. 2 S. 2 BBiG. Die Bekanntgabe erfolgt bis zum 1.11. des Vorjahres im Bundesgesetzblatt.
Beispiel: Für das Jahr 2024 erfolgt die Bekanntgabe bis zum 1.11.2023, Basis ist die Steigerung der erfassten Ausbildungsvergütungen von 2021 zu 2022.
Als angemessen gilt im Geltungsbereich eines Tarifvertrag s stets die tarifvertragliche Vergütung. Das gilt auch dann, wenn sie die Mindestausbildungsvergütungen unterschreitet, § 17 Abs. 3 BBiG.
Eine Ausbildungsvergütung außerhalb eines Tarifvertrags ist in der Regel nicht mehr angemessen, wenn sie die in einem einschlägigen Tarifvertrag geregelte Vergütung um mehr als 20% unterschreitet, auch wenn sie oberhalb der Mindestausbildungsvergütung liegt, § 17 Abs. 4 BBiG. Damit wird die bisherige Rechtsprechung5 kodifiziert.
Fehlt ein Tarifvertrag, so können die Empfehlungen der zuständigen Stellen als Maßstab der Angemessenheit herangezogen werden. Auch hier fehlt es an der Angemessenheit, wenn die Empfehlung um mehr als 20% unterschritten wird.6
Für die Angemessenheit der Ausbildungsvergütung müssen also folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
- im Geltungsbereich eines Tarifvertrags muss mindestens die tarifvertragliche Vergütung gezahlt werden
- außerhalb eines Tarifvertrags muss mindestens 80% der in einem einschlägigen Tarifvertrag geregelten bzw. der üblichen Vergütung gezahlt werden, wenn dieser Wert die Mindestausbildungsvergütung übersteigt, sonst mindestens die Mindestausbildungsvergütung
Beispiel: Für ein Ausbildungsverhältnis, welches im September 2020 beginnt, soll die Mindesthöhe der Ausbildungsvergütung bestimmt werden, wenn in einem einschlägigen Tarifvertrag die tarifliche monatliche Ausbildungsvergütung beträgt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Sind Ausbildender und Auszubildender tarifgebunden (§ 3 Abs. 1 TVG), so sind mindestens die tariflichen Vergütungen zu zahlen. Das gilt auch im Fall a), da Tarifverträge die Mindestausbildungsvergütung unterschreiten dürfen.
Liegt keine Tarifbindung vor, so ist im Fall a) mindestens die Mindestausbildungsvergütung i.H.v. 515 € pro Monat zu zahlen, im Fall b) mindestens 800 € (= 80% der tarifvertraglichen Höhe).
Wird eine Teilzeitberufsausbildung nach § 7a BBiG vereinbart, darf die Ausbildungsvergütung um den Prozentsatz der zeitlichen Verkürzung verringert werden (§ 17 Abs. 5 BBiG).
Für Ausbildungsverträge, die vor dem 1.1.2020 abgeschlossen wurden, gilt § 17 BBiG a.F. weiter (§ 106 Abs. 1 BBiG). Als angemessen gilt auch hier im Geltungsbereich eines Tarifvertrag s stets die tarifvertragliche Vergütung. Eine Ausbildungsvergütung außerhalb eines Tarifvertrags ist in der Regel nicht mehr angemessen, wenn sie die in einem einschlägigen Tarifvertrag geregelte Vergütung bzw. die Empfehlungen der zuständigen Stellen um mehr 7 als 20% unterschreitet.
3. Änderungen im Prüfungsrecht
Die Abnahme der Abschlussprüfungen regeln die §§ 39 ff. BBiG für die duale Ausbildung. Diese Regelungen gelten etsprechend für Fortbildungsprüfungen (§ 56 Abs. 1 BBiG).
Das wichtigste Organ der zuständigen Stelle für die Abnahme der Prüfungen ist der Prüfungsausschuss. Zentrale Aufgabe der Prüfungsausschüsse ist die Abnahme und Bewertung der Prüfungen. Das umfasst die Noten einzelner Prüfungsleistungen, der Prüfung insgesamt sowie die Entscheidung über das Bestehen oder Nichtbestehen (§ 42 Abs. 1 BBiG).
Nach der bisherigen Rechtslage hat die Abnahme und Bewertung aller Prüfungsleistungen durch den Prüfungsausschuss als Ganzes zu erfolgen (Kollegialprinzip). In der Praxis führt das aufgrund des Ehrenamtsprinzips zu einer starken Belastung der Prüfungsausschüsse.
Durch das Berufsbildungsmodernisierungsgesetz gibt es nun mehrere Entlastungen.
Zum einen können Prüferdelegationen gebildet werden (§§ 39 Abs. 2, 42 Abs. 2 S. 1 BBiG), denen zur Entlastung der Prüfungsausschüsse die Abnahme und Bewertung von Prüfungsleistungen übertragen werden kann. Den Prüferdelegationen kann die zuständige Stelle im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die Abnahme und abschließende Bewertung von Prüfungsleistungen übertragen (§ 42 Abs. 2 S. 1 BBiG).
Beispiel: Die Prüfung zum geprüften Bilanzbuchhalter umfasst drei schriftliche Situationsaufgaben sowie eine mündliche Prüfung. Hier ist es zukünftig möglich, dass z.B. der Prüfungsausschuss die Abnahme und Bewertung der mündlichen Prüfung sowie der Situationsaufgabe 1 übernimmt, während die Bewertung der Situationsaufgaben 2 und 3 durch eine Prüferdelegation übernommen wird.
Die Zusammensetzung der Prüferdelegationen entspricht der eines Prüfungsausschusses, d.h. sie besteht aus mindestens 3 Mitgliedern, die für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein müssen (§ 40 Abs. 1 BBiG). Der Prüferdelegation müssen Beauftragte der Arbeitnehmer und Arbeitgeber in gleicher Zahl sowie mindestens ein Lehrer berufsbildender Schulen angehören (§ 40 Abs. 2 BBiG). Mindestens zwei Drittel der Mitglieder müssen Beauftragte der Arbeitnehmer und Arbeitgeber sein.
Mitglieder einer Prüferdelegation können nach § 42 Abs. 2 BBiG Prüfungsausschussmitglieder, deren Stellvertreter oder weitere Prüfende (§ 40 Abs. 4 BBiG) sein. Prüfende können auch Mitglied mehrerer Prüferdelegation sein. Bei Prüfungsleistungen, die derart aufeinander bezogen sind, dass sie nur einheitlich bewertet werden können, müssen diese Prüfungsleistungen von denselben Prüfern abgenommen werden (§ 42 Abs. 3 BBiG).
Die zweite Entlastung erfolgt durch Abweichungen vom Kollegialprinzip, d.h. dass alle Prüfungsleistungen durch den Prüfungsausschuss abschließend bewertet werden müssen.
Überregional durch einen paritätisch besetzten Aufgabenerstellungsausschuss erstellte Antwort-Wahl-Aufgaben können automatisiert ausgewertet werden; das Ergebnis ist dann vom Prüfungsausschuss zu übernehmen (§ 42 Abs. 4 BBiG). Der Aufgabenerstellungsausschuss hat festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden.
Die Bewertung einzelner schriftlicher oder sonstiger nicht flüchtiger Prüfungsleistungen kann zwei Mitgliedern des Prüfungsausschusses bzw. der Prüferdelegation übertragen werden (§ 42 Abs. 5 BBiG). Bei einem Bewertungsunterschied von nicht mehr als 10% ergibt sich die Bewertung als Mittelwert der beiden Bewertungen. Bei größeren Abweichungen bewertet ein vorab bestimmter dritter Prüfer endgültig.
Beschlüsse über die vom Prüfungsausschuss selbst abgenommenen einzelnen Prüfungsleistungen, die Noten zur Bewertung der Prüfung insgesamt sowie über das Bestehen oder Nichtbestehen der Prüfung können weiterhin nur vom Prüfungsausschuss selbst gefasst werden (§ 42 Abs. 1 BBiG).
Häufig gestellte Fragen
Was sind die wesentlichen Änderungen im Berufsbildungsgesetz (BBiG) gemäß dem Text?
Der Text beschreibt wesentliche Änderungen im BBiG, insbesondere die Flexibilisierung der Teilzeitberufsausbildung, Verbesserungen für volljährige Berufsschüler bei der Anrechnung auf die Ausbildungszeit, die Einführung einer Mindestausbildungsvergütung sowie Änderungen im Prüfungsrecht und in der Fortbildung.
Wie wurde die Teilzeitberufsausbildung flexibilisiert?
Die Teilzeitberufsausbildung wurde durch § 7a BBiG deutlich erweitert. Ausbildende und Auszubildende können nun für die gesamte Ausbildungszeit oder einen bestimmten Zeitraum die Verkürzung der täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit vereinbaren. Das Erfordernis eines berechtigten Interesses entfällt. Die Verkürzung kann bis zu 50% der täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit betragen. Die kalendarische Ausbildungszeit verlängert sich entsprechend, maximal auf das Eineinhalbfache der normalen Ausbildungsdauer.
Wie werden volljährige Auszubildende bei der Berufsschulanrechnung behandelt?
Seit dem 1.1.2020 ist auch für Volljährige die Anrechnung auf die Ausbildungszeit nach § 15 BBiG geregelt. Die Regelung entspricht der in § 9 JArbSchG: Keine Beschäftigung vor 9:00 Uhr beginnendem Unterricht, an einem Berufsschultag mit mehr als 5 Unterrichtsstunden keine zusätzliche Beschäftigung, bei Blockunterricht mit mindestens 25 Stunden an 5 Tagen maximal 2 Stunden zusätzliche betriebliche Ausbildung. Die Berufsschulzeit einschließlich Pausen zählt als Arbeitszeit. Auch am Arbeitstag vor der schriftlichen Abschlussprüfung besteht ein Freistellungsanspruch.
Was sind die Regelungen zur Mindestausbildungsvergütung?
Für Ausbildungsverhältnisse, die ab 2020 neu abgeschlossen werden, gelten Mindestausbildungsvergütungen nach § 17 Abs. 2 S. 1 BBiG, beginnend mit 515 € im ersten Ausbildungsjahr (für 2020-2023), mit Steigerungen von 18%, 35% und 40% für das zweite bis vierte Ausbildungsjahr. Die Höhe der Mindestvergütung für das erste Ausbildungsjahr ab 2024 wird fortgeschrieben. Im Geltungsbereich eines Tarifvertrags gilt stets die tarifvertragliche Vergütung. Außerhalb eines Tarifvertrags ist eine Vergütung in der Regel nicht mehr angemessen, wenn sie die in einem einschlägigen Tarifvertrag geregelte Vergütung um mehr als 20% unterschreitet, auch wenn sie oberhalb der Mindestausbildungsvergütung liegt.
Welche Änderungen gibt es im Prüfungsrecht?
Es können Prüferdelegationen gebildet werden (§§ 39 Abs. 2, 42 Abs. 2 S. 1 BBiG), denen die Abnahme und Bewertung von Prüfungsleistungen übertragen werden kann. Überregional erstellte Antwort-Wahl-Aufgaben können automatisiert ausgewertet werden. Die Bewertung einzelner schriftlicher oder sonstiger nicht flüchtiger Prüfungsleistungen kann zwei Mitgliedern des Prüfungsausschusses bzw. der Prüferdelegation übertragen werden (§ 42 Abs. 5 BBiG).
- Arbeit zitieren
- Melanie Schlebach (Autor:in), 1997, Kommunalverfassungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98133