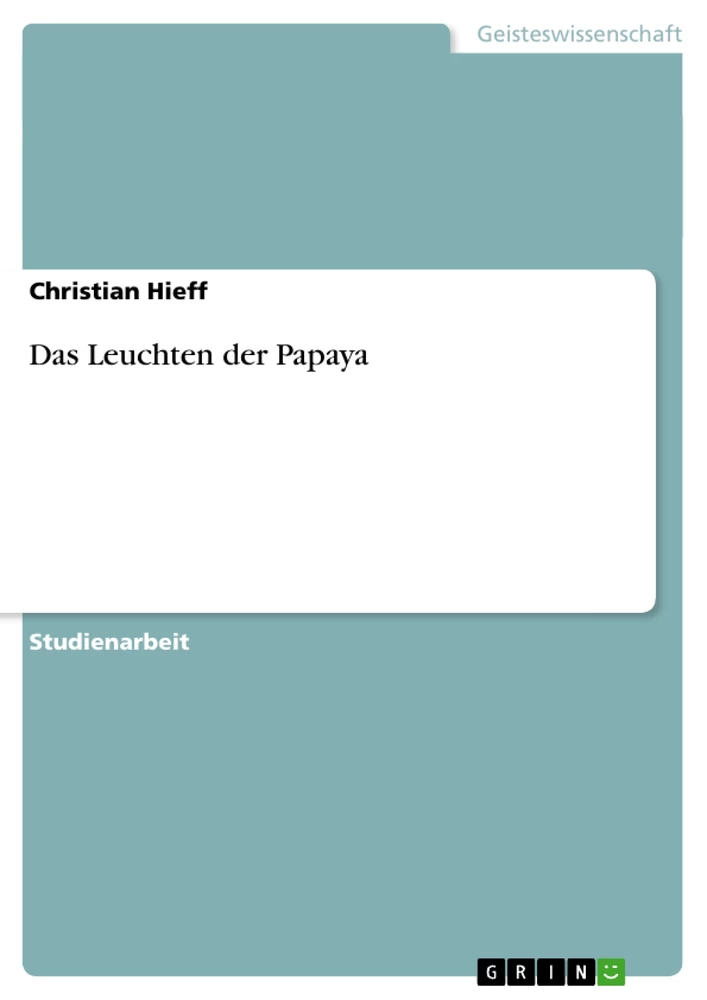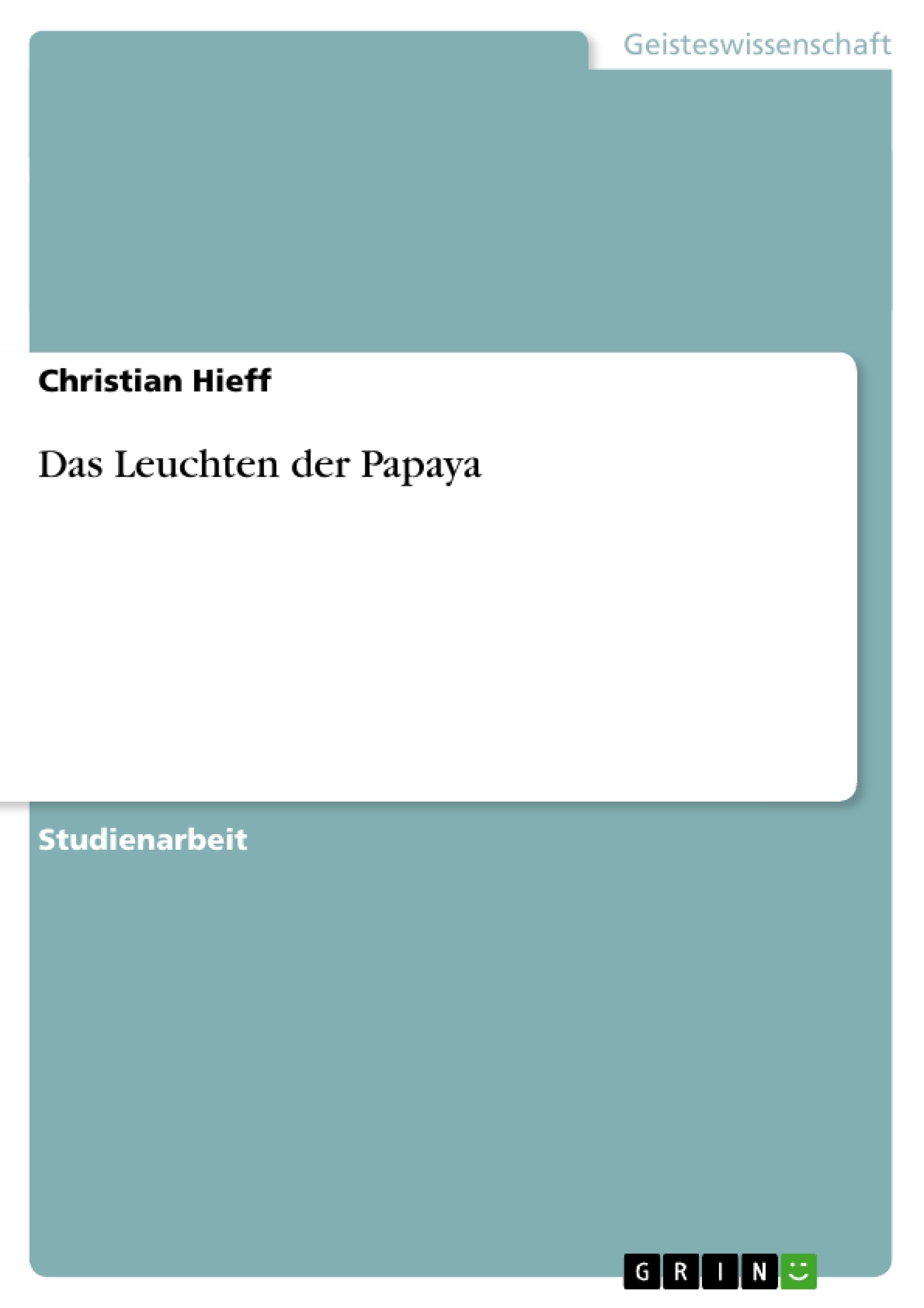Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Malinowskis Tagebücher
II.1 Außenseitertum
II.2 Eintönigkeit
II.3 Übertriebene Beschäftigung mit sich selbst
III. Bewertung der Tagebücher
IV. Exkurs: Die Ethnopsychoanalyse
V. Das Leuchten der Papaya
VI. Schlußbemerkungen
VII. Literaturverzeichnis
I. Einleitung
Mit ,,Das Leuchten der Papaya" von Christian Maier und Malinowskis Tagebüchern liegen unterschiedliche Erfahrungsberichte zweier Feldforscher von ihrem Aufenthalt in der trobriandischen Gesellschaft vor.
Im zweiten Kapitel sollen Malinowskis Tagebücher und die daraus ersichtlichen Probleme für dem Forscher im Feld thematisiert werden.
Malinowskis Tagebücher wurden 1967 posthum von seiner Witwe Valetta Malinowska veröffentlicht. Dies führte zur überraschenden Entdeckung, daß es dem Erfinder der Methode der teilnehmenden Beobachtung nicht geglückt war, sich in die trobriandischen Gesellschaft einzugliedern und eine distanzierten Blick abzulegen. Die Tagebücher haben für die wissenschaftliche Erkenntnis nur geringen Wert, aber sie zeigen anschaulich die Schwierigkeiten, die Malinowski bei der Erforschung der ihm fremden Kultur hatte. Raymond Firth beschreibt den Wert der Tagebücher für die Ethnologie folgendermaßen: ,,Auch wenn das Tagebuch wenig von methodologischen Fragen der Feldarbeit oder von Problemen der anthropologischen Theorie erzählt, vermittelt es doch recht anschaulich die Reaktion eines Feld-Anthropologen auf eine ihm fremde Gesellschaft."1
Christian Maiers Erfahrungsberichte erzählen von seinem Forscheraufenthalt 75 Jahre später in Neuguinea und zeigen anschaulich sein anderes Wissenschaftsverständnis. Er bedient sich der Methodik der Ethno-Psychoanalyse. Die Ethno-Psychoanalyse bezieht die Psychoanalyse bei der Untersuchung fremder Kulturen mit ein. Im weiteren Kapitel soll dieser Wissenschaftszweig dargestellt werden, bevor sich eine Untersuchung des Reiseberichtes von Christian Maier anschließt.
Christian Maier, ein anerkannter Schweizer Psychoanalytiker, reiste 1991 auf die trobriandischen Inseln. Er war auf Einladung des Dorfes dort, da die Einwohner ihn bei einem früheren Aufenthalt gebeten hatten, ihnen den modernen Fußball beizubringen. Seine Erlebnisse dort veröffentlichte Maier in seinem Buch ,,Das Leuchten der Papaya". Maier bedient sich einer anderen Methodik bei der Erforschung der trobriandischen Kultur. Die Ethno-Psychoanalyse untersucht die psychischen Auswirkungen der Kultur auf den Einzelnen. Dem Forscher ist die Subjektivität seiner Erkenntnis bewußt. Maier thematisiert immer wieder die Auswirkungen des Feldaufenthaltes auf ihn selbst. Die eigenen Ängste, Frustationen und Irritationen sind fester Bestandteil seiner Untersuchung. Er ist als Forscher gleichzeitig auch Teil seines zu analysierenden Untersuchungsgegenstandes. Ein Vergleich der beiden Feldforschungserfahrungen darf nur mit Einschränkungen gemacht werden. Nicht nur die unterschiedlichen Zeitepochen, in denen sie enstanden, sind dabei zu berücksichtigen, sondern auch die unterschiedlichen Adressaten, an die sie sich wenden. Malinowski schrieb seine Tagebücher nie mit der Intention der Veröffentlichung und es darf bezweifelt werden, daß er sein Einverständnis dazu gegeben hätte. Maier hingegen richtet sich direkt an eine Leserschaft, was für die Form und Inhalt seines Berichtes entscheidend ist. Ein Vergleich beider Berichte ist nur unter Vorbehalten möglich, sie sind Inhalt der abschließenden Bemerkungen.
II. Malinowskis Tagebücher
Malinowskis Tagebücher wurden 1967 von seiner zweiten Frau Valetta Malinowska posthum veröffentlicht. Sie berichten über den Alltag Malinowskis bei seinen Feldforschungen von Anfang September 1914 bis Anfang August 1915 und von Ende Oktober 1917 bis Mitte 1918.2 Der erste Teil der Tagebücher berichtet über seine Aufenthalt in Mailu im südlichen Neuguinea. Von dort aus machte er einen kurzen Besuch zu den Trobriand-Inseln, die sein Interesse für die dort lebende Kultur weckte. Der Forscheralltag von Malinowski auf Trobriand im letzten Jahr seines Aufenthaltes wird im 2.Teil beschrieben.
Die Übersetzung der Tagebücher erwies sich als recht schwierig. Malinowski schrieb sie auf polnisch, doch verwendete er auch Ausdrücke und Wendungen aus anderen Sprachen, so daß einige Passagen mißverständlich sein können. So gebraucht Malinowski das Wort ,,Nigger" in Bezug auf die trobriandischen Bewohner, dessen Bedeutung im Englischen abwertend ist. Aus dem Polnischen abgeleitet, ist der Begriff jedoch nicht negativ besetzt.3 Auch benutzte Malinowski sehr gerne Abkürzungen für Namen oder gebrauchte nur Vornamen, so daß sich das Verständnis für den Übersetzer nur durch genaue Kenntnisse der Biographie und des Umfelds Malinowskis erschloß. Trotzdem muß an einigen Passagen über ihre Bedeutung spekuliert werden.
Manche Eintragungen waren unleserlich und konnten nicht rekonstruiert werden, so daß man gezwungen war, an diesen Stellen die Auslassungen zu kennzeichnen. Obwohl diese Tagebücher einen recht schonungslosen Einblick in den Gefühlshaushalt Malinowskis erlauben, wurden Eintragungen, die zu persönlicher Natur waren, auf Wunsch der Witwe Malinowska, nicht veröffentlicht.4
Malinowski verarbeitet in seinen Tagebüchern seine Eindrücke der ihm fremden Kultur. Durch das Lesen wird man Zeuge, wie Malinowski versucht, die Gebräuche und Verhaltensweisen zu deuten.
Doch erfährt man als Leser wenig über die von Malinowski entwickelte Methodik der Feldforschung oder von seinen Forschungsergebnissen. Vielmehr erfährt man von den Problemen, die dem Forscher im Feld widerfahren.
Malinowski beschreibt deutlich sein Heimweh nach dem europäischen Kulturkreis und seine Sehnsucht nach seiner Verlobten. Man erhält einen Eindruck von sich teilweise einschleichende Eintönigkeit. Malinowski flieht immer wieder aus der trobriandischen Kultur mittels der Literatur und Tagträumen. Trotz seines wissenschaftlichen Anspruchs der teilnehmenden Beobachtung gelingt es ihm nicht, sich in das Dorfleben zu integrieren. Nicht nur die Dorfbewohner betrachten sein Ansinnen, ihre Kultur zu erforschen, mit Skepsis und reagieren teilweise mit Widerwillen, sondern auch Malinowski reagiert auf den ,,Kulturschock" mit Distanzierung. Das Tagebuch ist für ihn auch ein imaginärer Gesprächspartner, der ihm hilft, seine kulturelle Identität nicht zu verlieren. In den folgenden Kapiteln sollen nun die einzelnen Probleme Malinowskis näher dargestellt werden. Diese Schwierigkeiten verstärken und bedingen sich jedoch gegenseitig, so daß oftmals ein Tagebucheintrag Zeugnis mehrerer Problemfelder ist.
II.1 Außenseitertum
Malinowski gelingt es nicht, sich in das Dorfleben zu integrieren. Er ist der Beobachter, dem die Dorfbewohner teilweise mit Argwohn begegnen. Zwar entwickelt er Freundschaften zu einzelnen Bewohnern, doch bleibt er der Forscher am Rand des Dorfes. So wird ihm nicht gestattet, an allen Bräuchen des Dorfes teilzunehmen, er stößt immer wieder auf Widerstände bei Befragungen. ,,10.März: (...) Ich fragte nach den Namen von Bäumen, Morovato, wie üblich bei Niggers in solchen Fällen, antwortete widerwillig."5,,Montag 25.3. An diesem Tag brachen die Leute aus Gumasila Nuàgasi zum kula in Boyowa auf. Sei es Heimlichtuerei oder Aberglaube, sie verbergen mir stets den Aufbruch (Mailu, Omakarana, hier).- Stand um 9Uhr auf, wie immer. Merkte nichts (tags zuvor hatte sich Kipela gewaschen und geputzt - geschah dies für einen letzten Besuch bei seiner Braut oder als Teil des kula-Programms?). Ging nach Gumawana (ärgerlich, aber nicht entmutigt). Die Frauen wie üblich versteckt. Ich sah einige aus der Ferne. Nicht allzuviel Durcheinander. Ich ging zu den bwayamas und beobachte das Verpacken der Töpferwaren. Nur Töpfe, Sago und nuya. Ich konnte sie nicht überreden, bogana sago abzugeben. Machte ein paar Aufnahmen. Sah Gumawana zum erstenmal am Vormittag. Keine Spur von Magie, Zeremonien oder Abschieden. Jungen fahren mit, sogar 2- und 3jährige Kinder. Die Boote werden zur Landzunge gestakt, wo die Segel gesetzt werden (dies sah ich nicht). Kehrte um 12.30 zurück - die Nu`agasi fuhren gerade los - ich konnte sie nicht mal photographieren. (...) Sie logen, taten heimlich und brachten mich auf. Ich bin hier immer einer Welt voller Lügen umgeben."6,,Montag, 29.4: (...) Im Grunde lebe ich außerhalb Kiriwinas, wenngleich mit starken Haß auf die Niggers."7
Malinowski fühlt sich oftmals von den Bewohnern ausgenutzt. Seine einzige Möglichkeit Informationen zu erhalten, ist die Bezahlung mit Tabak. Es sind nicht nur die kulturellen Barrieren, die eine wirkliche Integrationverhindern, sondern es liegt auch an der Rolle des Forschers für die Einwohner. Malinowski kann das Interesse der Einwohner an die Zusammenarbeit mit ihm nur durch die Bezahlung erreichen. Für die Dorfbewohner hat er keine Funktion im Dorfleben, dementsprechend gering ist die Bereitschaft, ihn daran teilhaben zu lassen. Die Frustrationen seines Forscherdaseins entladen sich in Äußerungen voller Haß gegenüber den Einwohnern. ,,Die Eingeborenen gehen mir noch immer auf die Nerven, vor allem Ginger, den ich am liebsten totschlagen würde. Ich kann diese deutschen und belgischen Kolonialgreuel verstehen."8
II.2 Eintönigkeit
Die Tagebücher zeugen auch vom wiederkehrenden Alltag des Forschers. Malinowski beschäftigt sich tagelang überhaupt nicht mit seiner Arbeit, sondern flüchtet mittels Literatur, Tagträumen und Korrespondenz mit seinen europäischen Vertrauten aus der Südsee. In den Tagebüchern finden sich mehrere Eintragungen, in denen er sich selbst anklagt und zur Selbstdisziplin aufruft. ,,Freitag, 21.12 (...) Trägheit: Ich würde gerne die Monotonie unterbrechen einen Tag frei nehmen. Dies ist eine meine größten Schwächen! Aber ich werde das Gegenteil tun: einige Routinearbeiten zu Ende bringen, das ethnographische Tagebuch, meine Zensusnotizen und meine gestrigen Eindrücke aufschreiben."9,,10.11.17: (...) ich darf keine Romane lesen, außer wenn ich krank bin oder im Zustand tiefer Depression bin; ich muß jeden Zustand vorhersehen und ihm vorbeugen. Der Zweck meines Aufenthaltes hier ist ethnologische Forschung, die meine Aufmerksamkeit ausschließlich beanspruchen sollte."10 Sein Heimweh, seine Sehnsucht nach der europäischen Zivilisation und nicht zuletzt die Sehnsucht nach seiner Verlobten und späteren Frau Elsie R. Mason (in den Tagebüchern durch das Kürzel E.R.M abgekürzt) führen zu Depressionen und Melancholie. ,,Montag, 26.11.17: (...); ich kann es nicht ertragen, mit mir allein zu sein, meine Gedanken ziehen mich auf den Boden der Welt herab. Ich bin unfähig, die Gedanken zu kontrollieren oder mich schöpferisch auf die Welt einzustellen."11
II.3 Übertriebene Beschäftigung mit sich selbst
Die von Malinowski empfundene Isolation auf Trobriand führt bei ihm zur einer gesteigerten Selbstbeobachtung. Dies drückt sich in einer übertrieben Sorge um seine Gesundheit aus, die sich bis zur Hypochondrie steigert. ,, 28.1. Montag. Es geht mir schlecht. Am Nachmittag Kollaps. Zittern. Nahm Chinin und Aspirin. Glaube allmählich der Hypothese, daß ich sterben werde. Ich bin gleichgültig. Fieber, mangelnde Vitalität; miserabler körperlicher Zustand. Kein Wunsch weiterzuleben; ich bedaure keinen Verlust. Glaube es ist ein guter Zeitpunkt zu sterben." Doch schon Tage später schreibt er: ,,Donnerstag 31.1: Viel besser. Glaube, ich werde mich erholen."12
Seine Tagebücher beinhalten immer wiederkehrend Schilderungen seiner selbstdisziplinierenden körperlichen Tätigkeiten wie Gymnastik, Rudern und Wandern. Die ,,Züchtigung" des Körpers soll sein sexuelles Begehren der Dorfbewohnerinnen zügeln. ,,28.5. (...) Die ganze Zeit hatte ich unbewußt Sehnsucht nach E.R.M.- aber trotzdem tätschelte ich skandalöserweise Nopula (...) Auf dem Heimweg im Mondschein brachte ich mich unter Kontrolle, aber ich darf mir nie wieder solche Dinge erlauben. (...) Diagnose des jetzigen Zustands: sexuelle Hysterie, verursacht durch Mangel an Bewegung."13 Malinowski leidet unter seinen wollüstigen Gedanken. Für ihn stellt die intentionslose Nacktheit einen ständigen sexuellen Reiz dar, dessen Befriedung seine viktorianische Sexualmoral ihm verbietet. Die ständige Triebunterdrückung führt nach Ansicht von Karl - Heinz Kohl bei Malinowski u.a. zur Vorurteilbildung gegenüber den Trobriandern, die Kohl als Abwehrtechnik bezeichnet: ,, ... erscheint eine weitere Abwehrtechnik, derer sich Malinowski anfangs nur zögernd, später aber immer häufiger bediente. Gemeint ist die Wiederaufrichtung der Vorurteilsstruktur. In den oben angeführten Zitaten findet sie ihren Ausdruck bereits in der Zuordnung der Sexualität der Eingeborenen zur Natursphäre: Mit der Gleichsetzung seiner Triebobjekte mit dem Tierreich (,,this litte animal") denunziert er gleichzeitig seine eigenen Triebwünsche als instinkthaft-tierische."14 Der innere Zwiespalt zwischen seinen Triebbedürfnissen und den verinnerlichten sozialen Zwängen ist mitverantwortlich für seine depressiven Gemütszustände.
III. Bewertung der Tagebücher
Für Malinowski hatten seine Tagebücher wichtige Funktionen. Zur Einleitung zum zweiten Teil des Tagebuches schrieb er: "Tag für Tag, ohne Ausnahme, werde ich die Ereignisse meines Lebens in chronologischer Reihenfolge berichten. - Jeden Tag ein Bericht über den vergangenen Tag: ein Spiegel der Ereignisse, eine moralische Bewertung, Auffinden der Triebfedern meines Lebens, ein Plan für den nächsten Tag. (...) Der Gesamtplan ist vor allem abhängig von meinem Gesundheitszustand. Jetzt muß ich mich, falls ich kräftig genug bin, meiner Arbeit weihen, der Treue zu meiner Verlobten und dem Ziel, meinem Leben wie meiner Arbeit mehr Tiefe zu geben."15 Das Tagebuch soll ein Mittel sein, sein Tagesablauf zu strukturieren. Durch den täglichen Selbstdialog hält er den Kontakt zur eigenen Sprache und Kultur aufrecht, das Tagebuchschreiben hilft ihm so bei der Bewahrung der Identität, die durch den Aufenthalt in der im fremden Kultur gefährdet ist.
Die Einleitung von Malinowski gleicht einem Schwur; das Buch wird zur moralischen Instanz, vor der er sich rechtfertigen muß. Wie schon dargelegt, findet sich in den Tagebüchern ein große Anzahl von quälerischen Selbstvorwürfen, die gleichzeitig auch als erneute Bekräftigung der gemachten Versprechen interpretiert werden können. So bemerkt auch Raymond Firth in der Einleitung: ,, Im späteren Teil aber sah er darin ein Werkzeug und einen Bezugspunkt; er sah darin eine Möglichkeit, seine Persönlichkeit zu steuern und zu korrigieren."16
Die Übergriffe auf die Dorfbewohner, die häufig abfällige Art, in der sie beschreibt, können zu dem Schluß verleiten, daß Malinowskis Anspruch der teilnehmenden Beobachtung gescheitert ist. Auch Karl-Heinz Kohl sieht einen starken Widerspruch zwischen den von Malinowski selbst veröffentlichten Schriften und seinen Tagebüchern. ,,Malinowski hat später wiederholt auf seine intime Vertrautheit mit dem Leben der Eingeborenen verwiesen. Aus den vorliegenden Aufzeichnungen scheint jedoch hervorzugehen, daß Malinowskis Unternehmen (...) gerade in dieser Hinsicht gescheitert angesehen werden kann. Denn der Leser, der sich aus seinem Feldtagebuch Aufschluß über den tatsächlichen Charakter seiner Beziehungen zu den Eingeborenen, über den Grad seiner wirklichen Vertrautheit mit den eingeborenen Informanten erwartet, wird unweigerlich enttäuscht."17 In der Tat kreisen Malinowskis Gedanken in den Tagebüchern hauptsächlich um Personen aus seinem Kulturkreis und um seinen eigenen Gemütszustand und seine körperliche Verfassung. Die beschriebenen Kontakte zu den Trobriandern sind von Ärger und Aggression begleitet, Beschreibungen tieferer Verbindungen fehlen.
Ein emphatisches Verständnis der fremden Weltsicht ist dem Begründer der teilnehmenden Beobachtung nur zum Teil geglückt. Auch er kann sich nicht von dem Wert- und Deutungsmuster seines heimischen Kulturkreises lösen. Die innerliche Distanzierung von den Einwohnern ist einerseits Reaktion auf die immer wieder mißglückten Versuche der Annäherung, anderseits dienen ihm die Vorurteile als Selbstschutz, um nicht tiefer in einen kulturellen Identitätskonflikt zu geraten.
Das Leben in der ihm fremden Welt führt bei Malinowski zu schweren seelischen Konflikten. Diese Erkenntnis schmälert aber nicht den Wert seines wissenschaftlichen Werkes. Sie verdeutlichen jedoch Reaktionen des Forschers im Feld auf die ihm fremde Umwelt.
IV. Exkurs: Die Ethnopsychoanalyse
Die überraschende Entdeckung, daß Malinowski die Prinzipien der teilnehmenden Beobachtung nicht verwirklichen konnte, führte zu einer methodologischen Krise der Ethnologie. Die Ethnopsychoanalyse ist sicher keine direkte Reaktion auf die Veröffentlichung der Tagebücher von Malinowski, da der Ursprung der Methode zeitlich viel früher liegt, doch das Scheitern des eigenen Anspruches von Malinowski ließ die Suche nach anderen Feldforschungsmethoden dringlicher erscheinen.
C. Maier, selbst Psychoanalytiker und mit der Methode der Ethnopsychoanalyse vertraut, hat sich bei seinen Untersuchungen auf Trobriand die Methode zu Nutze gemacht. Daher werden im diesem Kapitel die wichtigsten Grundzüge der Forschungsrichtung vorgestellt. Die Ethnopsychoanalyse untersucht das Verhältnis zwischen Individuums und Gesellschaft, indem sie die Wirkungen der Gesellschaft auf das Seelenleben des Individuum untersucht. Sie benutzt dabei die Untersuchungsmethoden der Psychoanalyse. Sie integriert die psychoanalytische Methode mit der ethnologischen Forschung.18
Sigmund Freud hat mit seiner Schrift ,,Totem und Tabu" von 1912/13, die Kontroverse zwischen Ethnologie und Psychoanalyse eröffnet. Ergebnisse der Psychoanalyse sollten auf dem Gebiet der Ethnologie übertragen werden: ,,Dabei ging es ... also um die Idee, die aus der Psychoanalyse einzelner Individuen erschlossene Bedeutung regelmäßig auftretender und unbewußt wirkender Konstellationen wie dem ,,Ödipuskomplex" auf kulturelle, historische und ethnologische Phänomene im Rahmen eines universalistischen Konzepts zu übertragen."19
In den 20er Jahren waren die Auseinandersetzungen mit den Ergebnissen Malinowskis für die Entwicklung der Ethnopsychoanalyse wichtig. Es ging u.a. um die Frage, ob das Konzept des Ödipuskomplex auch auf andere Kulturen übertragbar ist. Bei den Trobriandern übernimmt der Onkel die Rolle des Vaters, der Konflikt spielt sich also zwischen dem Kind und dem Onkel ab. Der amerikanische Ethnologe Kroeber kam daher zur Feststellung, daß der Ödipuskomplex in dieser Kultur nicht vorkomme. Führende Psychoanalytiker entgegneten dieser Sichtweise, daß nicht die realen Familienverhältnisse ausschlaggebend für diesen Konflikt sind, sondern deren phantastische Verarbeitung bei dem Kind. Nicht unbedingt der leibliche Vater ist der Konfliktpartner, sondern die väterliche Figur.20
In den 50er und 60er Jahren wurde die psychoanalytische Technik erstmals als Forschungsmethode angewandt.
Durch die Untersuchungen der Schweizer Psychoanalytiker Paul Parin, Fritz Morgenthaler und Goldy Parin-Mathèy bei den Dogon und Agni in Westafrika in den 50er und 60er Jahren gelang der Nachweis, daß es möglich ist, mit den Untersuchungs- und Analysemethoden der Psychoanalyse auch Menschen außerhalb des europäischen Kulturkreises zu verstehen.21 Als wichtigste Ergebnis gilt der Nachweis, daß das menschliche Verhalten durch die Gesellschaft bestimmt wird. Biologische Aspekte treten als Handlungsmotiv gegenüber den kulturellen Einflüssen zurück. Die Erkenntnisse der Ethnopsychoanalyse führten auch zur einer Weiterentwicklung der Psychoanalyse für die Untersuchung der europäischen Kultur. Georges Devereux hat durch seine Arbeit ebenfalls zur Ausarbeitung der ethnopsychoanalytischen Methode beigetragen. Er hob besonders die Subjektivität des Forschers hervor. Es besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Analysierenden und dem Analysand. Diese Erkenntnis muß dem Forscher bewußt sein und in seine Arbeit integriert werden. Nicht die Untersuchung des Objekts, sondern die des Beobachters eröffnet den Zugang zum Wesen der Beobachtungssituation. Alle Daten von Verhaltenswissenschaften sind Phänomene, die durch die Beobachtungssituation einstehen. Der Forscher muß sich bewußt sein ,, ... ; daß auch jedes Rattenexperiment ein am Beobachter vorgenommenes Experiment ist."22
Die ethnopysychoanalytische Erkenntnisgewinnung basiert auf der Aufarbeitung des durch Wechselwirkungen gekennzeichneten Prozesses zwischen Beobachter und Gesprächspartner. Dieser Prozeß beinhaltet auch die Auseinandersetzung des Forschers mit der fremden und der eigenen Kultur und Gesellschaft, sowie seiner Rolle als Wissenschaftler.23
V. Das Leuchten der Papaya
C. Maier, der in leitender Funktion an einem psychiatrischen Institut in der Schweiz tätig war, war 1989 in Port Morebsby, um dort schwer gestörte Patienten zu behandeln. Durch seine Kenntnisse der Schriften von Malinowski war er von der trobriandischen Kultur fasziniert. Im Rahmen seines Aufenthaltes in Papua-Neuguinea macht er ein paar Tage Urlaub auf den Inseln. Eines Nachts traten einige Dorfbewohner mit dem Wunsch an ihn heran, er solle ihnen den modernen Fußball beibringen, damit sie wie der Fußballstar Pelé spielen könnten. Maier versprach wiederzukommen, um ihren Wunsch zu erfüllen. Er, der selbst Amateurfußballer war, bereitete sich zwei Jahre auf die Rückkunft vor, indem er sich die modernen Fußballtrainingsmethoden aneignete.
C. Maier war also auf Einladung des Dorfes da, was für die Forschungssituation ein wesentlicher Vorteil war. Er konnte sein Wissen im Tausch für Informationen anbieten. Maier war nicht gezwungen, ein passive Rolle im Dorfgeschehen einzunehmen, sondern übernahm eine wichtige Funktion für das Dorf. Dies gab ihm die Möglichkeit, tiefere Einblicke in die Dorfgesellschaft zu erhalten. Zwar behält auch er den ,,Blick des Fremden", doch über das gemeinsame Interesse des Fußballs hatte er die Möglichkeit, am kulturellen Geschehen teilzunehmen.24
Die folgende Textstelle gibt Aufschluß über die Motive von Maiers Forschungsreise und zeigt deutlich seinen psychoanalytischen Ansatz: ,,`Was ist wirklich der Grund, daß Du zu uns kommst ?` wollte er wissen. ,Ich möchte verstehen, wie ihr lebt, wie ihr denkt und wie ihr fühlt. Deshalb bin ich vor allem gekommen`(...)Die Papaya ist eine große, sehr wohlschmeckende goldgelbe Frucht. Die Dorfbewohner von Okaiboma sagen, daß sie nachts einen goldenen Schein verbreite, Aber die Trobriander wissen auch, daß es nicht ,,stimmt", wie mir Bagidou einmal sagte, ,, der Satz bedeutet etwas anderes". Bagidou hat mir jedoch nie sagen können, was dieser Satz für ihn genau für ihn bedeutete. Als Gilayviyaka geendet hatte, nickte ich spontan, denn ich fühlte mich von ihm verstanden und hatte gleichzeitig das Gefühl, von ihm beschenkt worden zu sein. Mein erster Gedanke war, daß dieser Satz die Begegnung mit dem Unbekannten in einem poetischen Bild zusammenfaßt. Die Nacht steht für das Fremde und auch für das Unbewußte. Wenn man sich darauf einläßt, kann man da und dort etwas aufscheinen sehen und so der Dunkelheit entreißen. Aber es ist und bleibt Nacht, und eine klare, alles erhellende Erkenntnis wird man nicht finden können. Und die Papaya leuchtet nicht wirklich, es ist der Betrachter, der sie leuchten sieht: Es kommt auf das subjektive Empfinden des Beobachters an. (...) Aber ist, ungeachtet dessen, Wahrnehmung nicht immer ein Vorgang, der sich zunächst in uns selbst abspielt, indem etwas in uns verändert, etwas bewirkt wird, worauf wir uns diese Wirkung als von außen ursächlich bedingt vorstellen?"25 Das wirkliche Erkennen der Wirklichkeit ist eine Illusion, der Forscher erkennt nur durch seine Subjektivität. Die Forschungssituation hat auch auf den Forscher Rückwirkungen. Der Beobachter muß sich der Subjektivität seiner Beobachtung bewußt sein und sie thematisieren, um dem ,,wirklichen Erkennen" näher zu kommen. Dadurch, daß C. Maier durch seine Tätigkeit als Trainer in der Lage ist, sein Wissen zum Austausch anzubieten, steht er in einem anderen Verhältnis zu den Einwohnern als Malinowski 75 Jahre zuvor. Die Gespräche Maiers mit den Trobriandern fanden somit ,,auf einer Ebene" statt, die Distanz, die sich durch die Untersuchungssituation zwangsläufig zwischen Forscher und Untersuchenden aufbaut, wird so reduziert. Paul Parin und C. Maier glauben, daß dieses Austauschverhältnis besonders wichtig war, um einen Blick von ,,innen" auf die trobiandrische Gesellschaft zu erhalten. Das Prinzip des ,,kula" ist nach ihrer Ansicht nicht nur ein kompliziertes Austauschverhältnis zwischen den Dörfern, sondern als Handlungsprinzip in den Individuen auf Trobriand fest verankert. ,,Die Gesprächspartner boten mir etwas an, Informationen oder Erzählungen, und wollten dann als Gegenleistung etwas von mir erhalten. Diese Art der Kommunikation im Dienste eines Austausches steht ganz im Einklang mit der Tradition, wie sie im Kulaaustausch ausgeübt wird. So gab es bisweilen gar nicht viel hineinzulesen oder zu deuten, sondern nur auszutauschen."26 Maier bietet jedoch nicht nur sein Fußballwissen als Tausch an, sondern gibt bereitwillig Auskunft über sein Leben in Europa. ,,Schließlich waren wir wieder beim Klima und beim Gemüse - die typische Frage, die mir immer wieder begegnete: `So ist es bei uns im Dorf, wie ist es denn in deiner Heimat?`- angelangt"27,,Er wollte genau wissen, wie es in einer Wohnung dort aussehe, wie man im Winter heize, meine eigenen Gedanken ,So sieht es also bei ihm in der Hütte aus` wiederholend."28
Christian Maier vorrangiges Forschungsziel ist nicht die Untersuchung der sozialen Strukturen, sondern die Auswirkungen der trobriandischen Gesellschaft auf ihre Individuen. Dieses von Malinowski abweichende Forschungsinteresse erklärt sich nicht nur aus dem methologischen Unterschied des ethnopsychoanalytischen Forschungsansatzes, sondern auch durch die Reihenfolge und den zeitlichen Abstand beider Berichte.
Maiers Bericht baut auf den Kenntnissen Malinowskis und späteren Forschungen über die trobriandische Gesellschaft auf. Die Strukturen sind dargelegt; die bei Malinowski noch bestehende Sprachbarriere ist in der Form nicht mehr vorhanden. Erst dieser Sachverhalt ermöglicht die Reduktion des Forschungsinteresses auf eine psychoanalytische Fragestellung. Maiers Reisebericht wendet sich daher auch in erster Linie an den vorinformierten Leser, dem z.B. das Prinzip des kula-Austausches bekannt ist. Erst so lassen sich die gemachten Beobachtungen einordnen. ,,Zum Mittagessen, das ich heute mit den Frauen des Großen Hauses und Ilakaise, Monewa, ihrem Mann, und Mitaka zusammen einnahm, brachte ich meine Bananen mit. Kalogusas kleiner Sohn sah sie begehrlich an, worauf ich ihm eine gab. Über Monewa kam sie bei ihm an. Ilakaises Reaktion, befremdete mich, denn sie drohte dem Kleinen, angestrengt lächelnd, daß ich ihm eine Spritze geben würde. Danach forderte sie, er solle erst den Yams und die Süßkartoffeln essen und danach die Banane. Widerspruchslos wandte sich der Kleine dem Gekochten zu. Als er aufgegessen hatte, begann er die Banane zu schälen. Er aß sie aber nicht, sondern gab die Hälfte Monewa und (...) reichte Mitakata die andere Hälfte der Banane. Der Kleine verzichtete unter dem Eindruck der Drohung auf die Banane, und sein Wunsch wurde von dem bei den Trobriandern so hoch besetzten Verteilen abgelöst. Ich fühlte mich, als hätte ich Einblick in die Wurzeln des kula und anderer Verteilsysteme erhalten."29
Maier thematisiert immer wieder die Gefühle und Empfindungen, die die Gespräche mit den Einwohnern und sein Aufenthalt im Dorf bei ihm hervorrufen. Er ist sich der Wechselwirkungen bewußt; gemäß seines ethnopsychoanalytischen Ansatzes ist ihre Thematisierung unverzichtbarer Bestandteil seiner Arbeit. Er, der Forscher, ist Teil seiner Forschung. ,,Ich dachte an meine Verleugnung der Schwangerschaft seiner Mutter. Und mir wurde mit einem Mal der Grund dafür klar. Ich hatte noch etwas anderes verleugnet, nämlich den Kontrast zwischen der Fremde und meinen Leben in Europa.(...) Das ,Übersehen` der Schwangerschaft von Bagidous Mutter gehörte in denselben Zusammenhang, denn auch Bagidou plante, in die Fremde zu gehen, und mußte seine Ängste vor der Fremde verleugnen. Ich hatte ihn nie von Bedenken sprechen hören. Und doch mußte für ihn seine Abreise ein mindestens so großer Schritt sein, wie es für mich die Reise auf die Trobriandinseln war. Die Verleugnung der Schwangerschaft war auf diesem Hintergrund Ausdruck einer tiefen, unbewußten Identifikation mit Bagidou. Mit der Identifizierung war eine Nähe zwischen uns geschaffen, die für mich auf andere Weise in der Beziehung zu Bagidou konfliktreicher gewesen wäre. Aber auch Bagidou hatte sich mir zu identifizieren versucht, mich zum Vorbild genommen, war ich doch jemand, der den Gang in die unbekannte Ferne gewagt hatte. Wenn ich nun an unsere Gespräche und Begegnungen zurückdachte, dann wurde mir vieles klarer, insbesondere auch, daß die Hexenangst, aber nicht nur seine, für die Angst vor der Fremde steht. Meine ängstliche Befangenheit in der Fremde hatte mich diese Zusammenhänge nicht erkennen lassen."30
Doch trotz seines Bemühens eines intensiveren Dialogs sind Maier die Probleme, die Malinowski hatte, nicht gänzlich fremd.
Auch er bleibt letztendlich ,,der Fremde", der nicht bei allen Dorfaktivitäten gern gesehen wird.
So spricht Maier seine Enttäuschung aus, daß die Dorfbewohner ihn nicht auf die Feier nach dem Fußballturnier einluden, obwohl er dabei eine gewichtige Rolle als Trainer und Spieler hatte: ,,Ich war verstimmt, enttäuscht von Nayombei und fühlte mich - wieder einmal - ausgeschlossen."31 Auch wird er von den Erwachsenen gegenüber den Kindern als dimdim bezeichnet; er übernimmt damit die Rolle die der schwarze Mann oder der Knecht Ruprecht in der Erziehung im europäischen Kulturkreis hatte bzw. immer noch hat. Trotz der unbestreitbaren Freundschaften, die Maier bilden kann, fühlt er sich manchmal übervorteilt. Doch anders als Malinowski versucht er, das Verhalten der Bewohner zu analysieren und nicht nach europäischen Wertvorstellungen zu richten: ,,Diese Zahlen waren für einen Einheimischen unglaublich hoch. Ich ärgerte mich, daß mich Yowana an der Nase herumführte. Ich fühlte mich ausgenützt, bis mir wieder einfiel, daß ich ihm das Geld ja geschenkt hatte. Sein Kassensturz war lediglich seine Art mir mitzuteilen, daß wir einen vollständigen Austausch vollzogen und daß nichts übrig blieb, keiner dem anderen etwas schuldete, unsere Wünsche ausgeglichen waren, daß er seine Mühe hineingesteckt, und ich mein Geld gegeben hatte, und - das war das Wichtigste - daß es nun für alle genügend zu essen gab. Ich hatte einen Moment europäisch gedacht, ihn deshalb nicht verstanden und mich betrogen gefühlt."32
Das Heimweh nach Europa drückt sich bei Maier in der Lust auf das europäische Essen aus. ,,Ich mußte ständig an europäische Nahrungsmittel denken und bekam einen richtigen Heißhunger. Natürlich stellte ich mir ein Steak vor, das vor meinen Augen auf und ab tanzte, auch Salat, Schokolade, einen deftigen Braten, Grießbrei, Brötchen mit Aprikosenmarmelade. Die Vorstellungen waren zeitweise so plastisch, daß ich Gespräche vermeiden mußte, weil der starke Speichelfluß, den die Bilder auslösten, beim Sprechen sich als empfindlich störend erwies."33
Es finden sich, im Gegensatz zu Malinowskis Tagebüchern, jedoch nur selten Passagen, in denen Maier seine Sehnsucht nach Europa ausdrückt. Maier schrieb seinen Bericht mit der Intention der Veröffentlichung. Obwohl er auch über seine eigenen Empfindungen, Ängste und Träume schreibt, traf er doch letztendlich selbst die Entscheidung, was er einer Öffentlichkeit preisgibt. So bemerkt Maier, nachdem er über sein durch den Aufenthalt reduziertes Hygieneempfinden berichtete: ,,Über andere Veränderungen ist es besser, nichts niederzuschreiben, wollte ich nicht in den Ruf gelangen, absonderlich zu sein."34
VI. Schlußbemerkungen
Zwischen den Forschungsreisen von Malinowski und C. Maier liegt eine Zeitspanne von 75 Jahren. Dieser Umstand sowie die unterschiedliche Form der Berichte müssen bei einer Beurteilung mit einbezogen werden.
1. Unterschiedlichkeit der Adressaten der Berichte
Malinowski Tagebücher hatten für ihn die Funktion der moralischen Instanz und des Gesprächspartners, der ihm hilft, die eigene kulturelle Identität zu bewahren. Das Tagebuchschreiben ist für ihn Mittel, seinen Alltag zu strukturieren. Die Aggressionen und Wutausbrüche gegenüber den Eingeborenen dürfen nicht überbewertet werden, denn dem Tagebuch kommt auch eine Ventilfunktion zu. Auch Personen aus Europa, sowie seine Verlobte sind oftmals Ziel seiner Wutausbrüche.
Zudem ist es kritisch zu hinterfragen, ob die vom Autor nicht zur Veröffentlichung gedachten Tagebuchaufzeichnungen ein vollständiges Bild über seine Gefühle und sein Alltag geben. Man erhält nur einen fragmentarischen Einblick, der stark beeinflußt ist von der Gefühlslage im Augenblick des Schreibens. Malinowski wird unterstellt, daß er eine wirkliche Verbundenheit mit den Einwohnern nicht hatte, da das Dorfleben nur geringen Widerhall in den persönlichen Aufzeichnungen hat. Dies bleibt jedoch nur eine Mutmaßung. Durch seinen Feldforschungsbericht setzte sich Malinowski intensiv und nahezu tagtäglich mit der trobriandischen Kultur auseinander. Seine Haßtriaden in den Tagebüchern könnten sich auch dadurch erklären, daß seine aufkommenden negativen Gefühle in den offiziellen Berichten keinen Platz hatten und sich daher vermehrt in den Tagebüchern wiederfinden. Maiers Reisebericht hingegen wurde von Anfang an für eine Leserschaft konzipiert. Der Erzähler wägt die Wirkungen seiner Schilderungen im Vorfeld ab. Erlebnisse, die von einer zu intimen Natur sind, spart er aus, was er auch offen zugibt. Obwohl ,,Das Leuchten der Papaya" auch die Gefühle des Autors zum Inhalt hat, hat es trotzdem nicht die schonungslose Offenheit eines persönlichen Tagebuches, das ohne die Einwilligung des Schreibers veröffentlicht wurde.
2. Die Berichte sind Zeugen unterschiedlicher Zeitepochen
Malinowski betrieb seine Feldforschungen Anfang des 20. Jahrhundert, im Zeitalter der Kolonialisierung und Missionierung. Dies muß bei einer Bewertung berücksichtigt werden. Malinowski kann sich zwar nicht vollkommen aus den Denkmustern seines europäischen Kulturkreises lösen, doch waren seine wissenschaftliche Einstellung und sein Engagement für die fremde Kultur revolutionär. Sein Konzept der teilnehmenden Beobachtung war wegweisend für die wissenschaftliche Entwicklung der Ethnologie.
Die Entfernung zu seiner Heimat empfindet Malinowski als existenzbedrohend. Auch plagen ihn Schuldgefühle, daß er in der Südsee seine Forschungen betreibt, während in seiner Heimat Krieg herrscht.
Für C. Maier war der Aufenthalt auf Trobriand nicht solch ein ,,Kulturschock". Durch seine Kenntnisse der Schriften von Malinowski und anderen Forschern kannte er schon Aufbau und Funktionsweise dieser Kultur.
Bis 1975 standen die Trobriand-Inseln als Mandat der Vereinten Nationen unter Vormundschaft der australischen Regierung, die ihre Aufgabe darin sah, die dortige Kultur zu schützen, indem sie sie von der Außenwelt abschirmte. Erst als die Inseln dem Staat Papua- Neuguinea zugeteilt wurden, ist dieser künstliche Vorhang gefallen.35 Obwohl die trobriandische Kultur weitgehend erhalten blieb, ist sie nicht von den Einflüssen der Außenwelt unberührt geblieben, so daß eine Integration Maiers sich als einfacher erwies. Maier profitierte von der verbesserten Zugänglichkeit der Inseln.
3. Maier war im Gegensatz zu Malinowski eingeladener Gast
Für die Forschungssituation war es ein Glücksfall, daß der Besuch Maiers auf Wunsch der Dorfbewohner erfolgte. Durch den Fußball gab es ein gemeinsames Interesse, eine Brücke zur besseren Verständigung zwischen dem Psychoanalytiker und den Trobriandern. Durch seine Funktion als Fußballtrainer nahm Maier kurzzeitig eine wichtige soziale Rolle im Dorf ein. Er war damit auch Zielpunkt des Interesses der Bewohner, was für Maiers Forschung sehr von Vorteil war. ,,Für einen Forscher der Ethnopsychoanalyse kann es keine bessere Gelegenheit geben, mit Menschen einer fremden Ethnie in den intensiven Dialog einzutreten, als wenn sie seine Anwesenheit wünschen und er für das, was er an Erfahrungen aus ihrer Gemeinschaft mitnehmen wird, im Austausch selber etwas Wertvolles bringen kann, in diesem Fall: Fußballtraining."36
Man kann Malinowski wegen seiner Tagebücher nicht verurteilen. Trotzdem zeigen sie anschaulich die Probleme, mit denen er konfrontiert war. Malinowskis eingeschränktes Verständnis für die fremde Kultur erklärt sich auch durch die zeitspezifischen Schwierigkeiten, denen er ausgesetzt war, und die in dieser Form heute nicht mehr existieren. Maier zeigt deutlich einen anderen Umgang mit den Einflüssen einer anderen Kultur. Er geht offensiv mit seinen Problemen um und hinterfragt sein eigenes Erleben. Das ermöglicht den konstruktiven Umgang mit seinen Ängsten, Frustrationen und Verärgerungen. Nicht zuletzt durch seinen ethnopsychoanalytischen Ansatz gelingt es ihm scheinbar besser, sich in die fremde Kultur einzufügen und seine eurozentristische Sichtweise zu überwinden. ,,Europäisches Festhalten von Besitz, die abendländische Art, Gefühle zu unterdrücken und zu verdrängen, hätten ihn aus der Gemeinschaft ausgeschlossen."37
VII. Literaturverzeichnis
Beyer, Kathrin, Ethnopsychoanalyse, in: Siegfried Grubitzsch (Hg.), Grundbegriffe der Psychologie, Hamburg, 1990, S.149-151
Hauschild, Thomas , Ethno-Psychoanalyse: Symboltheorien an der Grenze zweier Wissenschaften, in: Stagl / Schmied-Kowazik (Hg.): Grundfragen der Ethnologie, 1993, S. 151-169
Heinrichs, Hans-Jürgen, Über Ethnopsychoanalyse, Ethnopsychiatrie und Ethno- Hermeneutik, in: Stagl / Schmied-Kowazik (Hg.): Grundfragen der Ethnologie, 1993, S.169-192
Kohl, Karl-Heinz , Exotik als Beruf, Wiesbaden, 1979
Maier, Christian, Das Leuchten der Papaya, Hamburg, 1996
Malinwoska, Valetta, Vorwort, in: Bronislaw Malinowski, Ein Tagebuch im strikten Sinn des Wortes: Neuguinea 1914-1918, Frankfurt/Main, 1985, S.1-4
Malinowski, Bronislaw, Ein Tagebuch im strikten Sinn des Wortes: Neuguinea 1914-1918, Frankfurt/Main, 1985
Parin, Paul, Vorwort, in: Christian Maier: Das Leuchten der Papaya, Hamburg, 1996, S.5-12
Parin, Paul, Die Weiß en denken zuviel, München, 1960
Parin, Paul, Zu viele Teufel im Land, Frankfurt/Main, 1985
Parin/Morgenthaler/Parin-Matthèy, Fürchte Deinen Nächsten wie Dich selbst, Frankfurt/Main, 1971
Parin/Parin-Matthèy, Subjekt im Widerspruch, Frankfurt/Main, 1986
Reichmayr, Johannes, Einführung in die Ethnopsychoanalyse - Geschichte, Theorien und Methoden, Frankfurt/Main, 1995
[...]
1 Raymond Firth: ,,Einleitung" in: Bronislaw Malinowski: ,,Ein Tagebuch im strikten Sinn des Wortes: Neuguinea 1914-1918", Frankfurt/Main, 1985, S.7
2 Vgl. Raymond Firth, a.a.O., S.7
3 Karl-Heinz Kohl sieht in dem von Malinowski gebrauchten Begriff eine gewillte Abwertung der Eingeborenen. Er sieht seine These dadurch bestärkt, daß Malinowski den Begriff besonders häufig am Ende seines Forschungsaufenthalts benutzt, was Kohl auf u.a. die gesteigerte Frustration Malinowskis als Reaktion auf sein Außenseitertum auf Trobriand zurückführt. Vgl. Karl-Heinz Kohl: ,,Exotik als Beruf", Wiesbaden, 1979, S.27
4 vgl. Valetta Malinowska: ,,Vorwort" in: Bronislaw Malinowski, a.a.O., S.2
5 Bronislaw Malinowski, a.a.O., S.194
6 ebenda, S.206
7 ebenda, S.232
8 ebenda, S.244
9 Bronislaw Malinowski, a.a.O., S.145
10 ebenda, S.103
11 ebenda, S.120
12 ebenda, S.176
13 ebenda, S.246
14 Karl-Heinz Kohl: ,,Exotik als Beruf", Wiesbaden, 1979, S. 26
15 Bronislaw Malinowski, a.a.O., S. 97
16 vgl. Raymond Firth, a.a.O., S. 10
17 Karl-Heinz Kohl, a.a.O., S.23
18 vgl. Paul Parin: ,,Vorwort", in: Christian Maier: ,,Das Leuchten der Papaya", Hamburg, 1996, S.6
19 Kathrin Beyer: ,,Ethnopsychoanalyse" in: Siegfried Grubitzsch (Hg.) ,,Grundbegriffe der Psychologie", Hamburg, 1990, S.148
20 vgl. Paul Parin: ,,Vorwort", a.a.O., S.6
21 die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind nachzulesen in: Paul Parin/Fritz Morgenthaler/Goldy Parin-Mathèy: ,,Die Weißen denken zuviel", Frankfurt/Main, 1989 oder zusammengefaßt in Johannes Reichmayr: ,,Einführung in die Ethnopsychoanalyse",Frankfurt/Main, 1995, S.99-123
22 Thomas Hauschild: ,,Ethno-Psychoanalyse - Symboltheorie an der Grenze zweier Wissenschaften", in: Stagl / Schmied-Kowazik (Hg.): ,,Grundfragen der Ethnologie", 1993, S.184
23 vgl. Kathrin Beyer: ,,Ethnopsychoanalyse" in: Siegfried Grubitzsch (Hg.) ,,Grundbegriffe der Psychologie", Hamburg, 1990, S.149
24 vgl. Paul Parin: ,,Vorwort", a.a.O., S.9
25 Christian Maier: ,,Das Leuchten der Papaya", Hamburg, 1996, S.19-20
26 ebenda, S.69
27 ebenda, S.67
28 Christian Maier, a.a.O., S.92
29 ebenda, S.200-201
30 ebenda, S.103-104
31 Christian Maier, a.a.O., S.192
32 ebenda, S.150-151
33 ebenda, S.151
34 Christian Maier, a.a.O., S.199
35 vgl. Paul Parin, a.a.O., S. 7
36 ebenda, S.9
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Textauszug?
Dieser Textauszug bietet eine vergleichende Analyse zweier Feldforschungsberichte aus der trobriandischen Gesellschaft. Er vergleicht Bronislaw Malinowskis Tagebücher, die posthum veröffentlicht wurden, mit Christian Maiers "Das Leuchten der Papaya". Der Text untersucht die Herausforderungen, denen sich die Forscher im Feld gegenübersahen, und die unterschiedlichen methodologischen Ansätze, die sie verwendeten, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Ethnopsychoanalyse liegt.
Was sind die Hauptthemen in Malinowskis Tagebüchern laut diesem Auszug?
Laut diesem Auszug umfassen die Hauptthemen in Malinowskis Tagebüchern Außenseitertum, Eintönigkeit und eine übertriebene Beschäftigung mit sich selbst. Es wird dargestellt, wie Malinowski Schwierigkeiten hatte, sich in das Dorfleben zu integrieren, Heimweh und Depressionen erlebte und mit seinen eigenen Trieben und Vorurteilen kämpfte.
Was ist Ethnopsychoanalyse und wie unterscheidet sie sich von traditionellen ethnologischen Methoden?
Die Ethnopsychoanalyse ist ein Forschungsansatz, der psychoanalytische Methoden in die ethnologische Forschung integriert. Sie untersucht das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft, indem sie die Auswirkungen der Gesellschaft auf das Seelenleben des Individuums analysiert. Im Gegensatz zu traditionellen Methoden berücksichtigt die Ethnopsychoanalyse die Subjektivität des Forschers und die Wechselwirkungen zwischen dem Analysierenden und dem Analysand.
Wie unterscheidet sich Christian Maiers Ansatz von dem von Malinowski?
Christian Maier verwendet einen ethnopsychoanalytischen Ansatz, der die psychischen Auswirkungen der Kultur auf den Einzelnen untersucht. Er ist sich der Subjektivität seiner Erkenntnisse bewusst und thematisiert die Auswirkungen des Feldaufenthalts auf ihn selbst. Er bot sein Wissen im Fussball im Austausch für Informationen an und baute Freundschaften. Im Gegensatz zu Malinowski, der mit dem Problem der Integration konfrontiert war, wurde Maier von der Dorfgemeinschaft eingeladen und hatte eine soziale Funktion als Fussballtrainer. Dies ermöglichte ihm tiefere Einblicke und reduzierte die Distanz zwischen Forscher und Untersuchenden.
Welche Einschränkungen gelten beim Vergleich der beiden Feldforschungserfahrungen?
Der Vergleich der beiden Feldforschungserfahrungen muss unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Zeitepochen und Adressaten erfolgen. Malinowski schrieb seine Tagebücher ohne die Absicht einer Veröffentlichung, während Maier seinen Reisebericht für eine Leserschaft konzipierte. Darüber hinaus waren die Trobriand-Inseln zur Zeit von Malinowskis Forschung stark von der Kolonialisierung geprägt, während Maiers Aufenthalt in einer Zeit des größeren kulturellen Austauschs stattfand.
Welche Rolle spielte das Konzept des "Kula" in Maiers Forschung?
Maier glaubte, dass das Prinzip des "Kula" (ein kompliziertes Austauschverhältnis zwischen Dörfern) nicht nur eine soziale Struktur ist, sondern als Handlungsprinzip in den Individuen auf Trobriand verankert ist. Seine Gespräche fanden "auf einer Ebene" statt, weil er sein Wissen anbot und nicht nur Informationen erhielt.
Was waren die Hauptmotive von Christian Maier, der die Trobriand Inseln besuchte?
Christian Maier war eingeladen worden, den Einheimischen modernen Fußball beizubringen, aber sein Hauptmotiv war, "zu verstehen, wie ihr lebt, wie ihr denkt und wie ihr fühlt." Er glaubte, dass die Begegnung mit dem Unbekannten in einem poetischen Bild zusammengefasst ist: der Schein der Papaya in der Nacht, der vom Betrachter wahrgenommen wird.
- Citation du texte
- Christian Hieff (Auteur), 2000, Das Leuchten der Papaya, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98134