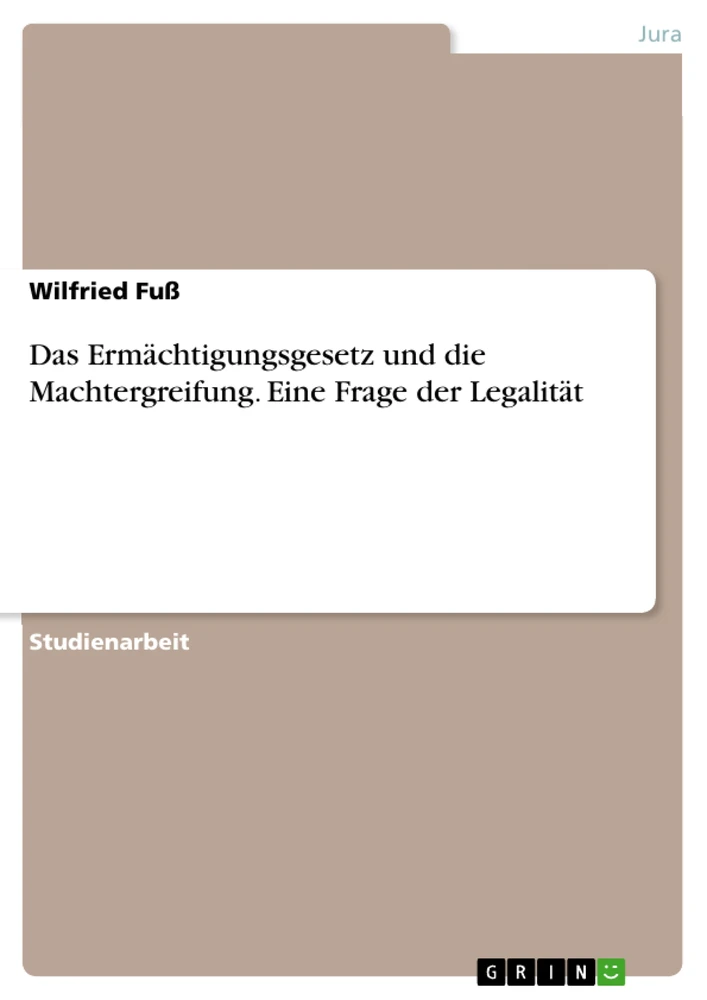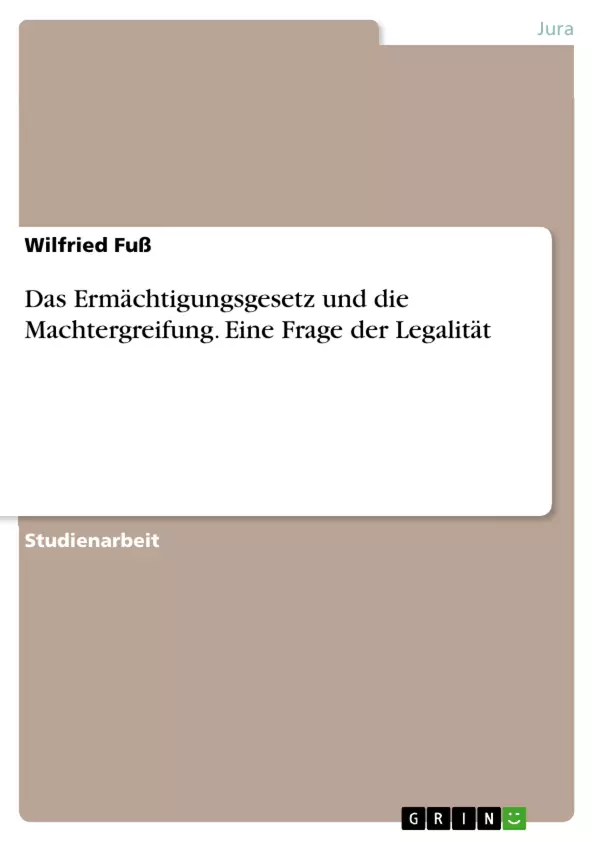Nach dem gescheiterten Putschversuch im November 1923 legte Hitler großen Wert darauf, die Macht auf „legalem“ Wege zu erlangen. Ob ihm das mithilfe des Ermächtigungsgesetzes gelang, soll nach Beleuchtung der historischen Situation erörtert werden.
Hitler war noch nicht zwei Monate Reichskanzler und schon auf dem besten Wege, eine tiefgreifende Staats- und Verfassungsreform durchzusetzen. Nach der Reichstagsbrandverordnung, die zahlreiche Grundfreiheiten außer Kraft setzte, wollte sich die Regierung eine eigene Gesetzgebungskompetenz vom Parlament einräumen lassen. Dafür musste der Reichstag das sogenannte Ermächtigungsgesetz verabschieden. „Ich glaube […], dass das Recht allein leider noch nicht genügt, - man muss auch die Macht besitzen.“ Dies sagte Hitler vor dem Reichstag in seiner Rede zum Ermächtigungsgesetz und warf den Sozialdemokraten mangelnde Führung in den Jahren ihrer Regierungszeit vor.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Quellengattung
- C. Gegenstand
- D. Verfasser
- E. Historischer Kontext
- I. REICHSTAG
- II. HITLER WIRD REICHSKANZLER
- 1. Zentrum
- 2. Kommunistische Partei
- F. Juristischer Kontext
- I. HERSTELLUNG DER BESCHLUSSFÄHIGKEIT
- II. HERSTELLUNG DER VERFASSUNGSÄNDERNDEN MEHRHEIT
- G. Bewertung
- I. LEGALITÄT DES ERMÄCHTIGUNGSGESETZES
- 1. Materielle Rechtmäßigkeit
- 2. Formelle Rechtmäßigkeit
- a) Änderung der Geschäftsordnung
- b) Abstimmung im Reichstag
- c) Behandlung im Reichsrat
- d) Vorzeitiges Außerkrafttreten
- II. BEDEUTUNG DER LEGALITÄT
- III. WIRKUNGEN DES ERMÄCHTIGUNGSGESETZES
- H. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Legalität des Ermächtigungsgesetzes vom 24. März 1933 im Kontext der nationalsozialistischen Machtergreifung. Sie analysiert die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen, unter denen das Gesetz zustande kam, sowie die Folgen seiner Verabschiedung.
- Die rechtlichen Grundlagen und die formelle sowie materielle Rechtmäßigkeit des Ermächtigungsgesetzes
- Die politische und gesellschaftliche Situation in Deutschland im Vorfeld des Gesetzes
- Die Rolle der einzelnen politischen Akteure bei der Verabschiedung des Gesetzes
- Die Auswirkungen des Ermächtigungsgesetzes auf die Weimarer Republik und den weiteren Verlauf der deutschen Geschichte
- Die Bedeutung des Ermächtigungsgesetzes als Präzedenzfall für die Legitimität von Machtübernahmen durch autoritäre Regime
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Bedeutung und den Gegenstand der Arbeit, die sich mit der Legalität des Ermächtigungsgesetzes vom 24. März 1933 befasst. Sie stellt die Forschungsfrage und die Methodik der Arbeit dar.
Das Kapitel „Quellengattung“ beschreibt die verschiedenen Arten von Quellen, die für die Analyse des Ermächtigungsgesetzes herangezogen werden, wie beispielsweise Reichstagsprotokolle, Zeitungsartikel und wissenschaftliche Sekundärliteratur.
Im Kapitel „Gegenstand“ wird der Inhalt des Ermächtigungsgesetzes näher beleuchtet und seine wichtigsten Punkte erläutert. Die Arbeit legt den Schwerpunkt auf die rechtliche Bewertung des Gesetzes, die im folgenden Kapitel „Juristischer Kontext“ behandelt wird.
Das Kapitel „Historischer Kontext“ beleuchtet die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse, die zur Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes geführt haben. Dabei werden insbesondere die Reichstagswahlen von 1933 und die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler im Januar 1933 analysiert.
Das Kapitel „Bewertung“ untersucht die Legalität des Ermächtigungsgesetzes aus rechtlicher Sicht. Es wird sowohl die formelle als auch die materielle Rechtmäßigkeit des Gesetzes beleuchtet und die Argumentation der damaligen Juristen und Politiker dargestellt.
Schlüsselwörter
Ermächtigungsgesetz, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Machtergreifung, Legalität, Rechtmäßigkeit, Verfassung, Reichstag, Reichsrat, Hindenburg, Hitler, Zentrumspartei, Kommunistische Partei, Geschäftsordnung, Abstimmung, Rechtsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ermächtigungsgesetz von 1933?
Das Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 war ein Gesetz, das der Regierung Hitler die Befugnis gab, Gesetze ohne Zustimmung des Reichstags zu erlassen. Es bildete die Grundlage für die Zerschlagung der Demokratie in der Weimarer Republik.
War das Ermächtigungsgesetz juristisch legal?
Die Arbeit untersucht sowohl die formelle als auch die materielle Rechtmäßigkeit. Obwohl eine Zweidrittelmehrheit erreicht wurde, geschah dies unter massivem Druck, der Verhaftung von Abgeordneten und einer fragwürdigen Änderung der Geschäftsordnung, was die „Legalität“ stark infrage stellt.
Welche Rolle spielte der Reichstagsbrand für das Gesetz?
Die Reichstagsbrandverordnung setzte bereits wichtige Grundrechte außer Kraft und schuf ein Klima der Angst und Verfolgung, das den Weg für die Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes ebnete.
Wie stimmten die Parteien über das Gesetz ab?
Die NSDAP, die DNVP und das Zentrum stimmten für das Gesetz. Die SPD stimmte als einzige anwesende Partei dagegen, während die Abgeordneten der KPD bereits verhaftet oder geflohen waren.
Welche Auswirkungen hatte das Gesetz auf die Weimarer Verfassung?
Es setzte die Gewaltenteilung faktisch außer Kraft und ermöglichte es der Exekutive, verfassungsändernde Gesetze eigenständig zu beschließen, was das Ende des Rechtsstaats bedeutete.
- Arbeit zitieren
- Wilfried Fuß (Autor:in), 2020, Das Ermächtigungsgesetz und die Machtergreifung. Eine Frage der Legalität, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/981421