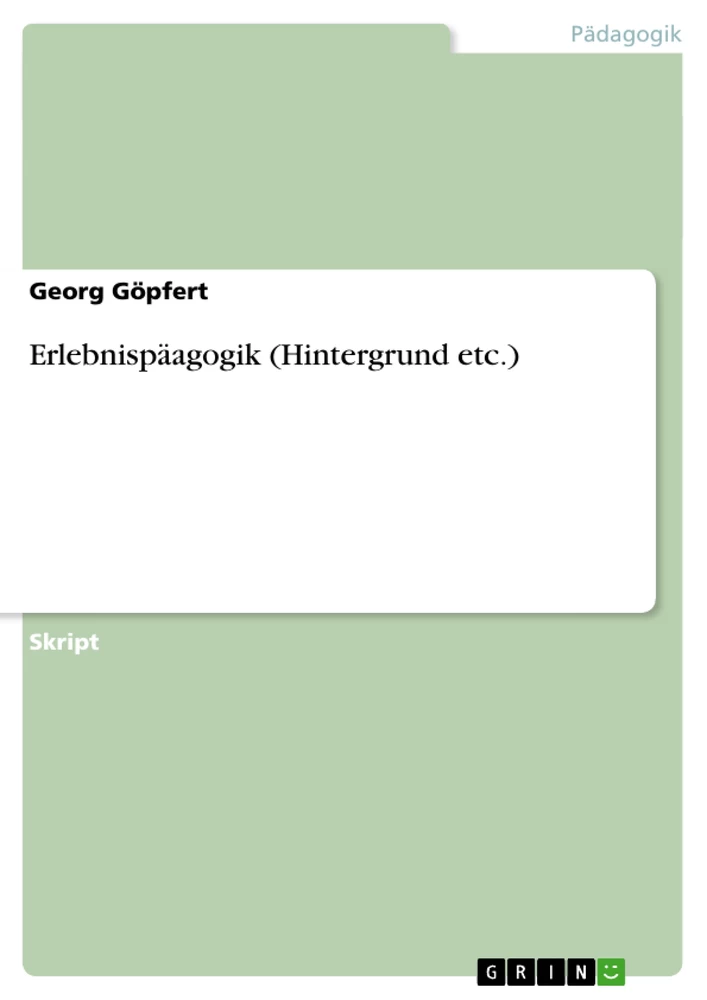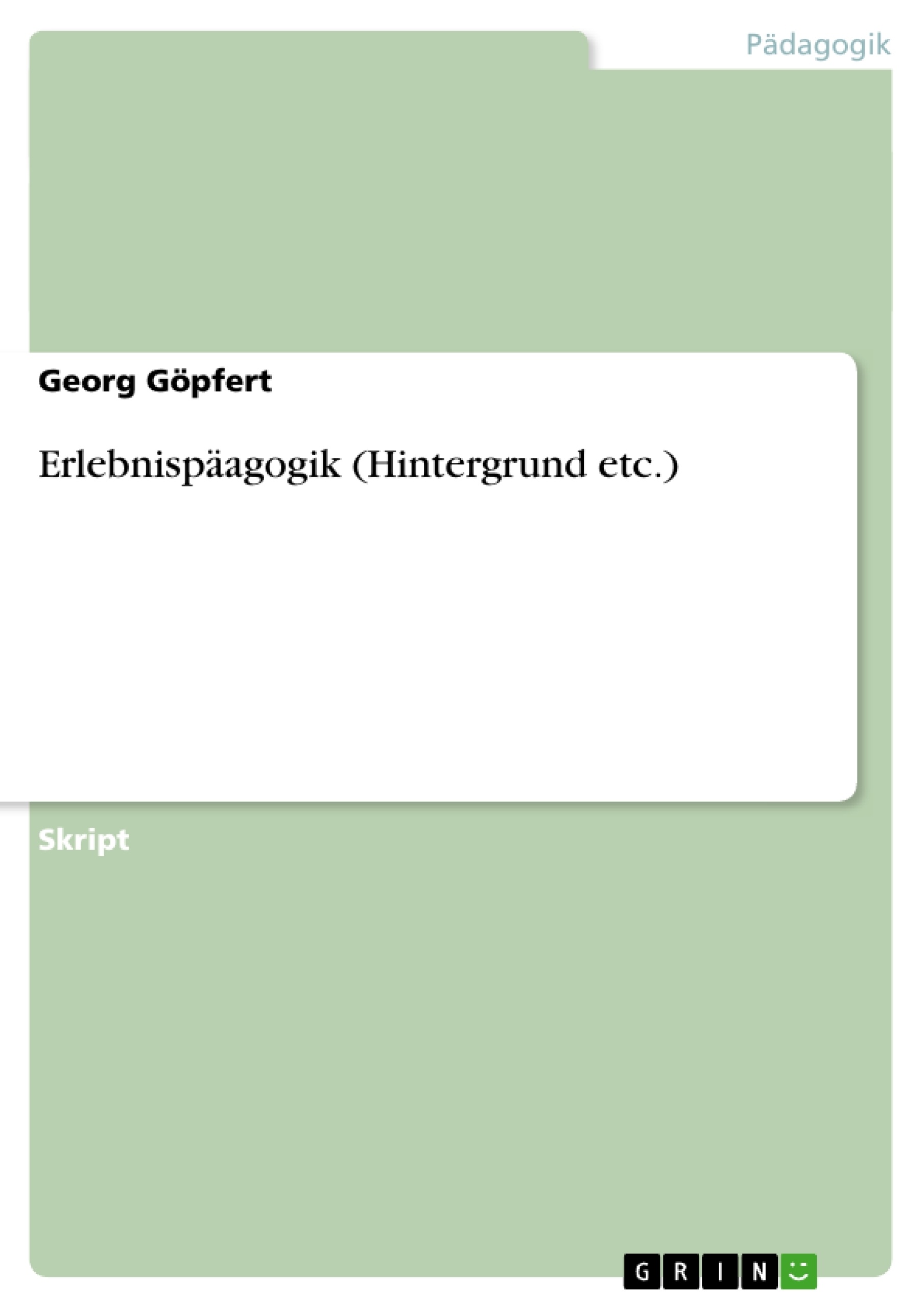I. Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
I. Inhaltsverzeichnis
II. Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung – Einführung in das Thema
2. Was ist Wissenschaft
2.1. Karl Popper
2.2. Max Weber
2.3. Theodor Adorno
3. Der Positivismusstreit, die Kritische Theorie und der Kritische Rationalismus
4. Wissenschaftliche Werte und Gütekriterien
4.1. Werte der Wissenschaft
4.2. Gütekriterien der Wissenschaft
5. Qualitative, Quantitative Wissenschaft und „mixed Methods “
5.1. Qualitative Forschungsmethoden
5.2. Quantitative Forschungsmethoden
5.3. „Mixed Methods“
6. Grenzen der Wissenschaft
7. Fazit und Ausblick
III. Literaturverzeichnis
II. Abkürzungsverzeichnis
bzw. beziehungsweise
d.h. das heißt
o.g. oben genannte / -s /- en
z.B. zum Beispiel
1. Einleitung – Einführung in das Thema
Die Wissenschaft umgibt uns überall. Sei es zu Hause, auf der Arbeit oder dort, wo wir uns gerade aufhalten. Es gibt sie in den Medien, wie Funk und Fernsehen oder im Internet. Mir ist aufgefallen, dass ich über das Thema Wissenschaft noch nie wirklich nachgedacht habe, sondern sie immer als gegeben hinnahm. Deshalb habe ich dieses Thema gewählt. Ich habe ihre Autorität nie in Frage gestellt und finde es jetzt sogar erstaunlich, denn die Erkenntnis der Welt beschäftigt die Menschheit schon seit tausenden von Jahren. Philosophen begannen bereits vor 2500 Jahren darüber nachzudenken, wie sich Wissenschaft, also unfehlbares, verlässliches Wissen erlangen lässt. Es sollte den Anspruch haben, als bewiesene Wahrheiten unumstößlich zu gelten (Alt, 2001, S.11). Diese Suche gestaltete sich jedoch als schwierig. Und seit jener Zeit werden stetig Theorien und Methoden entwickelt, unsere Welt mehr und mehr zu verstehen oder zu verändern (Alt, 2001, S.12). Aber was macht Wissenschaft aus? Um diese Frage klären zu können, ist es zunächst sinnvoll, den Begriff „Wissen“ näher zu betrachten.
Was ist also „Wissen?“ Selbst diese kleine Frage wirkt so simpel und ist doch so vielschichtig. Bei meinen Recherchen stellte ich schnell fest, dass ein paar Seiten für diese Definition nicht ausreichen werden. Natürlich erwerben wir Wissen durch unsere Erfahrungen, durch Erzählungen von unseren Großeltern, Eltern oder unserem Freundes- und Bekanntenkreis. Auch erfahren wir Wissen durch unsere Sinne (Mehling, 2015, S. 19). Wie fühlt sich die wärmende Sonne an? Wie schmeckt ein Eis? Außerdem erwerben wir unser Wissen aus Medien wie zum Beispiel aus Büchern, dem Radio, dem Fernsehen oder das Internet (Mehling, 2015, S. 19).
Mich trieb die Neugier um, was meine Tochter unter Wissenschaft versteht. Nach ihrer kindlichen Definition, finden Wissenschaftler heraus, welche Spinnen giftig sind. Nun, da es in dieser Arbeit um einiges wissenschaftlicher zugehen soll, werde ich das Thema von verschiedenen Seiten her beleuchten.
Was macht Wissenschaft also wirklich aus? Darüber stritten Wissenschaftler schon zu Beginn der 1930er Jahre im Rahmen des Positivismusstreits. Deshalb werde ich seinen Einfluss im weiteren Verlauf dieser Arbeit näher beleuchten.
Außerdem lege ich differenzierte Methoden wissenschaftlicher Datengewinnung dar, gehe auf die Hauptgütekriterien ein und grenze die Wissenschaft finanziell und ethisch ab.
Beginnen werde ich mit zwei entgegengesetzten Meinungen zum Thema, die ich im Fazit noch einmal aufgreifen wund abschließend bewerten werde.
2. Was ist Wissenschaft
Für Lew Nikolajewitsch Tolstoi war das ganz einfach. Seiner Behauptung nach, ist Wissenschaft sinnlos, weil sie die für uns wichtigen Fragen, wie man leben soll oder was wir tun sollen keine Antwort geben kann (Weber, M., 1930, S. 22).
Karl Popper, einer der bedeutendsten Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts war anderer Meinung. Nach ihm ist die Aufgabe der Wissenschaften die Suche nach der Wahrheit. Sie soll Erkenntnisse finden, die strengen Kritiken standhalten (Alt, J., 2001, S. 37). Um welche Kriterien es sich hierbei handelt, werde ich in Kapitel 4 näher erläutern.
Neben Karl Popper sind Max Weber und Theodor Adorno weitere bedeutende Persönlichkeiten, die die Landschaft der Wissenschaft mindestens genauso stark geprägt haben. Auch auf sie werde ich im Verlauf dieser Arbeit eingehen. Zunächst folgt ein kurzes Porträt, um ihren Einfluss auf die Wissenschaft deutlich zu machen.
2.1. Karl Popper
Karl Popper wurde als Sohn des Juristen und Freimaurers Dr. Simon S.C. Popper 1902 in Wien geboren. Seine Mutter war Jenny Popper. 1928 promovierte er beim Psychologen Karl Bühler und vertrat in seiner Dissertation dessen Gegenmeinung zu Schlick1 (Alt, J., 2001, S. 19). 1937 emigrierte mit seiner Frau nach Neuseeland. Dort arbeitete er als Lehrer an der Universität von Christchurch und wurde 1946 als außerordentlicher Professor der London School of Economics ernannt. Kurz darauf erlangte Popper die Professur für Logik und Wissenschaftstheorie an der Universität von London. Anfang der 1960er Jahre hielt er ein Referat in Heidelberg, welches zum Ausbruch des sogenannten Positivismusstreits der deutschen Soziologie (Kap.3) führte. Karl Popper ist bis heute einer der bedeutendsten Philosophen unseres Jahrhunderts (Alt, J., 2001, S. 11).
2.2. Max Weber
Neben Popper vertrat auch Max Weber den Kritischen Rationalismus. Er wurde am 21. April 1864 in Erfurt geboren (Fitzi, G. 2008, S. 14). Als stets ehrgeiziger und fleißiger Mensch, begann er 1882 sein Studium der Jurisprudenz in Heidelberg. 1895 hielt er seine bekannte Antrittsrede zur Professur in Freiburg und wurde nur ein Jahr später auf den Lehrstuhl für Nationalökonomie und Finanzwirtschaft nach Heidelberg gerufen. Gesundheitsbedingt ließ er sich 1903 entpflichten, trat 1 Popper bezieht sich hier auf die von Schlick 1918 in der 2.Auflage veröffentlichten Erkenntnislehre, in der Schlick sich für die reduktive – Annahmen einer Wissenschaft werden versucht in eine andere Wissenschaft zu überführen - Erkenntnisverarbeitung psychischer Vorgänge ausspricht (Alt, J., 2001, S. 19 f.)
Bildungsreisen in die USA an und entwickelte sich dort intellektuell weiter, während er sich vom Ökonom zum Soziologen wandelte. Zu dieser Zeit engagierte er sich gesellschaftlich im „Verein für Socialpolitik“, wo er seine Forschungserkenntnisse stichhaltig präsentieren konnte. In den nächsten Jahren hielt er diverse Referate und übernahm als Redakteur das Archiv für Sozialwissenschaft und Socialpolitik, welches er zur Veröffentlichung seiner Studien nutzte (Fitzi, G. 2008, S. 15ff.). Webers Leben war geprägt von der wissenschaftlichen Arbeit in der Soziologie, und so hielt er am 7.11.1917 in Lauenstein seinen Vortrag über „Wissenschaft als Beruf“, in dem er unter anderem über die Werte in der Wissenschaft sprach. Noch im selben Jahr veröffentlichte er sein Werk „Der Sinn der Wertigkeit der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften“ (Fitzi, G. 2008, S. 176).
2.3. Theodor Adorno
Theodor Adorno wurde am 11.September 1903 in Frankfurt geboren. Sein Vater Oskar Wiesengrund war deutscher Jude. Seine Mutter Maria Caluelli Adorno war Sängerin. Adornos Tante mütterlicherseits war erfolgreiche Pianistin. Dadurch war das Leben Adornos früh von der Musik geprägt (Waschkuhn, 2000, S. 45). Bereits mit 17 Jahren begann Adorno sein Studium für Philosophie, Musikwissenschaft, Psychologie und Soziologie. Abgeschottet vom Elend des Krieges und verschont von den Sorgen des Berufslebens wuchs er als narzißtischer Frühreifer auf (Waschkuhn, 2000, S. 46). Er selbst bezeichnete sich als „Treibhauspflanze“, was mit seiner eigenen Selbsteinschätzung zu tun hatte (Waschkuhn, 2000, S. 61). Er galt als empfindlich-sensibel, verletzlich und nicht aggressionsfrei (Waschkuhn, 2000, S. 46). Als Vertreter der kritischen Theorie sah er die empirische Wissenschaft als eine sinnlose Zeitverschwendung. Sie führe nur das ans Tageslicht, was schon jeder weiß, nur um den riesigen Verwaltungsapparat zu rechtfertigen (Waschkuhn, A., 2000, S. 54).
3. Der Positivismusstreit, die Kritische Theorie und der Kritische Rationalismus
Die kritische Theorie sieht sich selbst als eine praktische Philosophie, die einen gesellschaftlichen Wandel zur Selbstbestimmung des Menschen bestrebt. Dem entgegen steht die Tatsache, dass sich die Gesellschaft selbst als unmündig wahrnimmt, ohne Möglichkeiten die Dinge oder den Lauf der Welt zu verändern. Sie nimmt nicht wahr, dass sie selbst diese Welt erschafft. Die kritische Theorie sieht sich als Aufklärer. Sie will erinnern an das Erkenntnisinteresse der Wissenschaften (Prechtl, P. / Burkard, F.-P., S. 319).
Theodor Adorno, ein Vertreter der kritischen Theorie, lehnte die empirische Wissenschaft mit eindringlichem Eifer ab. Seiner Meinung nach sind die untersuchten Fakten durch die Gesellschaft vermittelt. Was bleibt, ist das Erkenntnisproblem der selbstkritischen Entwicklung. Empirisch ermittelte Fakten spiegeln nicht die gesellschaftlichen Verhältnisse wider. Sie verschleiern sie eher. Nach ihm ist diese Forschung nur eine Ideologie (Waschkuhn, A., 2000, S. 56). Adorno vertrat die Ansicht, dass die Person an sich mehr ist als nur eine biologische Essenz. Sie ist der Spiegel der Gesellschaft. Das Individuum in der modernen Wirtschaft ist, so Adorno, nur ein ausführendes Organ dessen, was als wichtig erachtet wird. Wirklich bahnbrechendes Neues ist durch die empirische Wissenschaft seiner Meinung nach nicht in Sichtweite (Waschkuhn, 2000, S. 61).
Im Zuge des Positivismusstreits, vertraten Max Weber und Karl Popper die Gegenmeinung zur Kritischen Theorie, nämlich die des kritischen Rationalismus (Mehling, 2015, S. 17). Popper lehnte jedoch jegliche Form der Induktion ab (Schurz, 2013, S. 25). Seine Formel für die Entstehung von Wissenschaft lautet wie folgt:
„“ stellt das Problem 1 dar, „VT“ die vorläufige Theorie, „FB“ die hypothesengeleitete Fehlerbeseitigung und „“ die Fortpflanzung des Problems (Alt, 2001, S.37). Hier wird ersichtlich, dass Popper ganz klar die Deduktion befürwortete.
Max Weber definierte Wissenschaft als Idee und ideale Vorstellung, die die Gesellschaft verändert (Mehling, 2015, S.17). Nach K. Popper sind Wissenschaftler Menschen, mit mutigen Ideen die sich allerdings selbst sehr kritisch sehen. Sie prüfen ihre Ideen und Vermutungen auf Richtigkeit (Mehling, 2015, S. 22). Popper zielt hier auf die Falsifizierbarkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse ab. Erfindungen und theoretischen Ideen werden möglichst strengen Prüfungen unterzogen. Sie sind solange wahr, bis sie widerlegt werden. Dazu braucht es kein Fundament, auf dem die Erkenntnisse aufbauen. Für ihn ist die Wissenschaft stetig veränderlich. Auch Max Weber vertrat diese Meinung. In seinem Vortrag „Wissenschaft als Beruf“ stellte er klar heraus, dass genau dieser Fortschritt sogar der Sinn der Wissenschaft ist. Alles Erarbeitete ist nach einigen Jahren veraltet (Weber, M. 1930, S. 15). Selbst so erfolgreiche Theorien wie die Newtonschen Gesetze haben gezeigt, dass sie durch Einsteins Relativitätstheorie angreifbar sind. Das Wissen über die Welt nimmt unaufhörlich zu (Alt, J. A., 2001, S. 8). Theorien müssen sich durch Überprüfungsverfahren bewähren (Schurz, G. 2013, S.28) Hier übt Adorno Kritik gegen diese Theorie, indem er zum Ausdruck bringt, dass der Positivismus keinen wissenschaftlichen Charakter aufweist. Durch dieses System der Bewährung von Theorien werden die Fakten selbst unwichtig. Ihre Wichtigkeit bezieht sich nur auf die Bestätigung von Theorien. Für ihn erfüllt der Positivismus nur die legitime Rolle sozialer Kontrolle der Gesellschaft (Bogdan, 2012, S. 7-22). Neben dieser von Popper postulierten Falsifizierbarkeit, stellt Weber die Wichtigkeit der Wertefreiheit in der Wissenschaft heraus. Doch dieser Standpunkt hatte seine Widersacher. Im sogenannten Positivismusstreit wurde darüber energisch diskutiert. Gegenargumente waren zum einen, dass es gar keine Wertefreiheit geben kann, denn Wissenschaft ist normiert. Gutes und schlechtes wissenschaftliche Arbeiten wird differenziert. Diese Differenzierung an sich ist nicht wertfrei. Was die Befürworter der Wertefreiheit gar nicht abstritten. Allerdings hielten sie dagegen, dass Wissenschaftler selbst über die Qualität wissenschaftlicher Ergebnisse und deren Verwendung urteilen (Mehling, 2015, S. 29). Weiterhin haben mache Begriffe (wie z.B. grausam) von Natur aus eine Wertung. Solche Wörter zu neutralisieren ist unmöglich (Ambrus, 2001, S.220). Forderungen nach einheitlichen Vorgehensweisen und Maßnahmen zur sinnvollen Begründung von Normen wurden laut. Um welche Werte es sich dabei handelt, werde ich im nächsten Kapitel näher erläutern.
4. Wissenschaftliche Werte und Gütekriterien
4.1. Werte der Wissenschaft
Wie Popper schon damals forderte, sollen wissenschaftlichen Ergebnisse und Aussagen wertfrei formuliert werden (Alt, J., 2001, S. 36). Da normative Aussagen, was wissenschaftlich sein darf problematisch sind, werden die Thesen von der wissenschaftlichen Handlung getrennt. Somit sind nur noch die puren Aussagen wertfrei. Das wissenschaftliche Handeln ist genormt und entspricht wissenschaftlichen Anforderungen (Mehling, 2015, S. 29). Max Weber versteht als besonderen Wert der Wissenschaft in der Verpflichtung des Lehrers gegenüber seinem Schüler. Ein brauchbarer Lehrer -so Weber- konfrontiert seinen Schüler möglichst früh mit unliebsamen Tatsachen. Als solche versteht er die, die nicht der Meinung des Schülers entsprechen. Damit möchte er sie so früh wie möglich daran gewöhnen, mehr als eine geistig anspruchsvolle Arbeit zu verrichten (Weber, 1930, S.27). Außerdem trennt er ganz klar die Wissenschaft von der Politik. Max Webers war der festen Überzeugung, dass Politik nicht in den Hörsaal gehört. Ob nun ausgehend von den Studenten oder ausgehend von den Dozenten: Politik und Wissenschaft müssen strengstens getrennt werden. Erst recht für denjenigen, der sich mit dem Thema der Politikwissenschaft befasst (Weber, 1930, S.24).
Wissenschaft genießt ein hohes Ansehen und das Vertrauen der heutigen Gesellschaft. (Metschel. 2016, S. 1). Jeder Wissenschaftler hat die Pflicht, sich bei seiner Arbeit an das System wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung zuhalten, Erkenntnisse nach strengen Kriterien und einer gewissen Logik zu erzeugen, auszubauen, zu kontrollieren und zu verbessern. Nur so wird die wissenschaftliche Qualität der Arbeit garantiert. Sie bietet Transparenz und Nachvollziehbarkeit (Mehling, 2015, S. 75). Da wissenschaftliche Thesen nur solange gelten, bis sie widerlegt werden, bieten sie die Möglichkeit der Falsifikation. Nach Popper müssen diese Fälle aber aktiv gesucht werden (Mehling, 2015, S. 26). Alle wissenschaftlichen Ergebnisse werden stets als korrigierbar angesehen. Erst dieser aufgeschlossene Umgang mit Kritik macht eine Verständigung zwischen Wissenschaftlern über entscheidende Sachfragen möglich (Metschel, 2016, S. 9). Wissenschaftliche Aussagen müssen wahr sein. Wahre Aussagen sollten so formuliert sein, dass sie nicht nur beschreiben, wie eine Sache ist, sondern auch erklären können, warum sie so ist. So können Prognosen über zukünftige Problematiken erstellt werden (Mehling, 2015, S.28). Als besondere Verantwortung stellte Popper hierbei ganz klar heraus, dass dieses Wissen nicht als Macht zu missbrauchen ist (Popper, 1970, S. 561). Wissenschaftliche Erkenntnisse müssen der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Dies geschieht beispielsweise durch Publikationen. Mit ihnen werden gleichzeitig die Ziele und die Vorgehensweisen wissenschaftlichen Arbeitens verbunden. Der allgemeinen Gesellschaft steht es dann frei, dieses Wissen zu nutzen. So kann es kritisch hinterfragt werden. Durch die Nachvollziehbarkeit und Offenlegung der genutzten Quellen, ist eine Überprüfung möglich (Mehling, 2015, S.28).
Ein Beispiel für die Folgen einer nicht regelkonformen Arbeit ist z.B. die Plagiatsaffäre des Karl-Theodor zu Guttenberg. Seinen Gegnern kam dieses Plagiat äußerst gelegen, denn so musste er, trotz seiner großen Beliebtheit, seinen Platz räumen (Wolf, 2013, S. 9).
Neben diesen genannten Werten sind außerdem verschiedene Gütekriterien wissenschaftlichen Arbeitens einzuhalten, auf die ich im nächsten Abschnitt eingehen werde.
4.2. Gütekriterien der Wissenschaft
Über die Qualität wissenschaftlicher Arbeit entscheiden die so genannten Gütekriterien. Es gibt drei wesentliche Kriterien. Das sind: Objektivität, Reliabilität und die Validität.
Marc Ziegle nennt in seiner Arbeit noch zwei weitere Gütekriterien. Das ist zum einen die Repräsentativität und zum anderen die intersubjektive Nachvollziehbarkeit (Ziegle, 2016, S. 259). Ich werde mich hier auf die drei Hauptgütekriterien beschränken, beginnend mit der Objektivität.
Sie misst, inwieweit der durchgeführte Test unabhängig vom Anwender ist. Verschiedene Personen müssen individuell zu denselben Ergebnissen einer Erhebung kommen (Bortz, Döring, 2006, S.195). Die Objektivität lässt sich zusätzlich in folgende Unterkriterien einteilen:
1. die Duchführungsobjektivität: Das Testergebnis muss unabhängig vom Untersuchungsleiter sein. (Himme, 2009, S. 485). Deshalb werden die Anleitungen der Test standardisiert und sind im Allgemeinen wörtlich vorgegeben (Bortz, Döring, 2006, S. 195).
2. die Auwertungsobjektivität: Verschiedene auswertende Personen müssen bei der Analyse des Testes auf das gleiche Ergebnis kommen (Bortz, Döring, 2006, S. 195).
3. die Interpretationsobjektivität: Der Analyst eines Testes orientiert sich an gewissen Normen (z.B. Altersnormen oder Bildungsnormen). Subjektive Deutungen müssen beim Auswerten außen vorgelassen werden (Bortz, Döring, 2006, S. 195). Die Normierung macht verschiedene Test vergleichbar. (Himme, 2009, S. 485f.).
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Inhaltsverzeichnis des Dokuments?
Das Dokument enthält folgende Abschnitte: Inhaltsverzeichnis, Abkürzungsverzeichnis, Einleitung, Was ist Wissenschaft (mit Unterpunkten zu Karl Popper, Max Weber und Theodor Adorno), Der Positivismusstreit, die Kritische Theorie und der Kritische Rationalismus, Wissenschaftliche Werte und Gütekriterien, Qualitative, Quantitative Wissenschaft und „mixed Methods“, Grenzen der Wissenschaft, Fazit und Ausblick, sowie ein Literaturverzeichnis.
Welche Abkürzungen werden im Dokument verwendet?
Die verwendeten Abkürzungen sind: bzw. (beziehungsweise), d.h. (das heißt), o.g. (oben genannte / -s /- en), und z.B. (zum Beispiel).
Worum geht es in der Einleitung?
Die Einleitung thematisiert die Allgegenwärtigkeit der Wissenschaft und die Frage, was Wissenschaft eigentlich ausmacht. Es wird die Notwendigkeit betont, den Begriff "Wissen" näher zu betrachten und verschiedene Quellen des Wissenserwerbs zu beleuchten.
Wer sind Karl Popper, Max Weber und Theodor Adorno?
Karl Popper, Max Weber und Theodor Adorno sind bedeutende Persönlichkeiten, die die Wissenschaftstheorie maßgeblich beeinflusst haben. Popper wird als einer der bedeutendsten Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts dargestellt. Weber wird als Kritischer Rationalist und Soziologe beschrieben. Adorno wird als Vertreter der kritischen Theorie beschrieben, welcher die empirische Wissenschaft kritisch sieht.
Was ist der Positivismusstreit?
Der Positivismusstreit ist eine Auseinandersetzung über die angemessene Methodologie der Sozialwissenschaften, in dem unter anderen die kritische Theorie und der Kritische Rationalismus aufeinandertreffen.
Welche wissenschaftlichen Werte werden diskutiert?
Es werden die Werte der Wertfreiheit wissenschaftlicher Ergebnisse und Aussagen, die Verpflichtung des Lehrers gegenüber dem Schüler, die Trennung von Wissenschaft und Politik sowie die Pflicht zur Einhaltung des Systems wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung genannt.
Welche Gütekriterien der Wissenschaft werden genannt?
Die Hauptgütekriterien sind Objektivität, Reliabilität und Validität. Zusätzlich wird auf die Repräsentativität und die intersubjektive Nachvollziehbarkeit hingewiesen.
Was bedeutet Objektivität als Gütekriterium?
Objektivität bedeutet, dass die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Untersuchung unabhängig vom Anwender sein müssen. Verschiedene Personen sollten bei der Durchführung der gleichen Untersuchung zu den gleichen Ergebnissen kommen.
Welche Unterkriterien der Objektivität werden genannt?
Die Unterkriterien der Objektivität sind die Durchführungsobjektivität, die Auswertungsobjektivität und die Interpretationsobjektivität.
- Quote paper
- Georg Göpfert (Author), 2000, Erlebnispäagogik (Hintergrund etc.), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98146