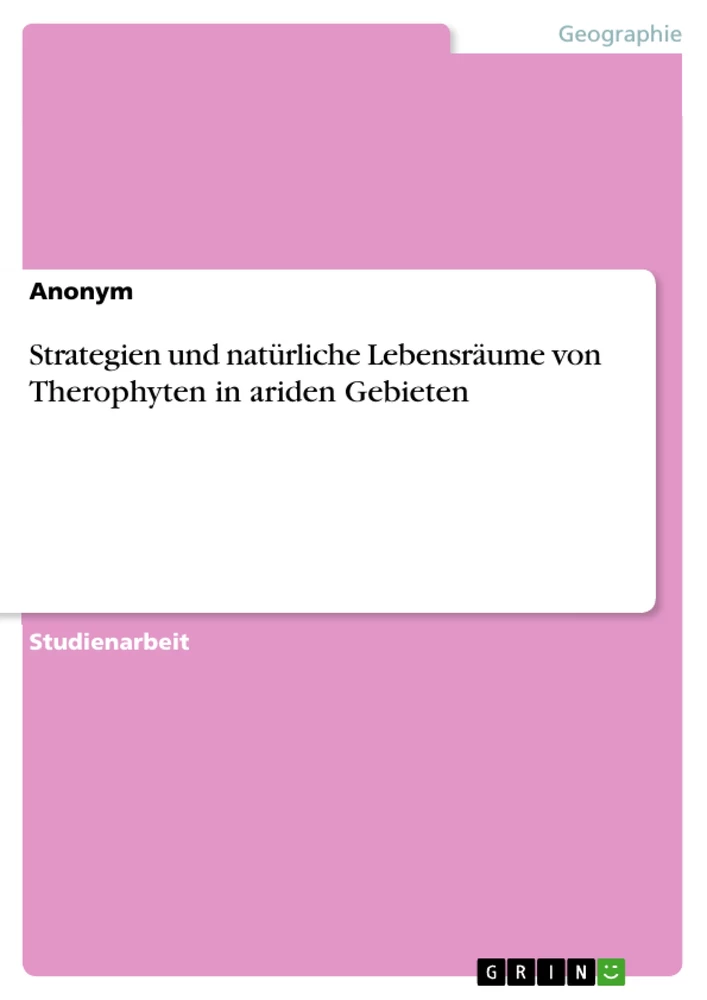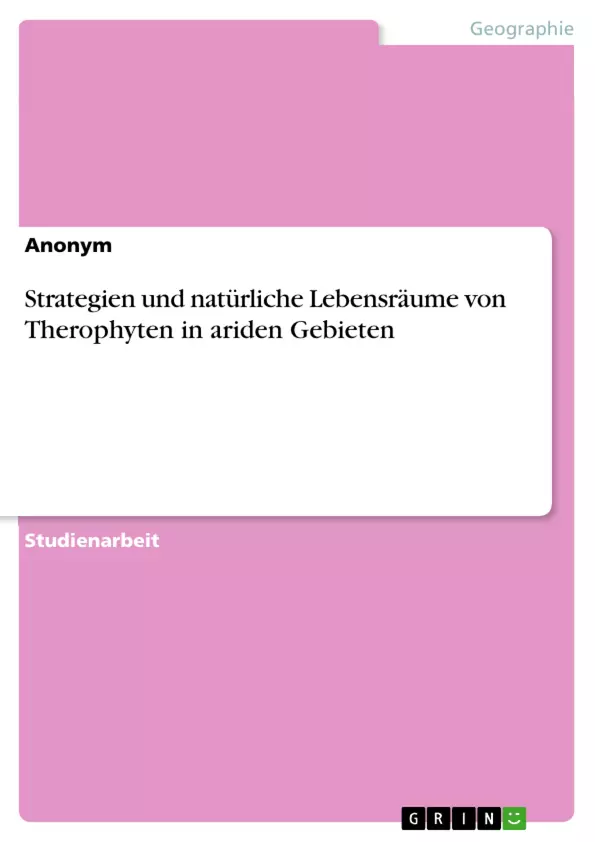Stellen Sie sich eine Welt vor, in der das Leben an einem seidenen Faden hängt, wo jeder Regentropfen ein Wettlauf gegen die Zeit auslöst und die bloße Existenz eine Meisterleistung der Anpassung ist. In den unerbittlichen Weiten der ariden Gebiete trotzen die Therophyten, diese faszinierenden einjährigen Pflanzen, den extremsten Bedingungen und entfalten Strategien des Überlebens, die ebenso genial wie fragil sind. Diese tiefgründige Untersuchung enthüllt die Geheimnisse der Therophyten, von ihren einzigartigen Keimungsmechanismen, die durch das unvorhersehbare Auf und Ab der Regenfälle ausgelöst werden, bis hin zu ihren ausgeklügelten Verbreitungstechniken, die darauf abzielen, die wenigen und weit verteilten Oasen der Fruchtbarkeit zu erreichen. Tauchen Sie ein in die Welt der Dormanzzyklen, in denen Samen jahrelang in der Stille des Bodens ruhen und auf den perfekten Moment warten, um zum Leben zu erwachen. Entdecken Sie, wie diese bemerkenswerten Pflanzen mit der unerbittlichen Konkurrenz um Ressourcen ringen und ausgeklügelte Koexistenzstrategien entwickeln, die das empfindliche Gleichgewicht des Wüstenökosystems aufrechterhalten. Erforschen Sie die entscheidende Rolle der Samenbanken, dieser unterirdischen Archive des Lebens, die die Kontinuität der Arten in einer sich ständig verändernden Umwelt gewährleisten. Von den sandigen Ebenen der Sonora-Wüste bis zu den zerklüfteten Wadis Jordaniens beleuchtet dieses Buch die bemerkenswerte Vielfalt der Anpassungen, die es den Therophyten ermöglichen, in den trockensten und lebensfeindlichsten Regionen unseres Planeten zu gedeihen. Es ist eine fesselnde Reise in die Welt der Pflanzenökologie, die die Widerstandsfähigkeit des Lebens angesichts von Widrigkeiten feiert und wertvolle Einblicke in die komplexen Zusammenhänge bietet, die unsere natürliche Welt prägen. Dieses Buch enthüllt die komplexen Überlebensstrategien der Therophyten in ariden Umgebungen und bietet einen detaillierten Einblick in ihre Anpassungen an Keimung, Verbreitung, Koexistenz und Konkurrenz. Es werden die typischen Standortbedingungen in Wüsten untersucht, einschließlich unvorhersehbarer Regenfälle, extremer Temperaturen und variabler Wasserverfügbarkeit, wobei der Schwerpunkt auf den Anpassungen der Therophyten liegt, um diese Herausforderungen zu meistern. Die ökologischen Zusammenhänge werden ebenso beleuchtet wie die Bedeutung der Samenbanken für das Überleben der Populationen, die Vielfalt der Anpassungsstrategien an die Ressourcen und die Flexibilität des Wachstums in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit. Ein Muss für Ökologen, Botaniker und alle, die sich für die Widerstandsfähigkeit des Lebens in extremen Umgebungen interessieren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung
2 Natürlicher Lebensraum der Therophyten und typische Standortbedingungen
3 Anpassungsstrategien der Therophyten in ariden Gebieten
3.1 Anpassungen der Keimung und Keimungsökologie
3.2 Anpassungen der Verbreitung und Verbreitungsökologie
4 Koexistenz und Konkurrenz bei Therophyten in ariden Gebieten
Literaturverzeichnis
1 Einführung
Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit der Lebensform Therophyten. Therophyten oder Annuelle sind einjährige Arten, ,,...die während der ungünstigen Jahreszeit ganz absterben und diese als Samen überdauern. Der Nachteil ist, daß sie ihre Entwicklung jedes Jahr mit den sehr geringen Reservemengen im Samen beginnen müssen. Sie brauchen also eine gewisse Zeit, bis das vegetative Sproßsystem aufgebaut ist und sie zur Blüte und Frucht gelangen. In kalten Gebieten geht die Entwicklung zu langsam vor sich. Man findet sie deshalb hauptsächlich in Trockengebieten mit einer kurzen, aber warmen günstigen Jahreszeit. Bei uns gehören viele Unkräuter zu ihnen. Zum Teil besteht hier eine Anpassung an die Bodenbearbeitung, durch die die Vegetationszeit der Unkrautpflanzen häufig sehr verkürzt wird" (WALTER 1986: 109).
Im Vordergrund dieser Arbeit stehen die Anpassungsstrategien der Therophyten an typische Standortbedingungen in ihren natürlichen Lebensräumen. Natürlicher Lebensraum sind die heißen Wüsten, deren extreme Umweltbedingungen die Therophyten begünstigen. Weltweit haben die Therophyten daher ihre stärkste Verbreitung in heißen Trockengebieten, weshalb ich in meinen Ausführungen ausschließlich subtropische Wüsten betrachte. Die speziellen Anpassungen bei der Keimung und Verbreitung ermöglichen den Annuellen die klimatischen (Regenperioden) und standörtlichen Nischen auszunützen und in der kurzen günstigen Jahreszeit ihre Entwicklung abzuschließen. Die Hintergründe hierzu werde ich in den folgenden Abschnitten meiner Arbeit erläutern.
2 Natürlicher Lebensraum der Therophyten und typische Standortbedingungen
Generell steigt der Anteil an Therophyten mit zunehmender Aridität. Daher dominieren Therophyten in den extremsten Wüsten (11-12 Monate trocken). Grundlage der Existenz der Annuellen sind die Regenzeiten, die die Trockenzeiten unterbrechen, und ein- oder zweimal im Jahr auftreten. In der Sonora Wüste, Arizona, zum Beispiel, treten zwei Regenzeiten im Winter (Dezember bis März) und Sommer (Juli bis September) auf. Aufgrund der zwei Regenzeiten existieren winter- und sommerannuelle Arten (wobei infolge der geringeren Temperaturen im Winter die Wasserversorgung der Winterannuellen günstiger ist). In großen Teilen der Sonora machen Annuelle ca. 50 % der Arten aus. In ägyptischen Wüsten waren 297 von 141 Arten 86 Therophyten, wobei die wichtigsten Familien bei den Annuellen Zygophyllaceae, Brassicaceae und Polygonaceae waren (ABD EL-GHANI 1998: 307, GUPTA 1986: 78, PAKE/VENABLE 1996: 1428, WALTER 1984: 241, 243, 403).
Mit zunehmender Aridität nimmt die Dauer der Regenzeiten immer mehr ab. Typisch für Wüsten ist der unvorhersagbare und unregelmäßige Regen, daher variiert die Wasserverfügbarkeit von Jahr zu Jahr und innerhalb eines Jahrs groß. Die Perioden mit spärlichem Wasserangebot sind allgemein lang, aber ihre Länge ist auch sehr variabel.
Manchmal ist das Wasserangebot auch zu gering, um Lebensaktivitäten aufrechtzuerhalten. Verschlimmert wird der Wassermangel durch die regelmäßig extreme Hitze, Kälte und Lufttrockenheit. Die Bedeutung des Tod durch biotische Faktoren (Konkurrenz, Prädation) nimmt ab und durch abiotische Faktoren zu. Infolge der großen klimatischen Variation gibt es dramatische Jahr-zu-Jahr-Fluktuationen in Abudanz, Produktivität und Diversität der Pflanzen. In Jahren mit viel Regen keimen die Therophyten in Massen, wodurch die Wüste für kurze Zeit in einen vielfarbigen Teppich verwandelt wird. Mit abnehmendem Niederschlag nimmt die Biomassenproduktion und die Arten-/Gesellschaftsvielfalt ab. Der Trend geht in Richtung kleiner Pflanzen mit kleiner Oberfläche (GUO/BROWN 1990: 123, SHIMADA/EVENARI/NOY-MEIR 1986: 379, 380, 385).
Mit zunehmender Aridität beschränkt sich die Vegetation auf begünstigte Mikrohabitate, in denen sich der Oberflächenabfluß sammelt (Wadis, Abflußrinnen, Vertiefungen mit mächtigen feinen Sedimenten) oder felsige Standorte und steile Nordhänge. Einige Wüstenoberflächen sind beständig (z.B. Felsen, Krusten), andere sind unbeständig und bewegen sich konstant (z.B. Dünen) oder werden gelegentlich gestört, z.B. Erosion und Ablagerung in Wadis durch Fluten. Diese Unstabilität erschwert zusätzlich das Überleben und Etablieren von Pflanzen. In einigen Wüsten sind Nebel und Tau regelmäßig und reichlich genug, um eine wichtige Quelle für Pflanzen zu sein (verläßlicher als Regen). Daher gibt es keine optimalen Anpassungsstrategien für Wüstenpflanzen. Es gibt eine große Vielfalt an Anpassungsstrategien. In Wüsten sind die ergiebigen Ressourcen i.A. episodisch (außer Oasen), kurz und unzuverlässig, z.B. freies Wasser und Bodenfeuchte im Oberboden nur kurz nach Regenfällen. Ressourcen, die länger zur Verfügung stehen und verläßlich sind, sind entweder von geringer Konzentration (Nebel, Tau) oder schwierig zu finden und zu nutzen (Bodenfeuchte in tieferen Schichten oder unter Steinen) oder von geringerer Qualität (salziges Wasser) (ABD EL-GHANI 1998: 308, 381, 382, ORSHAN 1986: 9, 13). Untersuchungen ägyptischer Wüsten haben ergeben, daß die wichtigsten abiotischen Umweltfaktoren, die mit der Artenverteilung korrelieren, Gehalt an Ton, Schluff (Korngrößenzusam- mensetzung beeinflußt die räumliche Verteilung der Bodenfeuchte), Wasser, organischem Kohlenstoff (wichtig für Bodenfruchtbarkeit) und Kalk sind. Bodengefüge, organischer C-Gehalt und Bodenfeuchte sind entscheidend für höhere Artenvielfalt, während hoher Salz- und CaCO3-Gehalt mit geringerer Vielfalt in Zusammenhang stehen. Große Effekte auf das Bodenfeuchteregime in der Thar Wüste, Indien, haben Gefüge, Bodenmächtigkeit, Kompaktheit der Oberfläche, Morphologie, Höhe und Exposition. Nach ORSHAN (1986) sind in der Sinai, Israel, sandige Gebiete bessere Habitate für Pflanzen als nicht sandige. Ursache ist die hohe Infiltrationskapazität, wodurch das Wasser tiefer und schneller einsickert als bei anderen Substraten. Dadurch bleibt ein größerer Anteil des Regens pflanzenverfügbar. Außerdem schützt die Sandschicht die Bodenfeuchte der tieferen Bodenschicht. Harter Kalkstein und Dolomit sind weniger durchlässig als weichere Kalke und Mergel, weswegen ein hoher Oberflächenabfluß auftritt. Die weicheren Gesteine nehmen mehr Wasser auf, das aber dadurch salziger wird (ABD EL- GHANI 1998: 308, 310, GUPTA 1986: 77, ORSHAN 1986: 10, 18).
JENNY (1991) stellte bei Untersuchungen einer Annuellenflur im Wadi Araba, Jordanien, fest, daß die Artenzusammensetzung und die Häufigkeiten der Arten an den verschiedenen Kleinstandorten in einem Wadiabschnitt von 40 m Länge große Unterschiede aufweisen, da eine große Variation der Oberflächenbeschaffenheit und des Wassergehalts des Bodens besteht. Der Standort am häufig überfluteten Rinnenrand bietet für Annuelle die besten Bedingungen: Bei jedem Regenfall wird ein Teil der Pflanzen weggespült, wodurch die Etablierung von Mehrjährigen verhindert und so die Annuellenflur erhalten bleibt. In der Senke (höherer Salzgehalt) und am Standort mit hoher Sandauflage (fehlendes Zuschußwasser) können sich die Arten oft nicht etablieren. Die Populationen im Untersuchungsgebiet sind kleinräumig diskontinuierlich verteilt und auch großräumig durch ausgedehnte vegetationslose Flächen voneinander getrennt. Wegen der zeitlichen und mengenmäßigen Unregelmäßigkeit der Regenfälle sind die Schutzstellen auch zeitlich diskontinuierlich verteilt. Diese Diskontinuität macht die Samenbank zu einem besonders wichtigen Teil der Populationen annueller Pflanzen. Das Erscheinungsbild der Annuellenflur ist durch eine kaum geschichtete Vegetation mit einer Wuchshöhe von meist 5-10 cm gekennzeichnet. Die Vegetationsperiode beträgt 2 bis 3 Monate (JENNY 1991: 40-42). Die seltenen Schutzstellen, durchsetzt von häufigen ungünstigen Keimstellen, haben zur Folge, daß die räumlichen Muster der Vegetation ungleichmäßig und Artenvergesellschaftungen, Konkurrenz und Dominanz innerhalb der Vegetationsmuster schwach sind (HENDERSON/ PETERSEN/REDAX 1988: 727).
Nach SHIMADA/EVENARI/NOY-MEIR (1986) ist die räumliche Variation der Vegetation zurückzuführen auf:
- Konzentration des Oberflächenabfluß in bestimmten Bereichen abhängig vom Relief, von der Niderschlagsintensität und von der Infiltrationskapazität der Oberflächen (hoher Oberflächenabfluß bei geringer Infiltration). Auf diese Weise kann ein drastischer ökologischer Kontrast zwischen trockenen und armen Habitaten und sehr begünstigten Habitaten entstehen.
- geologische und geomorphologische Heterogenität
- Niederschlagsmuster, z.B. orographische Effekte
- spezielle mikroklimatische und mikroedaphische Habitate um Pflanzen, Geröllhaufen und Tierbauten (SHIMADA/EVENARI/NOY-MEIR 1986: 383)
3 Anpassungsstrategien der Therophyten in ariden Gebieten
Bei Wüstenpflanzen existieren zwei Hauptanpassungen an die Ressourcen: Zum einen Anpassung an die episodischen Ressourcen, zum anderen Anpassung an die geringen, aber ständig vorhandenen Ressourcen (letzteres kommt nur für Mehrjährige mit spezieller anatomischer und physiologischer Anpassung, z.B. Sukkulenz, in Frage). Winter-Annuelle nutzen die episodischen, aber reichlichen Ressourcen. Die Umweltbedingungen müssen daher zumindest gelegentlich günstig für Keimung und Vollendung des Lebenszyklus sein, selbst bei langer Persistenz in der Samenbank (BASKIN, C. & J./CHESSON 1993: 551). Um erfolgreich zu sein, sind schnelle Nutzung der Ressourcen, hohe Reproduktionsrate und schneller Übergang vom aktiven zur nichtaktiven Stufe des Lebenszyklus notwendig. Das bedeutet, daß zumindest ein Teil der im Boden vorhandenen Samen bei Einstellen von günstigen Bedingungen, also nach ergiebigen Regenfällen, sofort zu keimen beginnt und in kurzer Zeit ihren Lebenszyklus beendet. Im nächsten Abschnitt möchte ich näher auf keimungsökologische Zusammenhänge eingehen.
Einige Pflanzen können ihre Lebensform in Abhängigkeit der Ressourcenverfügbarkeit wechseln. So wandeln sich einige Therophyten zu Mehrjährigen und umgekehrt (SHIMADA/ EVENARI/NOY-MEIR 1986: 383). Eine weitere Anpassung ist die Flexibilität des Wachstums. In der Sonora Wüste, Arizona, entwickelt der oberirdische Sproß nach hohen Niederschlagsmengen eine Größe von mehreren dm bis über 1 m. Bei geringem Niederschlag bleibt er klein. Ursache ist die Hemmung des Höhenwachstums des Sproß bei gleichzeitiger Förderung des Längenwachstums der Wurzel mit zunehmend schlechter Wasserversorgung, um tiefer liegende Wasservorräte möglichst schnell zu erreichen. Das Verhältnis von Sproß zu Wurzel verschiebt sich immer stärker in Richtung Wurzel. Gleichzeitig wird die Wurzel immer dünner. Ein Beispiel hierfür ist Solanum elaegnifolium: Während der Sommerregenzeit 1929 bildeten sich auf der untersten Flußterrasse Wasserlachen. Die Pflanzen am Rand der Lache wurden nur 1 cm hoch, in der Mitte hingegen 60 cm. Innerhalb der Therophyten gibt es starke Unterschiede in der Lebensdauer, die Ausdruck verschiedener Strategien sind. Beispiele hierfür liefert die Negev Wüste (Regenzeit von November bis Februar). Dort gibt es:
- kurzlebige Winterannuelle, die ihre Entwicklung in den Wintermonaten beenden und im März absterben (59 % aller Arten)
- Annuelle, die bis zum Juni durchhalten
- Sommerannuelle, die erst im März keimen, im Sommer ihre großen Blätter verlieren, aber noch kleine grüne sukkulente Blätter behalten und bis zum Winter am Leben bleiben, z.B. Salsola-Arten: blühen und fruchten im Juli bis Oktober und sind auf feuchtere Taschen unter den Steinen angewiesen. Zusätzlich nehmen sie in der Nacht etwas Wasser durch Tau auf, aber dieses geht morgens innerhalb von zwei Stunden durch Transpiration wieder verloren (WALTER 1984: 241, 242, 402, 405, 406).
3.1 Anpassungen der Keimung und Keimungsökologie
Die Therophyten haben spezielle Keimungsstrategien entwickelt, um die klimatischen Nischen auszunützen. Untersuchungen an Eriastrum (Winterannuelle in der Chihuahuan Wüste, Arizona) zeigten, daß die meisten Samen einen jährlichen dormant/nicht dormant- Zyklus aufweisen. Eriastrum ist dormant im Frühjahr, die meisten Samen reifen im Sommer nach, womit ihre Dormanz beendet wird, und im Oktober keimt ein großer Teil. Die meisten Samen, die nicht im Herbst keimen, fallen in eine zweite Dormanz im Winter, die im folgenden Sommer gebrochen wird. Auf diese Weise entsteht ein Zyklus, der den Winter- Annuellen der gemäßigt-humiden Klimaten entspricht. Nicht alle Samen erwachen aus der Dormanz. Im ersten Sommer nach Deponierung in der Samenbank reiften 35 % und im zweiten Sommer 8 % der Samen nicht nach.
Bei Eriogonum (ebenfalls Winter-Annuelle) konnte festgestellt werden, daß die nicht dormanten Samen im Winter eine bedingte Dormanz erreichen, d. h. die Samen keimen nur über ein enges Spektrum an Umweltbedingungen. Daher verlieren die Samen ihre Keimfähigkeit bei hohen Temperaturen, wodurch Sommerniederschläge keine Keimung auslösen. Gebrochen wird die bedingte Dormanz im Sommer, im Herbst ist demnach der größte Teil nicht dormant. Dadurch entsteht ein jährlicher bedingt dormant/nicht dormant- Zyklus.
Der jährliche dormant/nicht dormant-Zyklus von Eriastrum bedeutet, daß die Samen auch bei optimalen Umweltbedingungen nicht keimen, solange die Dormanz nicht beendet wird. Der jährliche bedingt dormant/nicht dormant-Zyklus von Eriogonum bedeutet, daß die Temperatur und Bodenfeuchte die Keimung über das ganze Jahr kontrollieren. Ungeklärt ist, wie viele Arten in der Chihuahuan Wüste welchen der beiden Zyklen aufweisen. Der Zyklus von Eriogonum ist charakteristisch für Annuelle in unvorhersagbaren Habitaten, der von Eriastrum von vorhersagbaren. Somit kontrollieren nicht nur Temperatur und Niederschlag die Keimung der Wüsten-Annuellen, sondern auch der interne Dormanz- Kontrollmechanismus, der den Zeitpunkt der Keimung bestimmt (BASKIN, C. & J./CHESSON 1993: 554).
Forschungen in der Chihuahuan Wüste und der Sonora Wüste ergaben, daß ein Teil der Samen von Winter-Annuellen selbst unter optimalen Keimungsbedingungen dormant verbleibt. (PAKE/VENABLE 1996: 1427). Zu diesem Ergebnis kommt auch JENNY (1991) anhand eines Versuchs in einer Annuellenflur im Wadi Araba, Jordanien. 10 Tage nach dem ersten Regenfall wurden am Rinnenrand auf zwei Flächen alle gekeimten Pflanzen entfernt. Anschließend wurde eine Fläche drei Wochen lang bewässert. Auf der bewässerten Fläche konnten nur 21 neue Keimlinge gegenüber den ursprünglich 513 gekeimten Pflanzen festgestellt werden, obwohl in den obersten 5 cm des Bodens nach Versuchsende noch Samen vorhanden waren. Auf der unbewässerten Fläche keimten nur drei Individuen einer Art und starben später ab. Daher keimen auch unter optimalen Bedingungen selten alle Samen einer Population zum gleichen Zeitpunkt. Ein vermutlich sehr hoher Verlust von Samen entsteht durch Umschichtung der sandigen Böden durch Wind und Wasser, wodurch die Samen zu tief für eine Keimung sind bzw. an die Oberfläche verlagert werden. An der Oberfläche wird der Verlust durch Verwehungen an ungünstige Standorte und durch Fraß verursacht (im Untersuchungsgebiet v.a. durch Ameisen). Ein größeres Wasserangebot erhöht offensichtlich die Keimrate kaum (JENNY 1991: 41, 42).
In Wüsten gibt es extreme Fluktuationen bei der Population von Wüsten-Annuellen. Ursache ist die starke jährliche Variation der Keimrate und Keimfähigkeit. Die Keimrate ist höher im Falle von günstigen Umweltbedingungen und bei offenen Habitaten höher als unter Buschvegetation (PAKE/VENABLE 1996: 1427, 1433, 1434). Es ist normal, daß Samen keimen, ohne daß ein Keimling überlebt. Viele Wüstenpflanzen dehnen die Keimung über eine Anzahl von Vegetationsperioden aus, um die Erlöschung der Population bei Auftreten von ungünstigen Bedingungen zu verhindern. WALTER (1984) nennt dafür ein Beispiel aus der Negev. Pteranthus dichotomus bildet 1 bis 7 Früchte mit je einem Samen. Wenn alle sieben Früchte gebildet werden, besitzen die Samen verschiedene Keimfähigkeit, die ersten keimen gleich, die anderen in nächsten Jahren nicht, die dritten nehmen eine Mittelstellung ein. In schlechten Jahren wird nur eine Frucht gebildet, dessen Samen erst nach mehreren Jahren keimt, daher sind im Boden stets Samen vorhanden (WALTER 1984: 407).
Bei den Samen vieler Wüstenpflanzen wird die Keimung durch Regen ausgelöst, wobei der Wassergehalt im Oberboden, der gewöhnlich die meisten Samen enthält, aber rasch wieder austrocknet, eine bedeutende Rolle spielt. Die Keimung verläuft sehr rasch, damit die Wurzeln möglichst schnell tiefere Bodenschichten erreichen, bevor der Oberboden austrocknet (WALTER 1984: 241). Das Wasser reicht aber nicht lang genug für eine komplette Keimung. MEIDAN (1990) hat vier Winter-Annuelle in der Negev-Wüste, Israel, untersucht und festgestellt, daß
- maximale Keimung bei Feldkapazität oder darüber auftritt
- bei konstantem Wassergehalt die Arten unterschiedliche Minimalzeiten für die Keimung benötigen
- alle 4 Arten ihre maximale Keimrate nach 58 bis 72 h bei Feldkapazität erreichen
- im Winter 1983/84 von 21 Niederschlagsereignissen nur zwei länger und bedeutungsvoll waren. Für 20 bis mehr als 56 h konnte sich dadurch Feldkapazität einstellen. Bei geringem Wasserpotential, variieren die Samen verschiedener Arten in ihren Schwellenwerten bzgl. der Keimung. Bei hohem Wasserpotential keimen alle Samen optimal. Im Oberboden von Hängen existieren solche Bedingungen nur in Mikronischen (z.B. an Gesteinsblöcken). Die Keimungszeit der vier Arten variierte unter Feldkapazität im Versuch von 28 bis 52 h, dabei war die Keimrate nur sehr gering (1-7 %). Die klimatischen Daten von 1951 bis 1981 zeigten, daß 90 % der Regenfälle kleiner 10 mm waren. Daher keimen nach den meisten Regen keine Samen der Samenbank Die Samen sind in den meisten Teilen der Hänge maximal 36 h der Feldkapazität ausgesetzt. Diese Zeit ist nicht ausreichend für eine optimale Keimung bei allen Arten. Die Samen im Unterhang haben generell günstigere Bedingungen. Daher keimen Filage und Schismus nur am Unterhang (MEIDAN 1990: 77, 79, 83).
Ein essentielle Vorrausetzung für eine erfolgreiche Keimung ist eine dauerhafte Samenbank. In einer Wüste in New Mexiko, USA, entsprach die Artenzusammensetzung der Samenbank zu 89 % der Vegetation. HENDERSON/PETERSEN/REDAX (1988) sind der Auffassung, daß die hohe Korrelation zwischen Samenbank und Vegetation eine Konsequenz der häufigen und unvorhersagbaren Störungen ist. Die hohe Übereinstimmung der Vegetation mit der Samenbank deutet lange Persistenz und/oder limitierende Verbreitung der Samen an und scheint typisch für regelmäßig gestörte Gesellschaften zu sein. In den meisten Untersuchungen anderer Ökosysteme war die Übereinstimmung zwischen Vegetation und Samenbank geringer. Ursache hierfür sind Störungen, die für einen jungen Sukzessionsstadius sorgen, dessen Arten auf persistente Samenbanken zur Kolonisation statt Kolonisation durch Invasion (Arten späterer Sukzessionsstadien) setzen. Die Häufigkeit und Dauer der klimatischen Störungen limitieren das Ausmaß der Vegetationsentwicklung. Die kurzen und ungewißen Zeiträume für die Regeneierung der Vegetation selektiert auf eine Vegetation, die primär durch Keimung aus einer persistenten Samenbank reggeniert mit dem Ergebnis der Ähnlichkeit beider. Ein weiterer Faktor für die Übereinstimmung ist die hohe Samenprädation. Der Anteil an konsumierten Samen beträgt für Wüsten typischerweise 40 bis 60 % der jährlichen Samenproduktion. Dadurch wird die Samenbank in einem mehr vergänglichen Zustand gehalten. Beim Fraß werden manche Samen bevorzugt, was entsprechende Auswirkungen auf die Abudanzen der bevorzugten Arten hat (HENDERSON/PETERSEN/REDAX 1988: 727).
3.2 Anpassungen der Verbreitung und Verbreitungsökologie
In Wüsten sind Standorte mit relativ günstigen Lebensbedingungen infolge der Oberflächenabflüsse nach den meist kurzen und heftigen Regenfällen oft fleckig verteilt. Bei einer gleichmäßigen, großflächigen Verbreitung der Diasporen ist die Chance der erfolgreichen Etablierung daher gering. Die Pflanzen müssen daher Strategien besitzen, die eine Samenverbreitung zu den begünstigten Standorten gewährleisten. JENNY/HALFMANN (1993) führten dazu Forschungen in einer Annuellenflur im Wadi Araba, Jordanien, durch. Das Klima ist durch lange, trockene Sommer und kurze Winter mit sporadischen, oft heftigen Niederschlägen (50-100 mm/a) gekennzeichnet. Der Boden besteht aus einer Flugsanddecke auf Sanden und Lehmen. Durch die Regenfälle wird die Flugsanddecke so stark umgelagert, daß ausdauernde Pflanzen häufig entwurzelt werden und absterben. 33 % der Arten (gewichtet) haben keine ausbreitungsrelevanten Eigenschaften. An Wüsten ist daher die Ausbreitung der Diasporen auch ohne besondere Strukturen gewährleistet. 3 % sind pogonophor (lang behaart, mit Haarschirm oder behaarter Grane), 23 % sind myxophor (Diaspore sondert bei Befeuchtung Schleim ab, wodurch sie fest mit dem Substrat verklebt wird), 2 % akonthophor (Diaspore mit Haken, Stacheln oder sparrigem Habitus), 8 % werden bei Bewegung freigesetzt und 9 % spaeromorph (Diaspore leicht und mit kugeligem Umriß, sog. Wüstenroller). Ein wesentlicher Aspekt bei der Verbreitung ist der Ausbreitungseffekt, also der Einfluß der Diaspore und/oder der Mutterpflanze auf das Diasporentransportvermögen. Der größte Anteil der Arten (ca. 40 % gewichtet) ist antitelechor, d. h. Diaspore und/oder Mutterpflanze hemmen das Transportvermögen der vorhandenen Ausbreitungsagenzien. Ca. 35 % sind atelechor, d. h. es besteht kein erkennbarer Einfluß von Diaspore und/oder Mutterpflanze auf das Transportvermögen. Ca. 25 % weisen einen telechoren Effekt auf, steigern also das Transportvermögen. In guten Jahren produziert die Mutterpflanze bei einigen Annuellen atelechore und telechore Samen, in schlechten nur atelechore.
Der hoher Anteil an atelechoren Effekten spricht dafür, daß in Wüsten zur Diasporenausbreitung keine besondere Anpassungsstrukturen erforderlich sind. Antitelechore Effekte sind weit häufiger als an gemäßigten Standorten. Daher ist die Ausbreitungshemmung bei Wüstenpflanzen von großer Bedeutung. Bei Regenfällen werden im Wadi große Mengen an Diasporen verlagert. V.a. die Myxophorie gewährleistet dann die Etablierung an den begünstigten Standorten der Abflußrinnen, da sie eine weitere Ausbreitung durch Wind verhindert. Für JENNY (1991) spielt die Wasserverbreitung hingegen nur eine geringe Rolle, denn er ist der Auffassung, daß Myxophorie möglicherweise besonders häufig in ariden Gebieten ist, weil sie meist hintereinander zwei Effekte hat: Während der trockenen Jahreszeit werden die meist kleinen Diasporen durch Wind ausgebreitet (atelechor) und nach einer einmaligen Befeuchtung fest mit dem Substrat verklebt (antitelechor). Daher hat Wasser eine hohe Bedeutung für Antilechorie, während es als Transportmittel (Hydrochorie) selten ist. In den meisten Fällen laufen also verschiedene Ausbreitungseffekte hintereinander ab. Diese Kombination von telechoren bzw. atelechoren Effekten mit antitelechoren Effekten ist auf die erschwerten Etablierungsbedingungen zurückzuführen. Die Kombination von telechoren Effekten (typisch für Mitteleuropa) fehlt (JENNY 1991: 36, 51, 52, JENNY/HALFMANN 1993: 214, 218).
Als Beispiele sind zwei Arten aus der Annuellenflur im Wadi Araba am Rinnenrand aufgeführt: Anastatica hierochuntica (Crucifereae) und Iflogo spicata (Compositae). Bei Anastatica hierochuntica werden die reifen Samen während des trockenen Sommers von der Mutterpflanze festgehalten (antitelechor). Bei Regenfällen von mindestens 4 mm innerhalb von 90 Min. entrollt sich das Skelett der Mutterpflanze, gleichzeitig erweichen die Nähte der Schötchen. Durch Regentropfen werden die Samen aus der Frucht geschleudert (ombrochor) und durch Schichtfluten weitertransportiert (hydrochor, telechor). Die Samen haften nach der Austrocknung ihrer Schleimhülle auch auf verschlämmten glatten Oberflächen fest (wieder antitelechor). Iflogo spicata entläßt bei Fruchtreife Achänen. Die meisten Achänen besitzen keine, wenige einen reduzierten Pappus, ohne ersichtliche Auswirkung auf die Ausbreitung (atelechor). Die Achänen können während des trockenen Sommers von Wind transportiert werden oder sie sammeln sich an windgeschützten Stellen in Vertiefungen bzw. an der Basis mehrjähriger Pflanzen. Nach dem ersten Niederschlag kleben die Achänen durch Schleimabsonderung am Substrat fest (antitelechor).
JENNY (1991) kommt zum Schluß, daß das Erreichen entfernterer Standorte auch ohne ausbreitungsfördernde Eigenschaften gesichert ist, gleichzeitig ist aber die Etablierung durch Antitelechorie in der Nähe der Mutterpflanzen ein wichtiger Faktor für das Überleben (JENNY 1991: 48, 49, 52). In der Negev Wüste gibt es dafür ein weiteres Beispiel. Gynarrhena micrantha (Composite) bildet viele oberirdische Früchte und einige unterirdische; die oberirdischen Samen werden verbreitet, während die unterirdischen an der abgestorbenen Pflanze haften bleiben und sich auf dem Wuchsort der Mutterpflanze etablieren. In Trockenjahren werden nur unterirdische Früchte gebildet (WALTER 1984: 107). 74 % der Arten sind polychor, können also auf verschiedene Weise verbreitet werden.
Betrachtet man die verschiedenen Ausbreitungsagenzien (Wind, Wasser, Tiere) fällt auf, daß nur 34 % der Arten anemochor sind. Häufig sind Flugorgane wie der Pappus reduziert oder hinfällig. Das Agens Wasser spielt bei 29 % eine Rolle. Ca. 5 % der Arten wird bei Näße freigesetzt, 23 % sind myxophor und nur 1 % trypanophor (Diaspore mit grannenartigem Anhang, welcher sich hygroskopisch und in der Regel drehend bewegt). Nur 3 % werden durch Tiere verbreitet, denn fleischige Diasporen fehlen und größere Herbivore sind selten. Stacheln und Hacken dienen daher eher der Verankerung der Diaporen im Substrat. Die Diasporenmassen sind relativ gering (typisch für offene Habitate). Ursache hierfür ist v.a. die geringe Lichtkonkurrenz. Das seltene Auftreten extrem leichter Diasporen (weniger 0,05 mg) kann mit der durch das kurzfristige Wasserangebot erschwerten Etablierung erklärt werden. Die Ausbreitungsdistanz ist sehr groß infolge der extrem offenen Vegetation und der heftigen Winde, obwohl Telechorie fehlt (JENNY/HALFMANN 1993: 221-224, SHIMADA/EVENARI/NOY-MEIR 1986: 385).
PAKE/VENABLE (1996) stellten in der Sonora Wüste fest, daß die Samengröße auch ein Faktor ist, der den Reproduktionserfolg erhöht, da das Wurzelwachstum bei großen Samen schneller erfolgt und so feuchtere Bodenschichten schneller erreicht werden. Populationen mit größeren Samen haben eine geringere zeitliche Variation im Reproduktionserfolg und höhere Keimraten als Populationen mit kleinen Samen und ein kleinerer Teil der Samen wurde Bestandteil der Samenbank. Das Risiko einer Art kann also entweder durch große Samen oder durch große Samenbank reduziert werden. Daher besteht eine negative Korrelation zwischen Samengröße und Dormanz (PAKE/VENABLE 1996: 1428, 1433).
4 Koexistenz und Konkurrenz bei Therophyten in ariden Gebieten
Typisch für heiße Wüsten ist die Koexistenz einer unterschiedlichen Winter- und Sommer- Flora. Diese vollständige zeitliche Trennung beruht auf zwei Regenzeiten, die von Dürrezeiten unterbrochen sind. Eine Überlappung der beiden Gesellschaften ist nur in der Samenbank existent. In der Chihuahuan Wüste, Kalifornien/Texas, haben GUO/BROWN (1997) solch eine Koexistenz näher untersucht. Demnach führt jeder deutliche Anstieg der Abudanz einer Vegetationsperiode über den Langzeitdurchschnitt zu einer unterdurchschnittlichen Abudanz der folgenden Vegetationsperiode. Die Niederschlagsvariation kann diese Muster nicht erklären. Ursache ist eine starke negative Wechselbeziehung zwischen Winter- und Sommer-Gesellschaft. Eine große Anzahl von Pflanzen einer Jahreszeit verhindern die Keimung und/oder das Überleben in der folgenden Jahreszeit. Für diesen Zusammenhang existieren mehrere Hypothesen:
- begünstigter Winter mit hohen Vegetationsdichten kann in einem größeren Überleben der mehrjährigen Pflanzen (die in beiden Gesellschaften vorkommen können) während der Frühjahrdürre resultieren, wodurch Keimung und Überleben der Sommerannuellen reduziert wird
- Pflanzen einer Saison können zur Zunahme von Herbivoren, Parasiten, Krankheiten, Vögel und Nagetieren führen, die dann in der folgenden Saison eine hohe Sterblichkeit der Pflanzen verursachen. Vögel und Nagetiere bevorzugen große Samen, die aber nur in Winter- Gesellschaften vorkommen und in Sommer-Gesellschaften fehlen. Dadurch beeinflußen sie die Zusammensetzung der Winter-Gesellschaften. GUO/BROWN (1997) meinen, daß sei plausibel und hätte daher einen hohen Einfluß auf die Populationsdynamik von Wüsten- Anuellen.
- CO2 hemmt die Keimung vieler Samen. Möglich ist, daß CO2 aus abgestorbener Biomasse von Annuellen einer vorherigen Saison die Keimung reduziert (insbesondere nach einer Saison mit hoher Vegetationsdichte).
- Nährstoffmangel: Nährstoffe wie Nitrat sind in der toten Biomasse der vorherigen Saison fixiert, die erst beim Beginn der nächsten Regenzeit zersetzt wird. Nitrat ist ein limitierender Faktor für Annuelle in Wüsten. GUO/BROWN (1997) sind der Ansicht, daß die Konkurrenz um die Nährstoffe, die dann in toter Biomasse immobilisiert werden, der wahrscheinlichste Mechanismus ist, der die negative Wechselbeziehung zwischen Winter- und Sommer- Annuellen verursacht (GUO/BROWN 1997: 123-128).
PAKE/VENABLE (1996) untersuchten in der Sonora Wüste die Koexistenz bei Winter- Annuellen. Die Koexistenz beruht auf der zeitlichen Variation der Samenbank und der artspezifischen Keimung. Die Koexistenz wird durch folgende Elemente gefördert:
- langlebige, widerständige Arten, die auch bei ungünstigen Bedingungen überleben
- artspezifische Anpassungen an die zeitliche Variation, so daß die Arten nicht vollständig abhängig von Jahren mit günstigen Bedingungen sind
- Konkurrenzeffekte, die das Populationswachstum limitieren, wenn eine Art eine hohe Individuendichte erreicht
Alle drei Elemente kommen in Annuellen-Gesellschaften vor. Eine Art, dessen Populationsdichte gering geworden ist, kann durch Fehlen der Konkurrenz gelegentlich ein günstiges Jahr mit hoher Wachstumsrate erreichen, da die Keimung artspezifisch ist. Eine Art mit geringer Dichte kann sich daher wieder ausbreiten, solange die Samenbank den Rückgang in ungünstigen Jahren wieder ausgleicht. Die höhere Keimrate in günstigen Jahren hat einen wichtigen positiven Einfluß auf die Koexistenz (PAKE/VENABLE 1996: 1428, 1433, 1434). Günstige Bedingungen für eine Art sind oft nicht günstig für eine andere. Diese Unterschiede zwischen den Arten führen in der Sonora Wüste zum zeitlichen Wechsel der Dominanz der beiden Artenpaare Pectocarya recurvata - Schismus barbatus und Pectocarya recurvata - Plantago patagonica. Auf diese Weise ist eine Koexistenz dieser drei Therophyten möglich. In der Sonora existiert eine große zeitliche Modifikation der Niederschlagsmengen und - verteilung, der Aktivität der Herbivoren und der Keimlingsdichte. Artspezifische Unterschiede in der Reaktion darauf (bedingt durch physiologische oder anatomische Unterschiede) führen zu Variationen im Reproduktionserfolg, wodurch Wechsel in der Dominanz von zwei Artenpaaren entstehen. Bei allen drei Arten wirkte sich eine höhere Keimlingsdichte positiv auf das Überleben aus. Pectocarya ist bei einer mittleren Keimungsdichte begünstigt, eine geringe Dichte ist weniger günstig. Für Schismus hingegen ist eine hohe Keimlingsdichte von Vorteil und eine mittlere Dichte weniger günstig. Diese Erscheinung ist unüblich für Ökosysteme. Die räumliche Heterogenität durch das Busch/Offenland-Mosaik war nicht wichtig für die Aufteilung der Umwelt durch diese drei Arten (PAKE/VENABLE 1995: 246, 253, 259, 260).
Konkurrenz tritt v.a. am Ende der Wachstumsperiode auf, wenn reichlich Ressourcen zur Verfügung stehen. Die Wirksamkeit der Konkurrenz ist aber nur kurz und hat keinen großen Effekt auf die Populationsdichte der Pflanzen und ihrer genetischen Ausstattung. Die geringe Konkurrenz ermöglicht die Atelechorie (SHIMADA/EVENARI/NOY-MEIR 1986: 385).
Literaturverzeichnis
ABD EL-GHANI, M. M. (1998): Environmental correlates of species distribution in arid desert ecosystems of eastern Egypt. Journal of Arid Environments 38, S. 297-313
BASKIN, C. C. /CHESSON, P. L. /BASKIN, J. M. (1993): Annual seed dormancy cycles in two desert winter annuals. Journal of Ecology 81, S. 551-556
GUO, Q. /BROWN, J. H. (1997): Interactions between winter and summer annuals in the Chihuahuan Desert. Oecologia 111, S. 123-128
GUPTA, R. K. (1986): The Thar Desert. In: EVENARI, M. /NOY-MEIR, I. /GOODALL, D. W. (Hrsg.): Ecosytems of the world 12B. Hot deserts and arid shrublands, B, S. 55-100
HENDERSON, C. B. /PETERSEN, K. E. /REDAK, R. A. (1988): Spatial and temporal patterns in the seed bank and vegetation of a desert grassland community. Journal of Ecology 76, S. 717-728
JENNY, M. (1991): Diasporenausbreitung an ariden Standorten und ihre Klassifikation am Beispiel einer Annuellenflur im Wadi Araba (Jordanien). In: SCHMID, B. /STÖCKLIN, J. (Hrsg.): Populationsbiologie der Pflanzen; Basel, Boston, Berlin, S. 36-52 JENNY, M. /HALFMANN, J. (1993): Vergleichende ausbreitungsbiologische Analyse dreier physiognomisch ähnlicher Pflanzengemeinschaften arider und gemäßigter Zonen. Flora 188, S. 213-225
MEIDAN, E. (1990): The effects of soil water potential on seed germination of four winter annuals in the Negev Desert highlands, Israel. Journal of Arid Environments 19, S. 77-83 ORSHAN, G. (1986): The deserts of the Middle East. In: EVENARI, M. /NOY-MEIR, I. /GOODALL, D. W. (Hrsg.): Ecosytems of the world 12B. Hot deserts and arid shrublands, B, S. 1-28
PAKE, C. E. /VENABLE, D. L. (1995): Is coexistence of sonoran desert annuals mediated by temporal variability in reproductive success? Ecology 76 (1), S. 246-261 PAKE, C. E. /VENABLE, D. L. (1996): Seed banks in desert annuals: Implications for persistence and coexistence in variable environments. Ecology 77 (5), S. 1427-1435 SHIMADA, A. /EVENARI, M. /NOY-MEIR, I. (1986): Hot desert ecosystems: An integrated view. In: EVENARI, M. /NOY-MEIR, I. /GOODALL, D. W. (Hrsg.): Ecosytems of the world 12B. Hot deserts and arid shrublands, B, S. 379-388
WALTER, H. (1986): Allgemeine Geobotanik. 3. Aufl., Stuttgart
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit über Therophyten?
Die Arbeit untersucht die Anpassungsstrategien von Therophyten (einjährige Pflanzen) an die spezifischen Standortbedingungen in ariden Gebieten, insbesondere heißen Wüsten. Dabei werden die Anpassungen bei Keimung und Verbreitung betrachtet, die es diesen Pflanzen ermöglichen, die klimatischen Nischen (Regenperioden) auszunutzen und ihren Lebenszyklus in der kurzen, günstigen Jahreszeit abzuschließen.
Was sind typische Standortbedingungen für Therophyten?
Therophyten dominieren in extrem ariden Gebieten, in denen die Regenzeiten kurz, unvorhersehbar und unregelmäßig sind. Typisch sind große Schwankungen in der Wasserverfügbarkeit und lange Trockenperioden, extreme Hitze, Kälte und Lufttrockenheit. Die Vegetation beschränkt sich oft auf Mikrohabitate, in denen sich Oberflächenabfluss sammelt oder auf felsige Standorte.
Welche Anpassungsstrategien haben Therophyten entwickelt?
Therophyten passen sich an episodische Ressourcen an, indem sie diese schnell nutzen, eine hohe Reproduktionsrate haben und schnell von der aktiven zur nichtaktiven Phase des Lebenszyklus übergehen. Sie haben spezielle Keimungsstrategien entwickelt, um klimatische Nischen auszunutzen, einschließlich Dormanzzyklen, um die Keimung zu steuern. Außerdem weisen sie Anpassungen zur Samenverbreitung auf, um günstige Standorte zu erreichen, wobei oft Mechanismen zur Ausbreitungshemmung (Antitelechorie) eine wichtige Rolle spielen.
Wie funktioniert die Anpassung der Keimung bei Therophyten?
Therophyten haben Dormanzzyklen entwickelt, um die Keimung zu steuern. Einige Arten haben einen jährlichen Dormant/Nicht-Dormant-Zyklus, während andere einen jährlichen bedingt Dormant/Nicht-Dormant-Zyklus aufweisen. Dadurch wird sichergestellt, dass nicht alle Samen gleichzeitig keimen, um das Überleben der Population bei ungünstigen Bedingungen zu sichern. Auch die Dauer des Wasserangebots spielt eine wichtige Rolle, wobei die Samen schnell keimen müssen, bevor der Oberboden wieder austrocknet.
Welche Rolle spielt die Samenbank?
Die Samenbank ist ein wichtiger Teil der Populationen annueller Pflanzen in ariden Gebieten. Sie dient als Reservoir für Samen, die über längere Zeiträume im Boden verbleiben und bei günstigen Bedingungen keimen können. Die Samenbank ermöglicht es den Therophyten, auch in Jahren mit geringem Niederschlag oder ungünstigen Bedingungen zu überleben. Die Artenzusammensetzung der Samenbank entspricht oft der Vegetation, was auf eine lange Persistenz und/oder limitierende Verbreitung der Samen hindeutet.
Wie passen sich Therophyten an die Verbreitung an?
Die Verbreitung der Diasporen erfolgt oft durch Wind, Wasser oder Tiere, wobei aber häufig Mechanismen zur Ausbreitungshemmung (Antitelechorie) eine wichtige Rolle spielen. Die Samen werden durch Wind oder Wasser verbreitet, bleiben aber durch Schleim oder andere Mechanismen an günstigen Standorten haften. In schlechten Jahren werden nur atelechore Samen produziert. Auch die Samengröße ist ein Faktor, der den Reproduktionserfolg beeinflusst, da größere Samen ein schnelleres Wurzelwachstum ermöglichen.
Wie funktioniert Koexistenz und Konkurrenz bei Therophyten?
In heißen Wüsten koexistieren oft Winter- und Sommer-Floren, die durch Dürrezeiten getrennt sind. Eine starke negative Wechselbeziehung zwischen Winter- und Sommer-Gesellschaft kann bestehen, wobei eine große Anzahl von Pflanzen einer Jahreszeit die Keimung und/oder das Überleben in der folgenden Jahreszeit verhindern kann. Auch die Koexistenz bei Winter-Annuellen beruht auf der zeitlichen Variation der Samenbank und der artspezifischen Keimung. Konkurrenz tritt v.a. am Ende der Wachstumsperiode auf, die Effekte auf Populationdichte und Erbgut sind gering.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2000, Strategien und natürliche Lebensräume von Therophyten in ariden Gebieten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98181