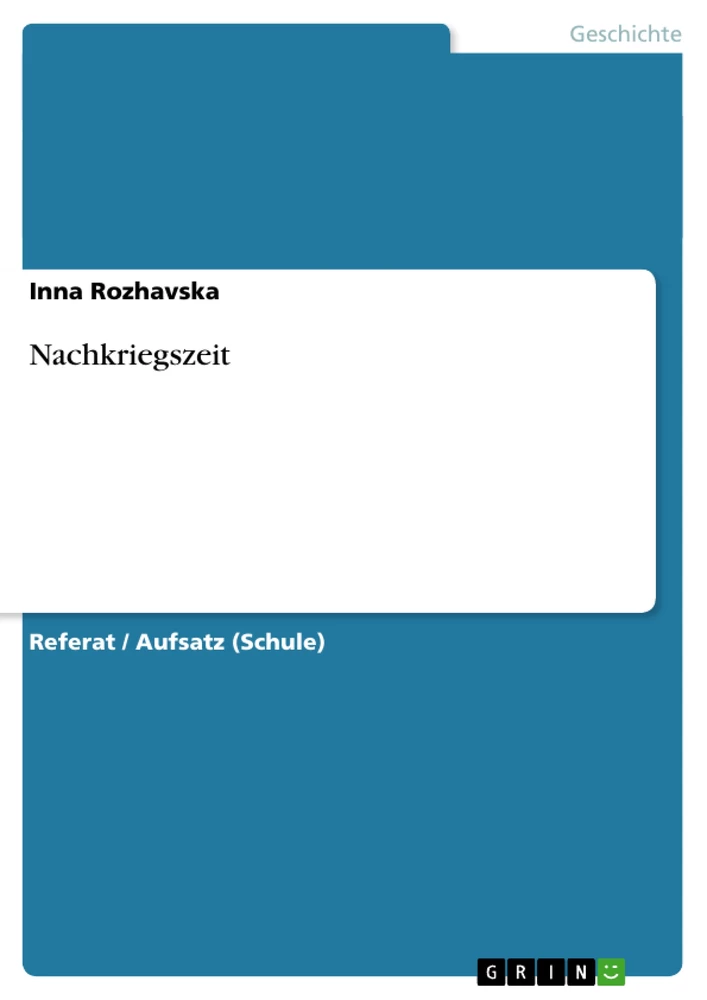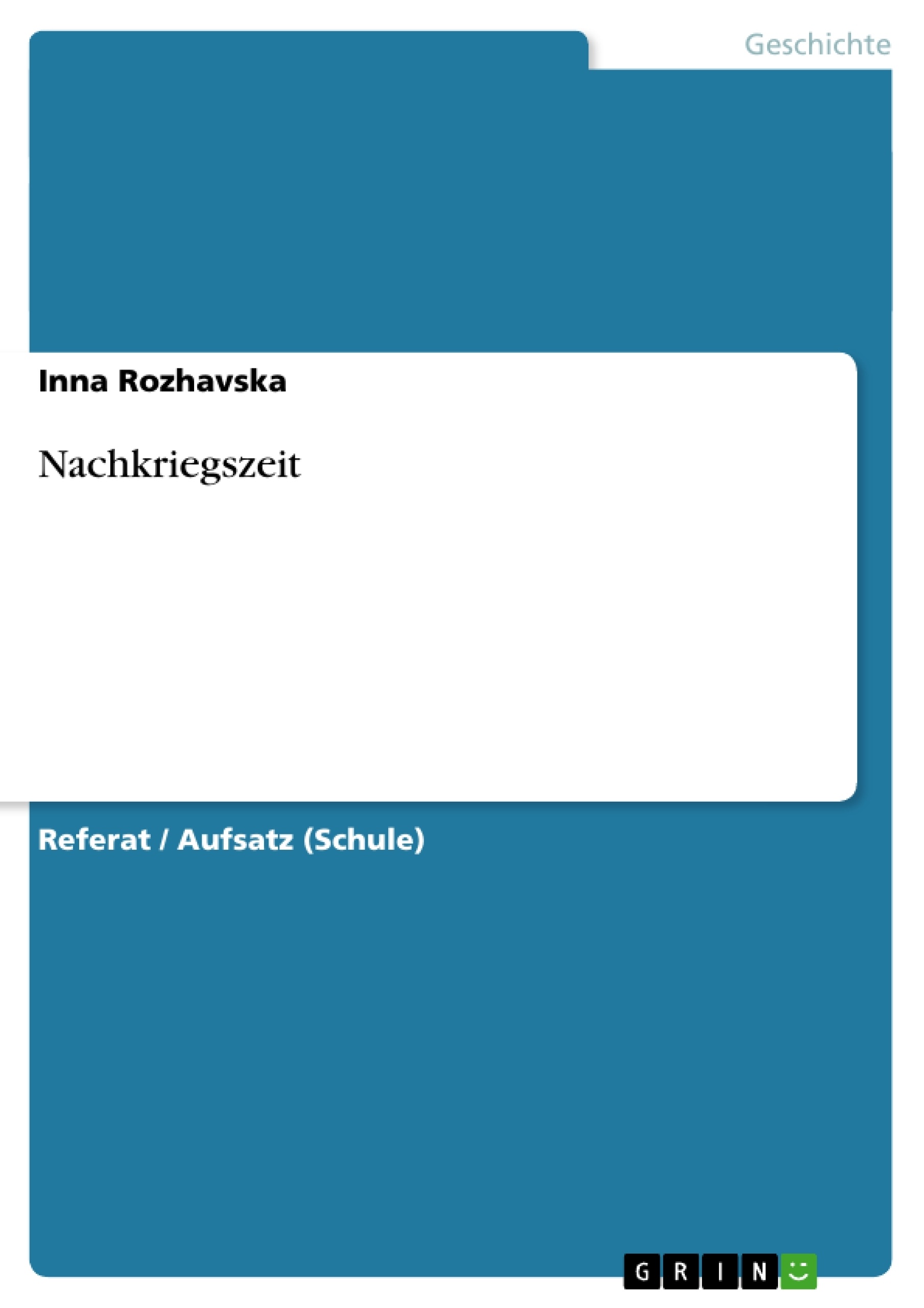Inna Rozhavska
Nachkriegszeit
Ich bin Jahrgang 1944. Meine Mutter führte bei einem Bomenangriff auf Hamburg die Nottaufe an mir durch.
Meine frühesten Erinnerungen reichen bis in das Jahr 1947, mein viertes Lebensjahr, zurück.
Mein Vater hatte im Krieg seinen rechten Arm verloren und litt Jahrzehnte lang an einem Kieferdurchschuss und je einem Steckschuss (Gewehrkugel) in der Schulter und in der Nähe des Herzens.
Unsere Wohnung nahe der Hamburger Innenstadt war teilweise zerbombt worden. Deshalb und weil außerdem noch meine Großmutter und mein Onkel mitsamt vierköpfiger Familie ausgebombt waren, zogen wir Anfang 1945 in eine kleine Dreizimmerwohnung am Hamburger Stadtrand. Dort mussten wir noch ein junges Flüchtlings-Ehepaar aufnehmen, obwohl wir schon zu Acht in den drei kleinen Zimmern und auf dem Dachboden zusammengepfercht lebten. Trinkwasser holten wir uns von der Handpumpe auf dem Hof. Das Klosett (Plumpsklo) war außerhalb in einem Schuppen.
Unsere "Kanonenöfen" (einfachste schmiedeeiserne Kohleöfen) wurden beschickt mit Abfallholz, Papierbriketts (kräftig zusammengedrehtes und dann angefeuchtetes Zeitungspapier), Pferdemist von der Straße und Kohle, die in gefährlichen Nacht-und-Nebel- Aktionen vom 7 km entfernten Güter-Verschiebe-Bahnhof entwendet waren. Der Bollerwagen (vierrädriger Handwagen) war damals ein unersetzliches Transportmittel.
Fahrräder hatten wir zunächst nicht.
Seife gab es in Pulverform in kleinen Papierbriefchen. Sie war - wie alle Lebens- und Haushaltsmittel - grammweise rationiert (Lebensmittelmarken, die man sich wöchentlich vom Ortsamt abholen musste).
Mein erstes Kaugummi - ein Geschenk von einer britischen Lady - war für alle etwas ganz Fremdes und Besonderes.
Zigaretten waren die Ersatzwährung. Man tauschte im Gegenwert gegen Zigaretten. Wenn ich mich recht erinnere, hatte eine Zigarette den Gegenwert von einer Reichsmark (vor der Währungsreform 1948).
Weil mein Vater Schwerkriegsbeschädigter (so hieß das) war, musste meine Mutter die notwendigen "Hamsterfahrten" machen. Sie zog zum Beispiel mit Eiern von den eigenen Hühnern, mit Äpfeln aus unserem Garten oder mit selbstgestrickten Sachen zum Fischereihafen in Hamburg-Altona, tauschte dort ein paar Fische ein, fuhr mit der Bahn in die Lüneburger Heide, tauschte bei den Bauern ein paar Fische gegen Mehl, Käse, Speck und Bienenhonig und kam dann schachmatt, aber mit vollem Rucksack, spät abends nach Hause. Noch mehr lohnte es sich aber, abgeerntete Felder nachzuernten (Kohl, Kartoffeln). Sehr viele Tage verbrachte ich mit meiner Mutter auch an den Waldrändern und an den Knicks (Hecken zwischen den Wiesen und Weiden). Dort pflückten wir eimerweise Himbeeren, Brombeeren und Holunderbeeren. Diese Früchte wurden - ebenso wie das Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten - eingeweckt und waren ein ganz wichtiges Nahrungsmittel für uns.
Neue Kleidung konnte man sich nicht leisten. Es gab ja auch kaum Fabriken, die sie herstellen konnten, und eingeführte Ware gab es auch kaum, weil der ganze Handel erst organisiert werden musste. Daher mussten die Pullover, Kleider, Anzüge, Strümpfe usw. geschont werden und - wenn sie es nötig hatten - geflickt werden.
Linderung in der Nachkriegsnot brachten die Care-Pakete aus den USA. Glücklich, wer davon etwas abbekam! Ich kann mich nicht erinnern, dass wir je ein Care-Paket bekommen hätten.
Sehr gut erinnere ich mich aber an das "Schwedenessen", das es in meiner Kindergartenzeit gab. Es handelte sich um einen von Schweden gestifteten, überhaupt nicht wohlschmeckenden Haferschleim, mit Wasser und - manchmal - Milchpulver angerührt, mit Salz etwas gewürzt. Ich weiß aber und wusste es schon damals, dass dieses Schwedenessen für viele Deutsche in der Hungersnot von 1947 überlebenswichtig war.
Die häufigen Straßenbahnfahrten in die Hamburger Innenstadt sind mir noch deutlich vor Augen. Wir fuhren fast täglich zum Hamburger Schlachthof, um nach Abfällen für unseren Hund zu fragen; aber eigentlich waren meine Eltern darauf aus, auf diese Weise Fleisch und Knochen zu bekommen, die auch für uns Menschen genießbar waren. Unsere Straßenbahnlinie führte durch die traurige Trümmerlandschaft der Hamburger Innenstadt.
Viele Straßen lagen noch unter Trümmerbergen. Oft nahmen wir in großen Eimern Steine mit nach Hause; wir klopften den alten Mörtel ab und konnten damit einen Windfang oder einen Kaninchenstall mauern.
Es muss 1949 gewesen sein, als meine Eltern - Vater schwerkriegsbeschädigt, Mutter erst Kinderpflegerin, dann Krankenschwester - in Heimarbeit Spielzeug-U-Bahn-Züge aus länglichen Holzklötzen herstellten. Viel Geld dürften sie für die Hunderte von Waggons nicht bekommen haben. Alle Spielsachen in der Nachkriegszeit waren selbstgemacht. So erinnere ich mich an einen großen, liebevoll gestalteten, üppig sortierten Kaufmannsladen (sogar mit elektrischem Licht), an ein Schaukelpferd und an eine Indianerausrüstung. Und - zu meinem 4. Geburtstag - an einen Roller. Da seine Räder aus Sperrholz waren, hatte ich nicht lange etwas von ihm. Denn die Straßen waren aufgerissen, und in ihren breiten, knietiefen Löchern hielt sich das Regenwasser tagelang. Meine Touren durch diese Meere nahmen die Holzräder sehr schnell krumm - im Wortsinne.
Unser Krämer fuhr noch mit dem Pferdewagen die Ware aus. Der Milchmann zog mit einer 50-Liter-Kanne auf einem großen Karren durch die Straßen, um seine Milch zu verkaufen.
An die Währungsreform von 1948 kann ich mich insofern noch gut erinnern, als die 10- Pfennig-Scheine ungültig wurden, die in meinem spärlich gefütterten und häufig geplünderten Sparschwein lagerten. Die Geschäfte waren mit einem Mal mit Waren gefüllt - wahrscheinlich waren sie in den letzten Tagen der Reichsmark im Lager zurückgehalten worden. Es gab plötzlich viel zu kaufen - aber richtig leisten konnte man es sich erst einige Jahre später. Für mich begann das deutsche Wirtschaftswunder, als ich zum 10. Geburtstag mein erstes nagelneues Fahrrad und zu Weihnachten 1954 einen einfachen Fotoapparat bekam. Auch die Möbel, die meine Eltern seit Kriegszeiten besaßen, konnten allmählich gegen neue ausgetauscht werden, und der alte "Volksempfänger" (oder "Goebbelsschreier", wie man die schwarzen Radiokästen damals nannte) wurde durch eine Musiktruhe mit Plattenwechsler ausgetauscht. Das war bei uns aber erst 1958.
Den Berlinern ging es noch lange schlecht. Ich glaube, bis 1955 musste auf jeden Brief neben der Briefmarke eine kleine blaue 2-Pf-Marke "Berliner Notopfer" geklebt werden.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in "Nachkriegszeit" von Inna Rozhavska?
Der Text ist eine persönliche Erinnerung von Inna Rozhavska an ihre Kindheit in der Nachkriegszeit in Hamburg, Deutschland. Er beschreibt die schwierigen Lebensbedingungen, den Mangel an Ressourcen und die kreativen Lösungen, mit denen ihre Familie und andere Menschen in dieser Zeit überlebten.
Was sind die frühesten Erinnerungen der Autorin?
Die frühesten Erinnerungen reichen bis ins Jahr 1947 zurück, als sie vier Jahre alt war. Sie erinnert sich an das Leben in einer kleinen Wohnung am Stadtrand von Hamburg mit vielen Familienmitgliedern und Flüchtlingen.
Wie war die Wohnsituation nach dem Krieg?
Die Familie lebte beengt in einer kleinen Dreizimmerwohnung mit vielen anderen Menschen. Trinkwasser wurde von einer Handpumpe geholt und die Toilette war ein Plumpsklo in einem Schuppen außerhalb des Hauses.
Wie wurde geheizt?
Die Familie heizte mit einfachen Kohleöfen, die mit Abfallholz, Papierbriketts, Pferdemist und Kohle befeuert wurden, die oft in gefährlichen Aktionen vom Güterbahnhof gestohlen wurde.
Wie sah die Versorgungslage aus?
Es herrschte großer Mangel an Lebensmitteln und Haushaltsmitteln. Alles war grammweise rationiert und man benötigte Lebensmittelmarken. Zigaretten dienten als Ersatzwährung.
Was waren "Hamsterfahrten"?
Da der Vater kriegsversehrt war, musste die Mutter "Hamsterfahrten" unternehmen, um Lebensmittel zu beschaffen. Sie tauschte Eier, Äpfel oder selbstgestrickte Sachen gegen Fisch, Mehl, Käse, Speck und Honig auf dem Fischereihafen und bei Bauern in der Lüneburger Heide.
Wie wurden Kleider beschafft?
Neue Kleidung war kaum erschwinglich. Vorhandene Kleidung wurde geschont und geflickt. Es gab kaum Fabriken, die Kleidung herstellten.
Was waren Care-Pakete und das "Schwedenessen"?
Care-Pakete aus den USA brachten Linderung in der Nachkriegsnot. Das "Schwedenessen" war ein Haferschleim, der von Schweden gestiftet wurde und für viele Menschen überlebenswichtig war.
Wie sah die Hamburger Innenstadt aus?
Die Hamburger Innenstadt war eine Trümmerlandschaft. Viele Straßen waren unter Trümmerbergen begraben. Die Familie sammelte Steine, um diese zum Bauen zu verwenden.
Wie wurden Spielsachen hergestellt?
Alle Spielsachen in der Nachkriegszeit waren selbstgemacht. Die Eltern stellten Spielzeug-U-Bahn-Züge aus Holzklötzen her. Die Autorin erinnert sich an einen Kaufmannsladen, ein Schaukelpferd und eine Indianerausrüstung.
Wie war die Situation in der Schule?
Die Schulzeit begann 1950 mit über 50 Kindern in einer Klasse. Es herrschte Lehrermangel und die Kinderzahl war nach dem Krieg stark gestiegen. Warmes Essen gab es nur in der ersten Schulzeit.
Wie erlebte die Autorin das Wirtschaftswunder?
Das deutsche Wirtschaftswunder begann für die Autorin, als sie zum 10. Geburtstag ihr erstes Fahrrad und zu Weihnachten 1954 einen Fotoapparat bekam. Auch die Möbel und der Volksempfänger wurden später durch neue ersetzt.
Was erfahren wir über Berlin in dieser Zeit?
Den Berlinern ging es lange schlecht und bis 1955 musste auf jeden Brief neben der Briefmarke eine kleine blaue 2-Pf-Marke "Berliner Notopfer" geklebt werden.
- Arbeit zitieren
- Inna Rozhavska (Autor:in), 2000, Nachkriegszeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98194