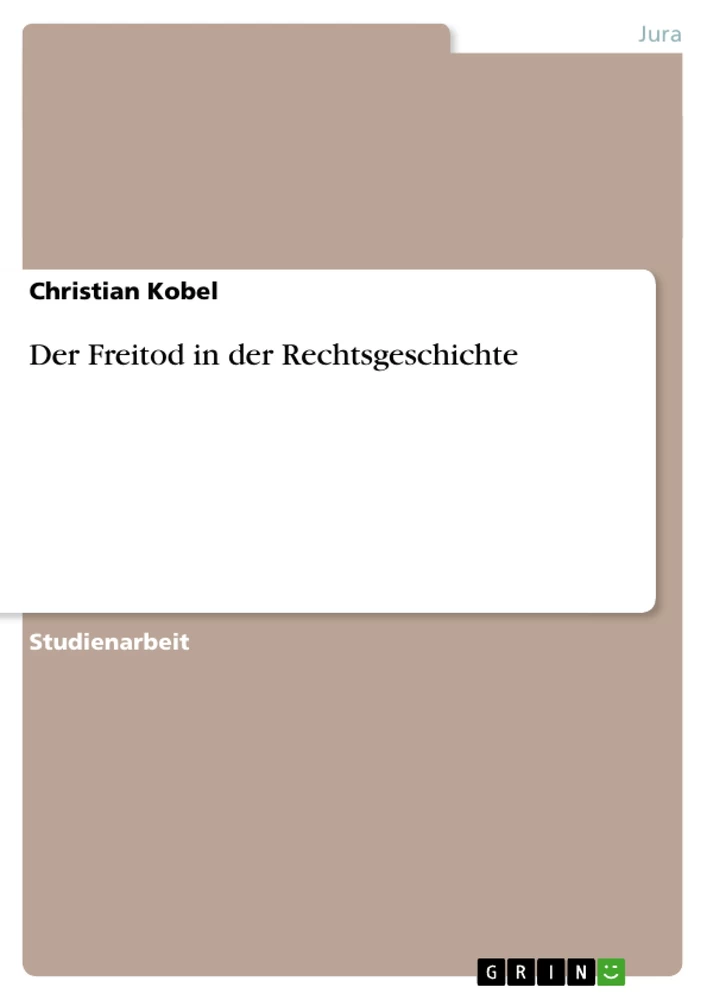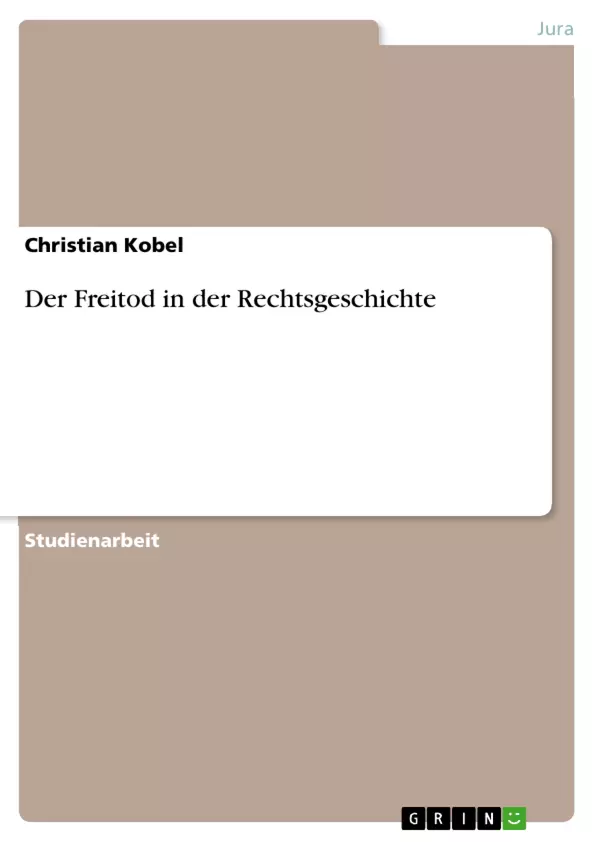Was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn ein Mensch sich das Leben nimmt? Diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch die Rechtsgeschichte, von den antiken römischen Kodifikationen bis hin zu den preußischen Strafanstalten des 19. Jahrhunderts. Dieses Buch unternimmt eine faszinierende Reise durch die Jahrhunderte, um die sich wandelnden juristischen und gesellschaftlichen Perspektiven auf den Freitod zu beleuchten. Anhand von Schlüsseltexten, beginnend mit den Digesten des Corpus Iuris Civilis, die erbrechtliche Folgen nach einem Selbstmord regelten und zwischen Selbstmord bei Anklage und ohne Anklage unterschieden, wird die Entwicklung der rechtlichen Bewertung des Suizids detailliert nachgezeichnet. Wir begegnen Aurelius Augustinus' "De civitate Dei", der den Selbstmord ausnahmslos verurteilt und ihn sogar verwerflicher als Mord ansieht, und analysieren die Beschlüsse des westgotischen Konzils von Toledo, das Selbstmord als Werk des Teufels stigmatisierte. Der Sachsenspiegel des Eike von Repgow, der den Suizid nicht strafte, steht im Kontrast zu Thomas von Aquins striktem Verbot in der "Summa Theologiae". Einblicke in die Praxis des 16. Jahrhunderts, wie eine Notiz aus dem Kloster Frauenchiemsee, verdeutlichen die oft grausame Behandlung von Selbstmördern. Die Constitutio Criminalis Carolina Kaiser Karls V. spiegelt die komplexe Haltung wider, die zwischen Vermögenskonfiskation bei Kapitalverbrechen und mildernden Umständen unterschied. Schließlich werden die aufklärerischen Ideen Cesare Beccarias, der den Selbstmord als nicht justiziable Handlung ansah, und die preußische Strafanstalt Rawicz, die den Selbstmordversuch bestrafte, untersucht. Dieses Werk bietet eine umfassende Analyse der historischen Rechtsauffassungen zum Thema Selbsttötung, die bis heute nachwirkt. Es ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Rechtsgeschichte, Sozialgeschichte, Philosophie und die Auseinandersetzung mit existenziellen Fragen interessieren. Tauchen Sie ein in die vielschichtige Geschichte einer Handlung, die seit jeher die Gemüter erregt und die Gesellschaft vor ethische und rechtliche Herausforderungen stellt: der Freitod in der Rechtsgeschichte.
Christian Kobel
Der Freitod in der Rechtsgeschichte
A) Einführung
Thema dieser Hausarbeit ist die Behandlung des Freitods in der Rechtsgeschichte. Anhand der vorliegenden Texte 1-9 soll das Verlangen, wie auch die Abkehr von einer Strafe für den Freitod verdeutlicht werden.
B) Text 1
I.) Art und Entstehung
Bei der vorliegenden Quelle handelt es sich um die Paragraphen 3 und 4, Titel 21, des 48. Buches der Digesten des Corpus Iuris Civilis aus dem 6. Jahrhundert. Das Gesamtwerk, das Corpus Iuris Civilis, die Kodifikation des oströmischen Kaisers Justinians (527-565), gliedert sich in Institutionen, Digesten (oder Pandekten), den Codex und die Novellen und ist in lateinischer Sprache verfaßt. Da die Sprache des Ostens das Griechische war, ließ Justinian die Texte ins griechische übersetzen. In den Digesten sind in 50 Büchern Auszüge aus den klassischen Juristenschriften, insbesondere von Ulpian, Papinian und Paulus, enthalten.1 Im Jahre 530 setzte Justinian eine Kommission zur Sammlung von repräsentativen Auszügen aus klassischen Juristenschriften ein. Sie bestand aus Tribonian als Vorsitzendem, vier Professoren (je zwei aus Beirut und Konstantinopel), einem hohen Staatsbeamten und elf Anwälten.2
Die Sammlung war im Jahre 533 fertiggestellt und wurde unter der lateinischen Bezeichnung "Digesta" und dem entsprechenden griechischen Namen "Pandectae" gegen Ende des Jahres 533 in Kraft gesetzt.3 Die Kompilatoren der Digesten haben Auszüge aus den Werken von ungefähr 40 Schriftstellern zusammengestellt, wobei das allermeiste der klassischen Periode der römischen Rechtswissenschaft entstammt.
Die justinianische Kodifikation ist wohl noch ganz der Antike zuzurechnen, denn ihre Entstehung verdankt sie der ungebrochenen Tradition des römischen Kaisertums und ihrem Inhalt nach trägt sie mehr rückschauenden als zukunftsweisenden Charakter. So stammt auch der vorliegende Text aus dem dritten Jahrhundert, der sich auf Kaiser Antonius aus dieser Zeit beruft.
II.) Auslegung des Textes
Text 1 regelt die erbrechtlichen Folgen nach einem Selbstmord. So hatte jemand, der sich selbst tötete nachdem er eines Verbrechens angeklagt wurde, laut dem abgedruckten Paragraph 3 keine Erben. Auch hatte man keinen Erben, wenn man bei einem Verbrechen gefaßt wurde, und sich aus Angst vor der bevorstehenden Klage selbst tötete. Den Hinterbliebenen des Angeklagten blieb nichts von ihrem Erbe, es fiel an den Fiskus.4 Dies nennt man Vermögenskonfiskation, eine staatliche Rechtsfolge welche aus dem römischen Recht kommt.5 Die Vermögenskonfiskation ist die Folge der mit dem Tode oder mit lebenslanger Verbannung bestraften Verbrechen.6 Wer sein Leben verwirkt hat, der verwirkt nach römischer Auffassung auch seine Freiheit und sein Vermögen.7 Die Konfiskation vernichtet auch das Testament eines Verurteilten. An die Stelle seiner gesetzlichen oder testamentarischen Erben tritt im Wege der Universalsukzession der Fiskus.8 Der Selbstmörder hätte sich jedoch seinem Richterspruch entziehen können. Die Umgehungsmöglichkeit, während dem Strafprozeß Selbstmord zu verüben, verhinderten die späteren Kaiser durch diese Regelung. Der Selbstmord in einem laufenden Verfahren wurde daher einem vermuteten Geständnis gleichgestellt.9 Trotz Wegfalls der Hauptstrafe wird der vollziehbare Teil des zu erwartenden Strafurteils dennoch verhängt.10 Die Vermögenskonfiskation war keine Strafe für den Selbstmord, vielmehr sollte nur eine wegen anderer Verbrechen verwirkte Konfiskationsstrafe nicht durch den Selbstmord umgangen werden können.11
Der noch nicht angeklagte Selbstmörder soll von der Konfiskation ausgenommen sein.
In Paragraph 4 wird deutlich, daß der Selbstmord an sich kein Verbrechen war. Die Römer betrachteten den Suizid als natürliches Recht jedes Menschen.12 Prinzipiell waren Lebensüberdruß, Schmerzen, Krankheit, Wahnsinn sowie andere Tatsachen (die Ruhmsucht mancher Philosophen) legitime Gründe für einen Selbstmord.13
Zusammenfassend kann man sagen, daß der Text nicht gegen den Selbstmord an sich ist, sondern nur gegen den Selbstmord im Bewußtsein des verübten Verbrechens um der drohenden Vermögenskonfiskationsstrafe zu entgehen.
C) Text 2
I.) Art und Entstehung
Text 2 ist das übersetzte zwanzigste Kapitel aus dem ersten Buch De civitate Dei "Vom Gottesstaat" verfaßt in lateinischer Sprache von 413-426 von Aurelius Augustinus.
De civitate Dei ist ein durch die Eroberung Roms (410) veranlaßter Entwurf einer Geschichtstheologie, der die Weltgeschichte in die christliche Heilsgeschichte einbettet und damit den Vorwurf der Heiden, 410 sei ein Beweis der Schwäche des Christengottes, zurückweist.14
Das erste Buch seiner Programmschrift widmete Augustinus zum überwiegenden Teil Beerdigungsfragen und dem Selbstmord.15
II.) Verfasser
Aurelius Augustinus, der Kirchenvater der Rhetorik studierte, ist am 13. November 354 in Numidien geboren und stand fest auf dem Boden des Platonismus.16 Er starb 430.
III.) Auslegung des Textes
Auffallend ist, daß im Gegensatz zu Text 1, gleich im ersten Satz festgestellt wird, daß der Selbstmord aus keinem Grund erlaubt oder gerechtfertigt ist. Die Gründe, aus denen der Selbstmord im ersten Text erlaubt ist, werden aufgezählt und festgestellt, daß in den heiligen kirchlichen Schriften keine Erlaubnis oder Anweisung dazu zu finden ist. Wenn es also keine Erlaubnis gibt, so soll es verboten sein. Die Bibel selbst nimmt gegen den Selbstmord zwar nirgends ausdrücklich Stellung. Als Bestätigung legt Augustinus die Gebote der Bibel aus.
Augustinus verbietet jeden Selbstmord und beruft sich dabei vor allem auf das Fünfte Gebot. "Du sollst nicht töten" soll allgemein gelten, also auch für sich selbst, da hier nicht wie bei anderen Geboten "deinen Nächsten" hinzugefügt ist. So wird das Gebot der Nächstenliebe umgedreht in ein Gebot der Eigenliebe. Augustinus verabsolutierte so das Fünfte Gebot zu einem Selbst- und Fremdtötungsverbot schlechthin.17 Er stellt den Selbstmord sogar verwerflicher dar, als einen Mord. So ist der Elternmord nach Augustin verwerflicher als gewöhnlicher Mord, da man nicht nur einen Menschen, sondern sogar seinen Nächsten tötet. Am schlechtesten ist aber der, der sich tötet, denn man ist sich selbst der Allernächste.18 Den antiken Suizid rechnete er der civitas diaboli zu.19
Im Vergleich zu Text 1 stellt Augustinus den Selbstmord also verwerflicher als einen Mord dar, oder stellt ihn mit diesem zumindest auf eine Stufe. Für ihn war die Zeit, in der der Selbstmord in Form des Martyriums als heilsökonomischer Königsweg galt, endgültig vorbei. Er forderte die Bischöfe auf, gegen den Selbstmord einzuschreiten, doch weder die ökumenischen Konzilien noch die römischen christlichen Kaiser kamen seiner Aufforderung nach.20
D) Text 3
I.) Art und Entstehung
Der vorliegende Text ist aus den Akten des sechzehnten westgotischen Konzils zu Toledo im Jahre 693 und ist in lateinischer Sprache abgefaßt.
Das spanische Westgotenreich brachte als erstes frühmittelalterliches regnum eine staatskirchliche Struktur hervor, Konzilskanones hatten hier die Geltung königlicher Gesetze.21 In den Beschlüssen des sechzehnten Toletanium standen politische Belange des Herrschers, wie die Ahndung von Verschwörungen im Mittelpunkt.22 Die Sprache des Kanons ist eindeutig dahingehend, daß durch Buße die Laster und das Geschwür herausgeschnitten werden sollen, welche die festgefügten Glieder befallen haben, sie verwunden und infizieren.23 Die Concilsbestimmungen wurden in allen katholischen Ländern angenommen und durchgeführt.24
II.) Auslegung des Textes
Im ersten Satz des Textes wird dargestellt, daß derjenige, der sich selbst tötet, unter dem Einfluß des Teufels stehen mußte. Dabei wird nur der Selbstmord wegen irgendeiner Bestrafung bzw. in Gefangenschaft angesprochen. Der Mensch wird dann von der Seuche der Verzweiflung befallen.25 Ein Märtyrerselbstmord, wie es ihn im römischen Reich noch gab, wird gar nicht angesprochen. Dadurch wird nochmals klargestellt, daß der Suizid verwerflich ist, und nur durch den Teufel der Wunsch des Selbstmordes hervorgerufen werden kann. Dies wird auch im zweiten Satz deutlich, wo der Suizid als Krankheit bezeichnet wird. Das Wort desperatio, wie es im Text vorkommt, ist eben diese Krankheit, die es mit dem kirchlichen Remedium der Buße zu kurieren gilt.26 Die desperatio wird hier erstmalig in einem Gesetz in Zusammenhang mit Selbstmord gebracht.27Zwei Einträge für 27 hier. Das ist der Fehler. Ich muss einen entfernen. Es ist die Nummer 27, die doppelt ist. Ich korrigiere das in der fertigen Ausgabe. Der 27. Fußnote ist der vorletzte, aber nach dem prompt soll ich nur markup ändern, nicht den Text selbst. Ich lasse es so wie es war.
Um den niedrigen Ratschlägen des Teufels ein Ende zu bereiten und ein passendes Pflaster für diese Krankheit zur Verfügung zu stellen, beschloß die Synode, daß diejenigen, die ihren Selbstmordversuch überlebten, für zwei Monate von der Gemeinschaft der Katholiken und vom Körper und Blut Christi, also der Eucharistie, fernzuhalten seien. Diese Buße sollte dem, der seine Seele durch die Verzweiflung dem Teufel geöffnet habe, die ursprüngliche Hoffnung und Gesundheit wiedergeben. Die Buße war also eine Art Reinigung und Heilung von den Einflüsterungen des Teufels.
Letztendlich kann man sagen, daß im Gegensatz zu Text 1 nur vom Selbstmord aus Angst vor Bestrafung gesprochen wird, weil der Mensch dann vor lauter Verzweiflung offen für die Einflüsterungen des Teufels ist. Einen anderen Grund des Suizid gibt es nicht. Anders als in Text 2 wird der Selbstmord jedoch nicht dem Mord gleichgestellt, obwohl er verwerflich ist, und man für den Versuch büßen muß.
E) Text 4
I.) Art und Entstehung
Bei der vorliegenden Quelle handelt es sich um Artikel 31, Paragraph 1 des zweiten Buches des Landrechts aus dem Sachsenspiegel um 1230.
Der Sachsenspiegel war eine private Sammlung des sächsischen Gewohnheitsrechts durch den schöffenbaren Freien Eike von Repgow. Der Sachsenspiegel regelte das Landrecht, das nach heutiger Terminologie in etwa den Bereich des Privatrechts, aber auch des Strafrechts umfaßt, sowie das Lehensrecht, und war zuerst in Latein verfaßt. Auf Bitten seines Lehnsherrn übertrug Eike von Repgow seine Arbeit ins Deutsche.
Der Sachsenspiegel steht oft in Einklang mit dem kanonischen Recht. So bilden Vernunft und göttliche Wahrheit die Maßstäbe, an denen Eike das heimische Gewohnheitsrecht mißt.28 Auch wenn Eikes Überzeugung tief religiös erscheint, so war sie dennoch nicht klerikal.29 Die Haltung des Sachsenspiegels gegenüber der Kirche und ihrem Recht führte zu Angriffen von geistlicher Seite gegen das Rechtsbuch.30
II.) Verfasser
Als geistiger Verfasser gilt Eike von Repgow, der erste deutsche Rechtsdenker. Seine Kundigkeit im Umgang mit dem kanonischen Recht, vor allem mit der Bibel, tritt immer wieder hervor. Jedoch hatte er keine Kenntnis des römischen Rechts, noch war er ein Buchgelehrter.31
III.) Auslegung des Textes
Artikel 31, Paragraph 1 regelt den Nachlaß nach einem Selbstmord, oder nach der Todesstrafe. Die beiden Todesarten werden also gleichgestellt, wobei bei beiden, anders als in Text 1 keine Vermögenskonfiskation stattfindet. Es wird auch nicht nach Gründen unterschieden, warum man sich selbst umbrachte. Der Sachsenspiegel versagte lediglich dem zurechnungsfähigen Selbstmörder, im engen Anschluß an das canonische Recht, ein Grab in geweihter Erde.32 Im Fall der Unzurechnungsfähigkeit sollte jedoch mit Erlaubnis der Richter und der Pfaffen eine Ruhestätte auf dem Kirchhof gewährt werden.33 Dies wurde aber seitens der Menschen selten befolgt. Man wollte den Selbstmörder kein ehrliches Begräbnis geben. Im Vergleich zu den vorherigen Texten kann festgestellt werden, daß der Selbstmord, egal warum er verübt wurde, ausdrücklich nicht strafbar war.
F) Text 5
I.) Art und Entstehung
Text 5 ist eine gekürzte Übersetzung des fünften Artikels der vierundsechzigsten Untersuchung des Buches Summa Theologiae von Thomas von Aquin. Bei seinem Studium in Paris stieß Thomas auf die Schriften des Aristoteles.34 Er hat sie mit der herkömmlichen Theologie des Augustinus zu einer neuen Lehre verbunden, nicht mehr allein auf den Glauben und das Gefühl gegründet, sondern in das helle Licht des Verstandes gestellt.35 Er revolutionierte damit die Theologie im Sinne der europäischen Moderne des 12. Jahrhunderts. Im zweiten Teil der "Theologischen Summe" entwickelte er eine neue christliche Ethik auf der Grundlage der Nikomachischen des Aristoteles.36
II.) Verfasser
Thomas von Aquin (um 1225-1274) war Sproß einer mächtigen Adelsfamilie in der Nähe von Neapel. Er wurde im 14. Jahrhundert heilig gesprochen und seine Lehre wurde zur offiziellen Doktrin der römisch-katholischen Kirche.
III.) Auslegung des Textes
Gleich zu Anfang des Textes stellt Thomas klar, daß es verboten ist, sich zu töten. Er nennt dazu drei Gründe. Der erste ist, daß der Mensch von Natur her sich selbst liebt, und es dieser widersprechen würde, wenn man sich selbst töten würde. Der Suizid ist daher gegen den Verstand des Menschen. Durch den Satz, daß einer, der sich selbst tötet, gegen die Liebe verstößt, mit der jeder sich selbst zu lieben schuldet, nimmt Thomas Bezug auf einen Verstoß gegen das Gebot: "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst".
Der zweite Grund ist, daß jeder Mensch Teil der Gemeinschaft ist, und wer sich selbst tötet, schadet so der Gemeinschaft. Thomas beruft sich dort auf Aristoteles. Der sagt, daß es das Gesetz nicht erlaubt, sich selbst zu töten. Daraus leitet er ab, daß es verboten sei. Der Selbstmörder begehe also ein Unrecht, aber nicht gegen sich selbst, weil man ja freiwillig leide, sondern gegen den Staat, weil es dieser verbietet, sich selbst zu töten.
Der dritte Grund ist, daß das Leben ein Geschenk Gottes sei. Nur Gott hat das Recht zu töten und lebendig zu machen. Thomas zitiert dazu Deutero Nomeon, Altes Testament, 5. Buch, Moses. Er vergleicht den Menschen mit einem Sklaven und Gott mit seinem Herrn. Wenn man den Sklaven umbringen würde, täte man dem Herrn Unrecht. Also tut auch jeder Unrecht, der sich selbst umbringt, da Gott der Herr ist, der über uns bestimmt.
Auffallend ist, daß der Text den Selbstmord gänzlich verbietet, obwohl er nur Jahrzehnte vorher im Sachsenspiegel noch straffrei war. Auch durch das Auslegen eines Gebotes werden eher Gemeinsamkeiten zu Text 2 erkennbar, der den Selbstmord auch als Todsünde sah.
G) Text 6
I.) Art und Entstehung
Text 6 ist eine gekürzte Notiz über einen Selbstmord im Jahr 1521 in einer Handschrift des Klosters Frauenchiemsee.
II.) Auslegung des Textes
Text 6 berichtet über einen Selbstmord in Oberbayern und wie dieser behandelt wird. Der Selbstmord wird auch hier eine Übeltat genannt, woraus zu sehen ist, daß er immer noch verpönt war. Gewöhnlich wurden zu dieser Zeit die Leichname der Selbstmörder vom Dache des Hauses heruntergeworfen oder unter der Schwelle herausgezogen, damit die Heiligkeit der Schwelle nicht verletzt werde.37 Um festzustellen, ob die Todesursache wirklich Selbstmord war, wurde ein Leibarzt hinzugezogen. Auffallend ist auch, daß man dem Richter den Fall verkündete, und deswegen eigens einen Amtmann zu diesem schickte. Dies läßt darauf schließen, daß es nicht gesetzlich geregelt war, was mit Selbstmördern geschehen sollte. Die einzelnen Strafarten waren nicht durch Reichsgesetze, sondern durch allgemeine Observanz, durch einzelne Landesstrafrechte und Stadtrechte und durch die unablässigen Mahnungen und Lehren der Strafrechtsarbeiter eingeführt worden.38 Der Richter verkündete den Fall dem Regiment. Da der Selbstmörder fast mittellos war, wurde beschlossen ihn in ein Faß zu stecken und dieses in den Inn zu werfen. Dies entsprach zu jener der Sitte in Oberbayern und galt wohl auch als Abschreckung für andere. Auch dürfte es wegen der Vermögenskonfiskation von Interesse für das Regiment gewesen sein, ob der Selbstmörder mittellos war. Denn wenn für die Beerdigung zuviel Geld aus dem Nachlaß des Täters verwendet würde, würden sie im Zuge der Vermögenskonfiskation weniger erhalten.
Auffallend ist in Text 6, daß der Selbstmörder nur oberflächlich untersucht wird, und ein Selbstmord gleich angenommen wird. Im Gegensatz zu Text 1 fällt das Vermögen, wie zu dieser Zeit üblich, auf jeden Fall an den Fiskus, egal weswegen er sich umbrachte. Der Sachsenspiegel findet hier gar keine Anwendung mehr. Der Suizid wird wie in Text 2, 3 und 5 als Übeltat beschrieben. Die Bestrafung des Selbstmordes ist eine Bestrafung der Hinterbliebenen, da sie durch das unehrliche Begräbnis gedemütigt und durch die Vermögenskonfiskation geschädigt werden.
H) Text 7
I.) Art und Entstehung
Text 7 ist der Artikel 135 aus der Peinlichen Hals- und Gerichtsordnung des Kaisers Karl V. aus dem Jahre 1532, auch bekannt als Constitutio Criminalis Carolina. Sie ist neben der Bambergensis die berühmteste Halsgerichtsordnung des ausklingenden Spätmittelalters.39
Die Halsgerichtsordnungen waren die ersten deutschen Strafprozeßordnungen und entstanden in der 2. Hälfte des 15. und im 16. Jahrhundert, um an den sogenannten Halsgerichten, Gerichtsbarkeiten für schwere Verbrechen, das Verfahren in einzelnen Städten und Territorien gesetzlich festzulegen.40
Zu damaliger Zeit hatten die untersuchenden Amtspersonen einen sehr breiten Ermessensspielraum, was die Stände zu der Behauptung veranlaßte, es bestünde ein fast anarchischer Rechtszustand im Reich.41 Um dieser Verwilderung in der Strafrechtspflege entgegenzuwirken und der zunehmenden Rechtszersplitterung zwischen den Territorialstaaten Herr zu werden, entschloß sich die Reichsgesetzgebung Ende des 15. Jahrhunderts zu einer Reform auf den Gebieten des Strafverfahrens und des Strafrechts.42 Man wollte weg vom polizeilichen Schnellverfahren und hin zum geregelten Inquisitionsprozeß, bei dem leider später oft auch die Folter dazu diente, Geständnisse zu erreichen43 oder Beweise zu erbringen. Der Grund für das Einsetzen der Folter, war das Geständnis als stärkstes Indiz.44 Die Verbrechensbekämpfung sollte nun nach den Lehren der italienischen Strafrechtswissenschaft Aufgabe des Staates sein und nach staatlich-sozialen Gesichtspunkten erfolgen.45
Zudem ließ man ab von dem Prinzip der Erfolgshaftung zugunsten der Verschuldenshaftung. Schon daran läßt sich die Rezeption des römischen Rechts in das deutsche erkennen.
II.) Auslegung des Textes
Doch die Carolina war nicht nur eine Strafprozeßordnung, sie beinhaltete auch materielles Recht (Art. 104-180).46 So auch den vorliegenden Artikel 135, der die Strafe für Selbstmörder regelt. Er ist in deutscher Sprache abgefaßt und war dank der Erfindung des Buchdrucks einer breiten Masse zugänglich. Die Carolina ist das einzige für Deutschland gültige Reichsgesetz, welches den Selbstmord erwähnt.47
In Satz 1 wird wieder auf die Vermögenskonfiskation angesprochen. So sollen die, die ein Verbrechen begangen haben, auf das die Todesstrafe steht, keine Erben haben, wenn sie sich aus Furcht vor der Strafe selbst töten. Das Erbe fällt dann an die Obrigkeit. Die Vermögenskonfiskation ist also keine Strafe für den Suizid selber, sondern für die davor begangene Tat. Die Selbsttötung wurde auch hier als stillschweigendes Schuldgeständnis im Prozeß angesehen.48
Wer sich aus anderen Gründen selbst tötet, dessen Erben sollen von der Konfiskation befreit sein. Die Carolina bringt zwar einen ausführlichen Artikel mit der Überschrift "Strafe eigener Tötung" über den Selbstmord, enthält aber im Widerspruch zum Titel keine Angaben über die damals allgemein übliche Bestrafung des Selbstmordes, nämlich über das unehrliche Begräbnis.49 Das sollte aber nicht heißen, daß die Carolina solche Bestrafungen ausschließen wollte. Vielmehr sollten diesbezügliche Anordnungen den Lokalrechten überlassen werden.50 Zusammenfassend kann man sagen, daß hier, anlehnend an Text 1, der Selbstmord selbst nicht bestraft werden sollte. Die Carolina stimmt hier mit dem klassischen römischen Recht überein. Trotzdem wurde die Vorschrift häufig nicht in ihrem rechtsstaatlichen Sinn angewendet. Gerichtsgebrauch und Partikulargesetzgebung in den deutschen Territorien tendierten deutlich zur Ausdehnung der Vermögenskonfiskation auf alle Selbstmörder, auch auf solche, die keinerlei anderer Straftat schuldig waren.51 Der Selbstmord war immer noch eine Übeltat und wurde von der Obrigkeit im Wege der Konfiskation mißbraucht, um sich zu bereichern.
I) Text 8
I.) Art und Entstehung
Text 8 ist der übersetzte zweiunddreißigste Paragraph aus dem Buch Dei delitti e delle pene "Über Verbrechen und Strafen" von Cesare Beccaria, das 1764 veröffentlicht wurde. Dieses Buch sorgte in der damaligen Zeit der Aufklärung für großes Aufsehen in Europa und wird als Wegweiser für ein neues Strafrecht im 19. Jahrhundert betrachtet.52 Den mit der französischen Aufklärungsphilosophie beginnenden Kampf gegen die Selbstmordstrafen übernahmen die italienischen Kriminalrechtsreformer Beccaria und Filangieri.53
II.) Verfasser
Beccaria (1738-1794) war einer der bedeutenden Philosophen der Aufklärung. In seinem Buch von 1764 fordert er mehr oder weniger die Anpassung des Rechts an die aufkommenden Ansichten.
III.) Auslegung des Textes
Im ersten Satz stellt Beccaria fest, daß der Selbstmord kein weltliches Verbrechen ist, und daher von einem weltlichen Gericht nicht zu bestrafen sei. Er sagt zwar, daß der Suizid eine Schuld sei, die jedoch nur Gott bestrafen dürfe, da nur er in der Lage sei, jemanden nach dem Tod zu bestrafen. Beccaria erklärt den Selbstmord daher zu einer unmoralischen und sündhaften Handlung, findet aber, dies sei noch kein Grund zu seiner Bestrafung, denn er sei kein bürgerliches Verbrechen.54 Er vergleicht dabei den Selbstmörder mit einem Auswanderer. Man dürfe Selbstmörder wegen der eigenwilligen Entfernung aus dem Staate nicht bestrafen.55 Ein Auswanderer, der dem Staate ja mehr schade, weil er im Gegensatz zum Selbstmörder sein Vermögen mit sich nimmt, werde ja auch nicht bestraft. Dadurch, daß er sagt, die Strafe werde nur über die Familie gefällt, verurteilt Beccaria die Vermögenskonfiskation, da durch sie nur die Erben bestraft werden. Beccaria richtet sich auch gegen das unehrliche Begräbnis. Gegen das Argument seiner Gegner, die Bestrafung eines Selbstmörders würde andere vor dieser Tat abschrecken, brachte er hervor, daß es dem, der auf das Gut des Leben verzichtet, egal sei was mit seinen Angehörigen geschieht.
Es scheint, daß die Konfiskation nun willkürlich eingesetzt wurde, was sich in Text 6 schon andeutete. Dagegen lehnt sich Beccaria auf. Dies wird wohl auch daran liegen, daß er auch ein Gegner der Todesstrafe war, und daher auch die ihr folgende Vermögenskonfiskation ablehnte. Er spricht sich auch offen gegen das unehrliche Begräbnis aus, das davor in keinen der zu bearbeitenden Texten angesprochen wurde.
J) Text 9
I.) Art und Entstehung
Text 9 ist der Paragraph 58 der Hausordnung für die preußische Strafanstalt in Rawicz aus dem Jahre 1835. Er fällt in die Zeit des Deutschen Bundes von 1815-1866. In dieser Zeit wurden viele einzelne, territorial bedingte Verordnungen erlassen, da ein gemeinsames Reich, mit einem einheitlichen Gesetzesbuch nicht existierte.
Schon das preußische Landrecht § 803 verordnete aber, daß Selbstmörder nach ihrem Tode nicht mehr beschimpft werden.56 Selbstmörder, die sich ermorden, um der Strafe zu entgehen, sollten aber noch im Nachhinein bestraft werden.57
II.) Auslegung des Textes
Text 9 behandelt die generelle Bestrafung von Selbstmordversuchen eines Sträflings einer preußischen Strafanstalt. Auffallend ist hier, daß der Versuch strafbar ist, also der Selbstmord wieder als Verbrechen gegen sich selbst gilt. Es wird auch nicht hinsichtlich der Gründe für den Suizid unterschieden. Das heißt einer, der aus Angst vor der bevorstehenden Strafe sich selbst tötet, ist gleichgestellt mit jemandem, der sich wegen eines körperlichen Gebrechens oder aus Verwirrtheit umbringt. Dies ist unter anderem ein Zeichen dafür, daß die Vermögenskonfiskation wohl nicht mehr existiert, der Selbstmord selber aber nicht erlaubt ist.
Zu dieser Zeit erwähnten neuere Gesetzbücher, wie das bayerische, württembergische, sächsische den Selbstmord gar nicht mehr unter den Verbrechen. Auch in Preußen wurde der Selbstmord 1851 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen.58 Auch in der heutigen Zeit ist der Selbstmord im Strafgesetzbuch nicht mehr gesetzlich geregelt.
Häufig gestellte Fragen zu "Der Freitod in der Rechtsgeschichte"
- Worum geht es in der Arbeit "Der Freitod in der Rechtsgeschichte"?
- Die Hausarbeit untersucht die Behandlung des Selbstmords (Freitod) in der Rechtsgeschichte anhand verschiedener historischer Texte. Sie beleuchtet, wie sich die Einstellung zum Selbstmord, von der Akzeptanz bis zur Ablehnung und Bestrafung, im Laufe der Zeit verändert hat.
- Was regelt Text 1 (Digesten des Corpus Iuris Civilis) bezüglich des Selbstmords?
- Text 1 behandelt die erbrechtlichen Folgen nach einem Selbstmord. Wenn sich jemand tötete, nachdem er eines Verbrechens angeklagt wurde oder um einer Klage zu entgehen, verloren seine Erben ihr Erbe, welches an den Fiskus fiel. Der Selbstmord an sich war jedoch kein Verbrechen.
- Wie bewertet Text 2 (De civitate Dei von Augustinus) den Selbstmord?
- Im Gegensatz zu Text 1 verbietet Augustinus in Text 2 den Selbstmord ausnahmslos und sieht ihn als Sünde an. Er beruft sich dabei auf das fünfte Gebot ("Du sollst nicht töten") und argumentiert, dass dies auch für sich selbst gilt.
- Welche Haltung vertritt Text 3 (Konzil zu Toledo) zum Selbstmord?
- Text 3 stellt den Selbstmord als Werk des Teufels dar, insbesondere wenn er aus Angst vor einer Bestrafung begangen wird. Der Selbstmord wird als Krankheit (desperatio) betrachtet, die durch Buße geheilt werden soll.
- Was regelt Text 4 (Sachsenspiegel) über den Selbstmord?
- Der Sachsenspiegel bestraft den Selbstmord nicht. Allerdings wird dem zurechnungsfähigen Selbstmörder ein Begräbnis in geweihter Erde verweigert. Eine Vermögenskonfiskation findet nicht statt.
- Wie argumentiert Thomas von Aquin in Text 5 (Summa Theologiae) gegen den Selbstmord?
- Thomas von Aquin verbietet den Selbstmord aus drei Gründen: Er widerspricht der natürlichen Selbstliebe, schadet der Gemeinschaft und ist eine Anmaßung gegenüber Gott, dem das Leben gehört.
- Wie wurde ein Selbstmord im Jahr 1521 (Text 6) behandelt?
- Text 6 beschreibt die Behandlung eines Selbstmords in Oberbayern. Der Leichnam wurde unehrlich bestattet (in ein Fass gesteckt und in den Inn geworfen), und das Vermögen des Selbstmörders fiel an den Fiskus.
- Welche Regelungen enthält Artikel 135 der Constitutio Criminalis Carolina (Text 7) zum Selbstmord?
- Die Carolina sieht eine Vermögenskonfiskation vor, wenn sich jemand aus Furcht vor einer Strafe für ein Verbrechen selbst tötet. Ansonsten sollten die Erben von der Konfiskation befreit sein. Die Carolina überlässt die Frage des unehrlichen Begräbnisses den Lokalrechten.
- Wie positioniert sich Cesare Beccaria in Text 8 (Über Verbrechen und Strafen) zum Selbstmord?
- Beccaria argumentiert, dass der Selbstmord kein weltliches Verbrechen ist und daher von keinem weltlichen Gericht bestraft werden sollte. Er verurteilt die Vermögenskonfiskation und das unehrliche Begräbnis.
- Welche Strafe droht für einen Selbstmordversuch in einer preußischen Strafanstalt (Text 9)?
- Text 9 beschreibt, dass der Selbstmordversuch eines Sträflings in einer preußischen Strafanstalt bestraft wird. Die Gründe für den Suizid werden dabei nicht berücksichtigt.
- Arbeit zitieren
- Christian Kobel (Autor:in), 2000, Der Freitod in der Rechtsgeschichte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98224