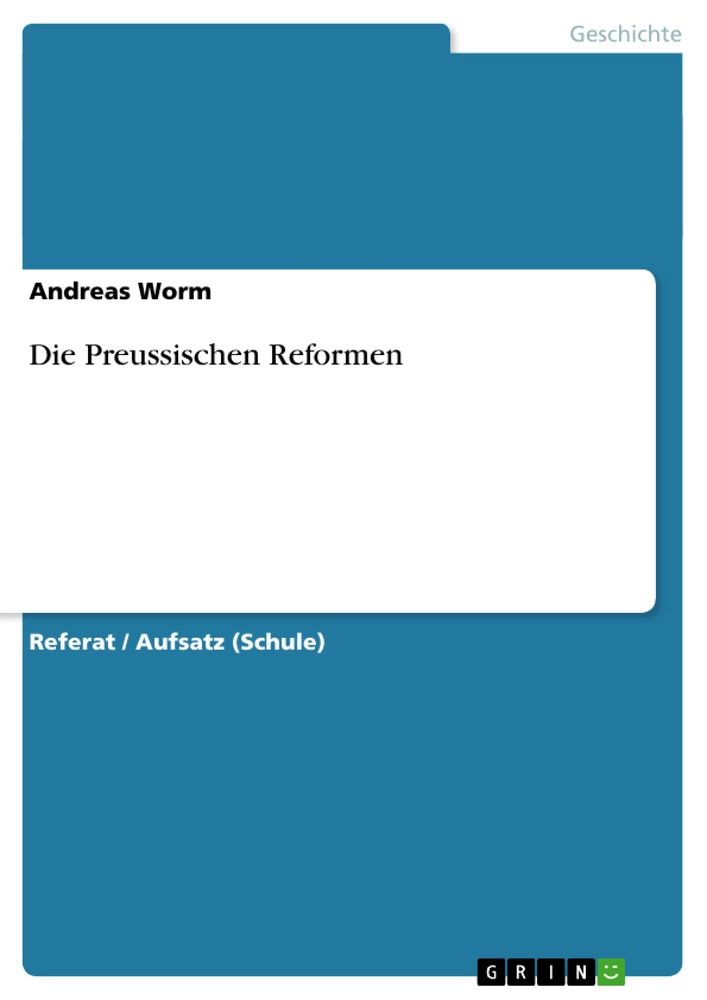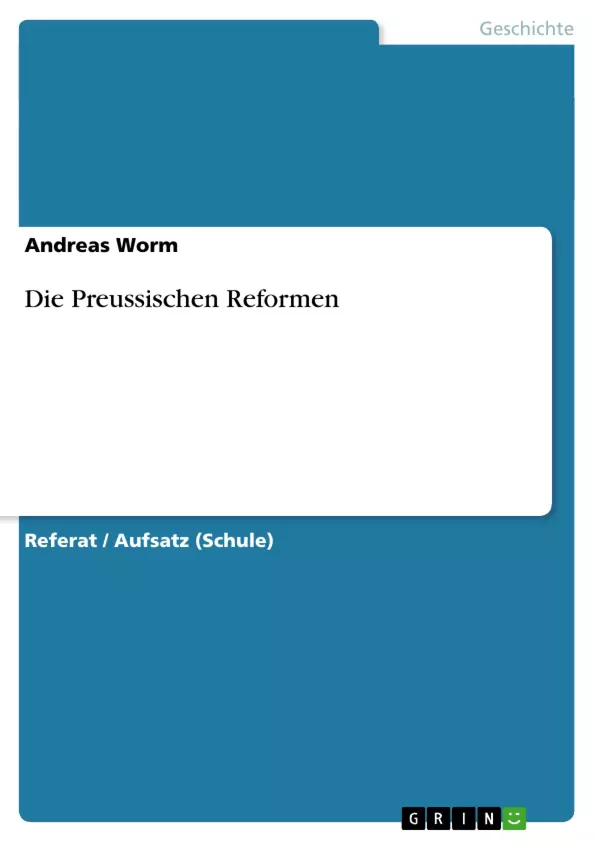Was ist der Hauptinhalt des Textes "Die preußische Reform"?
Der Text behandelt die preußische Reformbewegung des frühen 19. Jahrhunderts, insbesondere die Rolle von Freiherr vom Stein und die Auswirkungen der Reformen auf Preußen und Deutschland. Er untersucht die Bauernbefreiung, die Städteordnung, Bildungsreformen und die Kontinentalsperre.