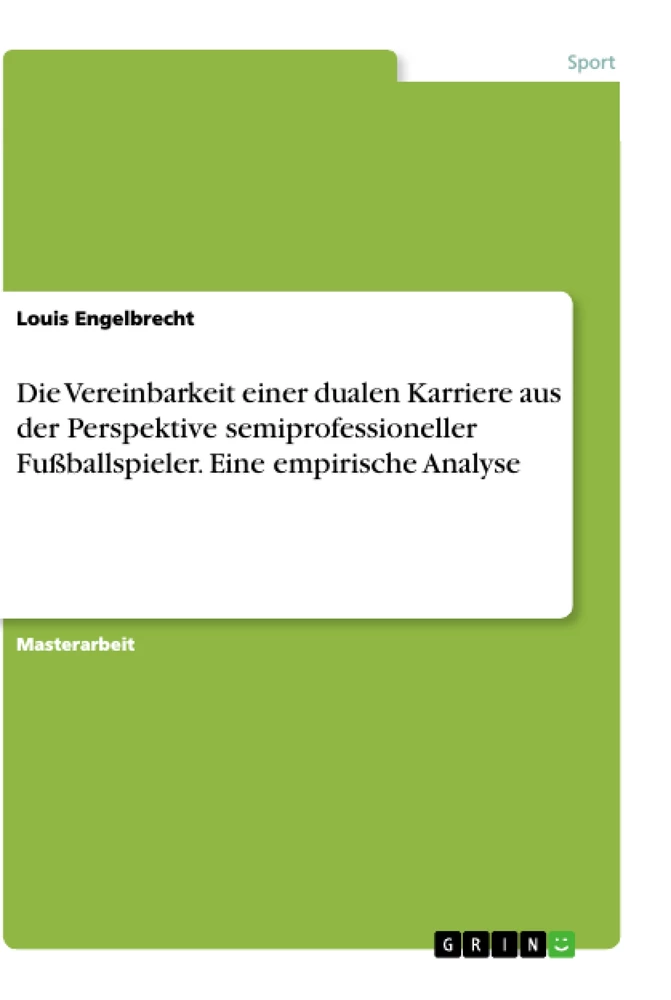Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Fragestellung, inwiefern semiprofessionelle Fußballer (SPF) eine duale Karriere, bestehend aus sportlicher Tätigkeit und der parallelen Herausbildung einer Berufsqualifikation (BQ), vereinbaren. Die empirische Vorgehensweise liegt in einer Methodentriangulation aus einer qualitativen Inhaltsanalyse (QI) nach Philipp Mayring und verschiedenen multivariaten Analyseverfahren. Die QI von drei problemzentrierten Interviews (PZI) mit SPF nach Andreas Witzel ermöglichte die Generierung von Hypothesen. Ein daran orientierter halbstandardisierter Online-Fragebogen wurde zufallsgesteuert von 155 SPF vollständig ausgefüllt. Nach einer explorativen Faktorenanalyse konnte der Datensatz daraufhin einer multiplen sowie einer binären logistischen Regressionsanalyse unterzogen werden.
Ist die Möglichkeit einer Vereinbarkeit für SPF gegeben und wie stellt sich die Kombination in der Realität dar? Diesen Fragen werden in der vorliegenden Arbeit auf den Grund gegangen. Ausgehend von einer definitorischen Abgrenzung relevanter Begriffe werden verschiedene Verbandsstatuten, sowie das Ligasystem betrachtet, um den Weg für die Herausbildung einer Definition des SPF zu ebnen. Der Terminus der dualen Karriere wird definiert und der Status quo dualer Karrieremöglichkeiten aufgezeigt. Nach Abschluss des theoretischen Teils werden qualitative Experteninterviews durchgeführt, die als Grundlage einer quantitativen Erhebung in Form eines Fragebogens dienen soll. Aus den empirisch fundierten Daten werden Hypothesen abgeleitet, geprüft und Forschungsfragen detailliert beantwortet.
Die stetig zunehmende Wirtschaftskraft rund um die Sportart Fußball hat Auswirkungen über die Profiligen Deutschlands hinaus, sodass mittlerweile semiprofessionelle Fußballspieler (SPF) mit dem Verdienst aus der fußballerischen Tätigkeit den Lebensunterhalt bestreiten können. Die finanzielle Verlockung in jungem Alter kann jedoch den Grundstein für ein nachsportliches Dilemma legen, wenn ein zukunftsorientiertes Denken ausbleibt und keine beruflichen Perspektiven anvisiert und geschaffen werden. Das Einkommen kann zwar für den Moment ausreichen, doch langfristig keine finanzielle Unabhängigkeit garantieren, weshalb ein zweites Standbein neben dem Fußball vonnöten ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Vom Amateur- zum Profifußball
- 2.1 Begriffsbestimmung
- 2.1.1 Professionalität & professioneller Fußball
- 2.1.2 Amateurismus & Amateurfußball
- 2.1.3 Semiprofessionalität & Semiprofessioneller Fußball
- 2.2 Der Vertragsstatus eines Fußballspielers
- 2.3 Struktur des deutschen Fußballliga-Systems
- 2.4 Definition: Der semiprofessionelle Fußballspieler
- 2.1 Begriffsbestimmung
- 3 Die duale Karriere: Eine Kombination aus Hochleistungssport und Berufsqualifikation
- 3.1 Definition: die duale Karriere
- 3.1.1 Inklusionsproblematik
- 3.2 Aktueller Forschungsstand
- 3.2.1 Sportartenübergreifende Studien bezüglich der Vereinbarkeit einer dualen Karriere
- 3.2.2 Aktueller Forschungsstand bezüglich der Vereinbarkeit einer dualen Karriere für den semiprofessionellen Fußballspieler
- 3.3 Status Quo: Die Vereinbarkeit einer dualen Karriere
- 3.3.1 Initiativen und Konzepte zur Förderung einer dualen Karriere für Hochleistungssportler/innen
- 3.4 duale Bildungsmöglichkeiten für semi-/professionelle Fußballspieler in Deutschland
- 3.4.1 Die Basis: Das Nachwuchsleistungszentrum
- 3.4.2 Studium & berufliche Weiterbildung
- 3.4.3 Spielergewerkschaft Vereinigung für Vertragsfußballer
- 4 Zwischenfazit
- 5 Methodik
- 5.1 Die Triangulation qualitativer und quantitativer Methoden
- 5.2 Qualitative Analyse
- 5.2.1 Wahl der Forschungsmethoden
- 5.2.2 Das Problemzentrierte Interview
- 5.2.3 Bestimmung der Interviewpartner
- 5.2.4 Form und Inhalte der Datenerhebung
- 5.2.5 Datenaufbereitung
- 5.2.6 Datenauswertung anhand qualitativer Inhaltsanalyse
- 5.2.7 Zusammenstellung der Ergebnisse und Interpretation
- 5.2.8 Interpretation der Ergebnisse in Richtung der Fragestellung
- 5.2.9 Anwendung der inhaltsanalytischen Gütekriterien
- 5.3 quantitative Analyse
- 5.3.1 Wahl des Forschungsproblems
- 5.3.2 Forschungsmethode & Studiendesign
- 5.3.3 Hypothesenbildung
- 5.3.4 Grundgesamtheit & Stichprobe
- 5.3.5 Operationalisierung
- 5.3.6 Gütekriterien
- 5.3.7 Datenerhebung
- 5.3.8 Datenanalyse
- 5.3.9 Deskriptive Statistik
- 5.3.10 Induktive Statistik
- 5.3.11 Interpretation der Ergebnisse, Implikationen
- 5.3.12 Limitationen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Vereinbarkeit einer dualen Karriere für semiprofessionelle Fußballspieler. Ziel ist es, herauszufinden, inwieweit diese Spieler eine sportliche Tätigkeit mit dem Aufbau einer beruflichen Qualifikation kombinieren können. Die Studie analysiert die Faktoren, die das Interesse und die erfolgreiche Umsetzung einer dualen Karriere beeinflussen.
- Vereinbarkeit von sportlicher Tätigkeit und Berufsqualifikation bei semiprofessionellen Fußballspielern
- Einflussfaktoren auf das Interesse an einer dualen Karriere
- Analyse der Herausforderungen und Möglichkeiten dualer Karrieren im semiprofessionellen Fußball
- Bewertung des aktuellen Angebots an dualen Karriere-Modellen
- Entwicklung von Empfehlungen zur Verbesserung der Unterstützung für semiprofessionelle Fußballspieler
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der dualen Karriere semiprofessioneller Fußballspieler ein und beschreibt den Kontext der zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung des Fußballs. Es wird die Problematik der mangelnden Zukunftsplanung vieler Spieler angesprochen und die Relevanz eines zweiten Standbeins neben dem Fußball hervorgehoben. Die Forschungsfrage wird formuliert und die Methodik der Arbeit kurz umrissen.
2 Vom Amateur- zum Profifußball: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Begriffsdefinitionen im Fußball (Amateur, Profi, Semiprofi) und deren Implikationen für den Spielerstatus und die Vertragsbedingungen. Die Struktur des deutschen Fußballliga-Systems wird erklärt und die spezifische Situation semiprofessioneller Spieler wird genauer definiert. Der Fokus liegt auf der Abgrenzung der verschiedenen Spielergruppen und den damit verbundenen finanziellen und beruflichen Realitäten.
3 Die duale Karriere: Eine Kombination aus Hochleistungssport und Berufsqualifikation: Dieses Kapitel analysiert den Begriff der dualen Karriere im Sport und beleuchtet den aktuellen Forschungsstand. Es werden sportartenübergreifende Studien und Studien speziell zum semiprofessionellen Fußball diskutiert. Der Status Quo der Vereinbarkeit einer dualen Karriere für semiprofessionelle Fußballer wird dargestellt. Initiativen und Konzepte zur Förderung dualer Karrieren werden erläutert und die konkreten Bildungsmöglichkeiten in Deutschland werden vorgestellt (z.B. Nachwuchsleistungszentren, Studium, Spielergewerkschaft).
4 Zwischenfazit: (Dieses Kapitel würde hier die Zusammenfassung des Zwischenfazits beinhalten, falls vorhanden im Originaltext)
5 Methodik: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der empirischen Untersuchung. Es wird die gewählte Methodentriangulation (qualitative Inhaltsanalyse und multivariate Analyseverfahren) vorgestellt. Die Durchführung der qualitativen Analyse (problemzentrierte Interviews) und der quantitativen Analyse (Online-Fragebogen, explorative Faktorenanalyse, multiple und binäre logistische Regressionsanalyse) wird Schritt für Schritt erläutert. Die Gütekriterien der jeweiligen Verfahren werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Semiprofessioneller Fußball, duale Karriere, Berufsqualifikation, Hochleistungssport, Vereinbarkeit, empirische Analyse, qualitative Inhaltsanalyse, multivariate Analyseverfahren, Problemzentriertes Interview, Online-Fragebogen, Jugendarbeit, Spielerentwicklung, finanzielle Unabhängigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Duale Karriere semiprofessioneller Fußballspieler
Was ist das Thema dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Vereinbarkeit einer dualen Karriere für semiprofessionelle Fußballspieler in Deutschland. Sie analysiert, inwieweit diese Spieler eine sportliche Tätigkeit mit dem Aufbau einer beruflichen Qualifikation kombinieren können und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definitionen von Amateur-, Profi- und Semiprofessionellem Fußball, die Struktur des deutschen Fußballliga-Systems, den aktuellen Forschungsstand zur dualen Karriere im Sport, konkrete Bildungsmöglichkeiten für semiprofessionelle Fußballspieler in Deutschland (z.B. Nachwuchsleistungszentren, Studium, Spielergewerkschaft), und die Herausforderungen und Möglichkeiten dualer Karrieren im semiprofessionellen Fußball. Die empirische Untersuchung kombiniert qualitative und quantitative Methoden.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine Triangulation qualitativer und quantitativer Methoden. Qualitativ wurden problemzentrierte Interviews durchgeführt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Quantitativ wurde ein Online-Fragebogen eingesetzt, dessen Daten mit explorativer Faktorenanalyse, multipler und binärer logistischen Regressionsanalyse analysiert wurden.
Welche Forschungsfragen werden beantwortet?
Die Arbeit untersucht die Vereinbarkeit von sportlicher Tätigkeit und Berufsqualifikation bei semiprofessionellen Fußballspielern, den Einflussfaktoren auf das Interesse an einer dualen Karriere, die Herausforderungen und Möglichkeiten dualer Karrieren im semiprofessionellen Fußball, das aktuelle Angebot an dualen Karriere-Modellen und entwickelt Empfehlungen zur Verbesserung der Unterstützung für semiprofessionelle Fußballspieler.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Vom Amateur- zum Profifußball, Die duale Karriere: Eine Kombination aus Hochleistungssport und Berufsqualifikation, Zwischenfazit und Methodik. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas und baut auf den vorherigen Kapiteln auf.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Semiprofessioneller Fußball, duale Karriere, Berufsqualifikation, Hochleistungssport, Vereinbarkeit, empirische Analyse, qualitative Inhaltsanalyse, multivariate Analyseverfahren, Problemzentriertes Interview, Online-Fragebogen, Jugendarbeit, Spielerentwicklung, finanzielle Unabhängigkeit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, herauszufinden, inwieweit semiprofessionelle Fußballspieler eine sportliche Tätigkeit mit dem Aufbau einer beruflichen Qualifikation kombinieren können und welche Faktoren das Interesse und die erfolgreiche Umsetzung einer dualen Karriere beeinflussen. Die Arbeit soll auch Empfehlungen zur Verbesserung der Unterstützung für diese Spieler liefern.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für semiprofessionelle Fußballspieler, Vereine, Spielergewerkschaften, Hochschulen, Ausbildungsinstitutionen und alle, die sich mit der Thematik der dualen Karriere im Sport beschäftigen.
- Quote paper
- Louis Engelbrecht (Author), 2019, Die Vereinbarkeit einer dualen Karriere aus der Perspektive semiprofessioneller Fußballspieler. Eine empirische Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/983397