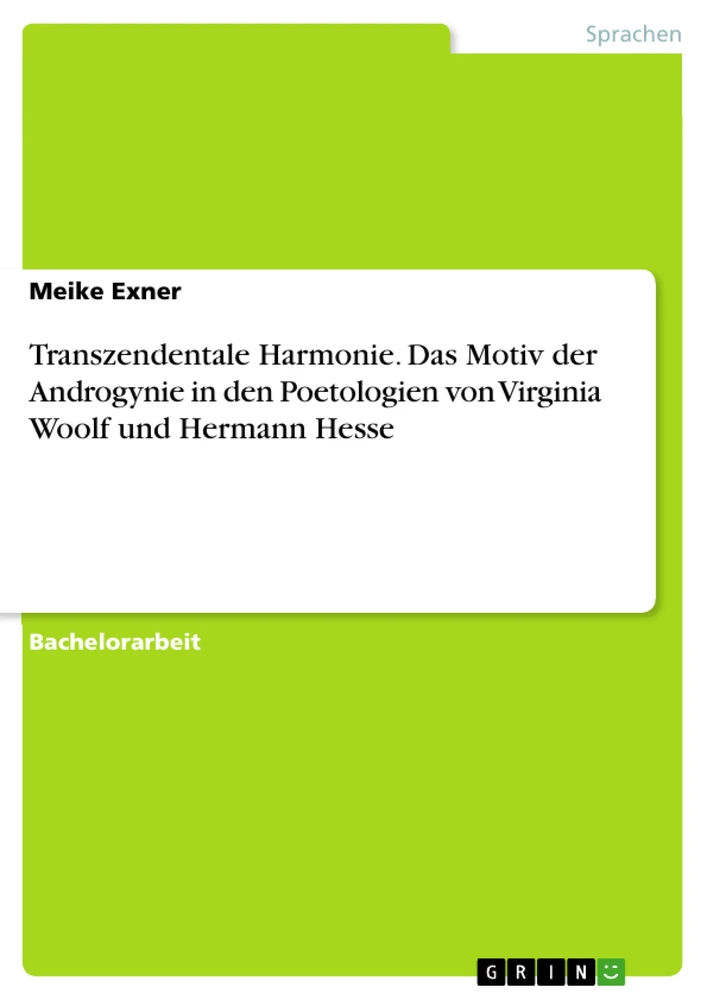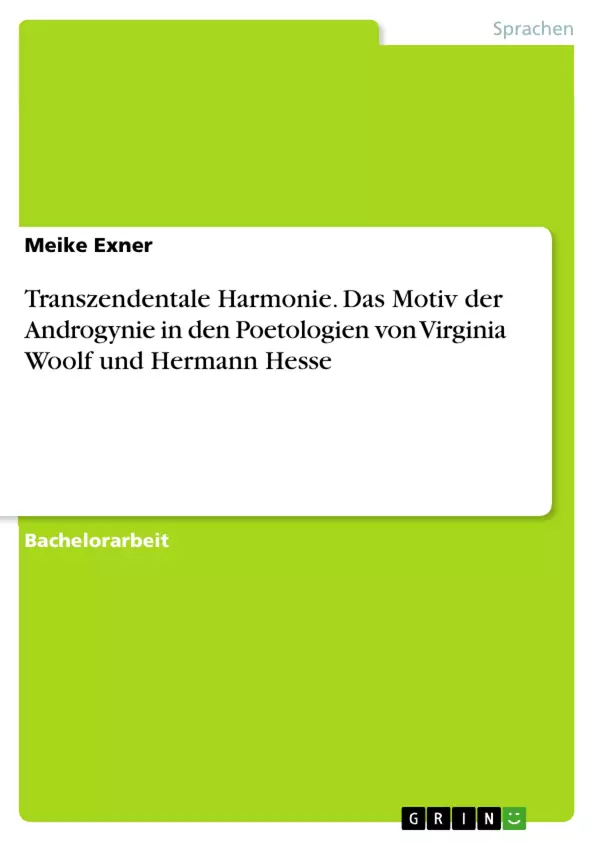Weiblich, männlich, androgyn? Ausblickend wird die Frage anvisiert, ob durch die Ästhetik und Inhalte der Schriften der Autor*innen das Geschlechtersystem ihrer Zeit infrage gestellt werden und inwiefern ihre Annahmen heute noch als aktuell gelten könnten. Hermann Hesse beschäftigt sich nicht ausdrücklich mit dem Geschlechterthema. In seinen Erzählungen tauchen Polaritäten und mehrpolare Persönlichkeitsstrukturen, entweder in einzelnen oder aufgeteilt auf mehrere Protagonist*innen auf. Im Gegensatz zu Hesse legt Virginia Woolf mit „Ein Zimmer für sich allein“ von 1929 eine deutliche Poetologie der Androgynie vor. So wird die Beschäftigung mit diesem Thema bei den Autor*innen ungleich ausfallen und bei Hesse mehr noch anhand seiner Romanfiguren erfolgen, als es bei Woolf nötig ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Poesie und Geschlecht
- Zeitgeschlechtliche Einordnung
- Die Frage nach einer geschlechtsspezifischen Ästhetik
- Sehnsucht nach Vollkommenheit
- Androgyni
- in der Psychologie
- als literarisches Motiv
- Androgyni
- Poetologie der Androgynie
- Die Auflösung der Polarität bei Virginia Woolf
- Die Tausend Seelen des Hermann Hesse und seiner Figuren
- Zur Konstruktion einer androgynen Autor*innenschaft
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Motiv der Androgynie in den Poetologien von Virginia Woolf und Hermann Hesse. Ziel ist es herauszufinden, ob und inwiefern dieses Motiv in ihren Werken vorkommt und wie es sich in ihrer jeweiligen schriftstellerischen Selbstauffassung niederschlägt. Die Arbeit beleuchtet die Verbindung zwischen Androgynie als Streben nach Vollkommenheit und dem schöpferischen Prozess.
- Androgyne Ästhetik und geschlechtsspezifische Wahrnehmung
- Das Motiv der Androgynie in der Literatur von Woolf und Hesse
- Die Konstruktion einer androgynen Autor*innenschaft
- Individuationsprozesse und schöpferisches Schreiben
- Dekonstruktion von Geschlechterrollen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Androgynie als Überschneidung von Geschlechtergrenzen ein und verortet sie im Kontext fiktiver Erzählungen. Sie betont die Bedeutung von Literatur zur Darstellung komplexer menschlicher Identitäten und die Möglichkeit, gesellschaftliche Rollenbilder durch die literarische Figur zu dekonstruieren. Die Einleitung stellt die zentralen Autor*innen, Virginia Woolf und Hermann Hesse, und ihre jeweiligen Werke vor, die als Fallbeispiele für die Untersuchung des Motivs der Androgynie dienen. Die Frage nach der eigenen Identität und der gesellschaftlichen Einordnung wird als Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit der Thematik der Androgynie benannt.
Poesie und Geschlecht: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Poesie, Geschlecht und Ästhetik. Es beleuchtet die zeitgeschichtliche Einordnung der Thematik und die Frage nach einer geschlechtsspezifischen Ästhetik. Die Diskussion befasst sich mit der möglichen Beeinflussung der poetischen Gestaltung durch das Geschlecht des Autors bzw. der Autorin und legt den Grundstein für die spätere Analyse der Werke von Woolf und Hesse unter dem Aspekt der Androgynie. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit traditionellen Vorstellungen von Geschlechterrollen und deren Auswirkungen auf die literarische Produktion.
Sehnsucht nach Vollkommenheit: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Androgyne, sowohl in psychologischer als auch in literarischer Hinsicht. Es untersucht die Androgyne als Ausdruck einer Sehnsucht nach Vollkommenheit und Ganzheitlichkeit, als Vereinigung von scheinbar gegensätzlichen Polen. Die Analyse beleuchtet verschiedene psychologische und literarische Interpretationen von Androgyne und bereitet den Boden für die spätere Anwendung des Begriffs auf die Poetologien der beiden Autor*innen. Die Bedeutung der Androgyne als literarisches Motiv für die Darstellung komplexer Identitäten und die Dekonstruktion von Geschlechterrollen wird herausgestellt.
Poetologie der Androgynie: Dieses Kapitel analysiert die Poetologien von Virginia Woolf und Hermann Hesse im Hinblick auf das Motiv der Androgynie. Es untersucht, wie die Auflösung der Polarität von Weiblichkeit und Männlichkeit in den Werken der beiden Autor*innen dargestellt wird. Die Analyse umfasst eine detaillierte Auseinandersetzung mit den individuellen Schreibweisen und der Konstruktion androgyn wirkender Figuren. Es wird herausgearbeitet, wie die jeweiligen Figuren das Streben nach Vollkommenheit und die Überwindung traditioneller Geschlechterrollen repräsentieren.
Schlüsselwörter
Androgynie, Poetologie, Virginia Woolf, Hermann Hesse, Geschlechterrollen, Vollkommenheit, Schöpferischer Prozess, Geschlechtsspezifische Ästhetik, Individuation, Literaturtheorie, Gender Studies.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Androgynie in den Poetologien von Virginia Woolf und Hermann Hesse
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Motiv der Androgynie in den Poetologien von Virginia Woolf und Hermann Hesse. Der Fokus liegt auf der Frage, ob und wie dieses Motiv in ihren Werken auftritt und sich in ihrer jeweiligen schriftstellerischen Selbstauffassung widerspiegelt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Verbindung zwischen Androgynie als Streben nach Vollkommenheit und dem schöpferischen Prozess.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Androgyne Ästhetik und geschlechtsspezifische Wahrnehmung, das Motiv der Androgynie in der Literatur von Woolf und Hesse, die Konstruktion einer androgynen Autor*innenschaft, Individuationsprozesse und schöpferisches Schreiben sowie die Dekonstruktion von Geschlechterrollen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Poesie und Geschlecht, ein Kapitel zur Sehnsucht nach Vollkommenheit, ein Kapitel zur Poetologie der Androgynie und ein Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Autorinnen und Autoren sowie deren Werke vor. Das Kapitel „Poesie und Geschlecht“ untersucht den Zusammenhang zwischen Poesie, Geschlecht und Ästhetik. „Sehnsucht nach Vollkommenheit“ definiert den Begriff der Androgynie psychologisch und literarisch. Das Kapitel „Poetologie der Androgynie“ analysiert die Werke von Woolf und Hesse im Hinblick auf das Motiv der Androgynie. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Wie werden Virginia Woolf und Hermann Hesse in der Arbeit behandelt?
Virginia Woolf und Hermann Hesse dienen als Fallbeispiele für die Untersuchung des Motivs der Androgynie. Die Arbeit analysiert ihre Poetologien, also ihre schriftstellerischen Theorien und Praktiken, um herauszufinden, wie sie das Motiv der Androgynie darstellen und wie es sich in ihrer Selbstauffassung als Schriftsteller*innen niederschlägt.
Welche Bedeutung hat die Androgynie in dieser Arbeit?
Androgynie wird in dieser Arbeit als Ausdruck einer Sehnsucht nach Vollkommenheit und Ganzheitlichkeit verstanden, als Vereinigung von scheinbar gegensätzlichen Polen. Sie wird sowohl psychologisch als auch literarisch betrachtet und ihre Bedeutung für die Darstellung komplexer Identitäten und die Dekonstruktion von Geschlechterrollen hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Androgynie, Poetologie, Virginia Woolf, Hermann Hesse, Geschlechterrollen, Vollkommenheit, schöpferischer Prozess, geschlechtsspezifische Ästhetik, Individuation, Literaturtheorie, Gender Studies.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Motiv der Androgynie in den Werken von Virginia Woolf und Hermann Hesse zu untersuchen und herauszufinden, wie dieses Motiv in ihren jeweiligen schriftstellerischen Selbstauffassungen zum Ausdruck kommt. Die Verbindung zwischen Androgynie, dem Streben nach Vollkommenheit und dem schöpferischen Prozess soll beleuchtet werden.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Wissenschaftler*innen, Studierende und alle Interessierten, die sich mit den Themen Androgynie, Literaturtheorie, Gender Studies, Virginia Woolf und Hermann Hesse auseinandersetzen.
- Quote paper
- MA Meike Exner (Author), 2015, Transzendentale Harmonie. Das Motiv der Androgynie in den Poetologien von Virginia Woolf und Hermann Hesse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/983799