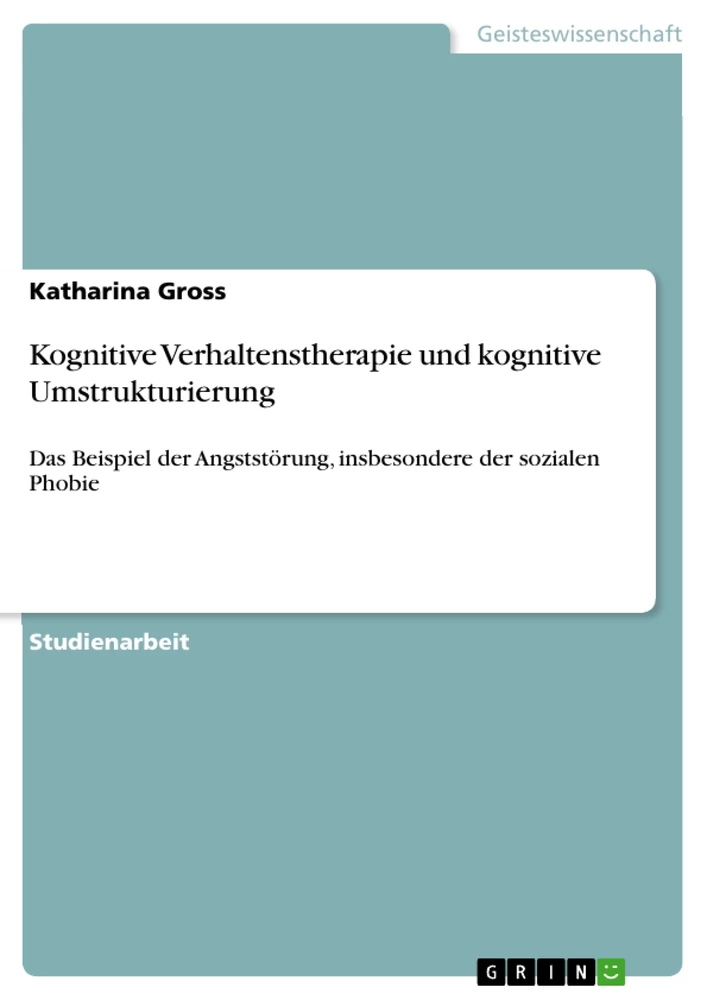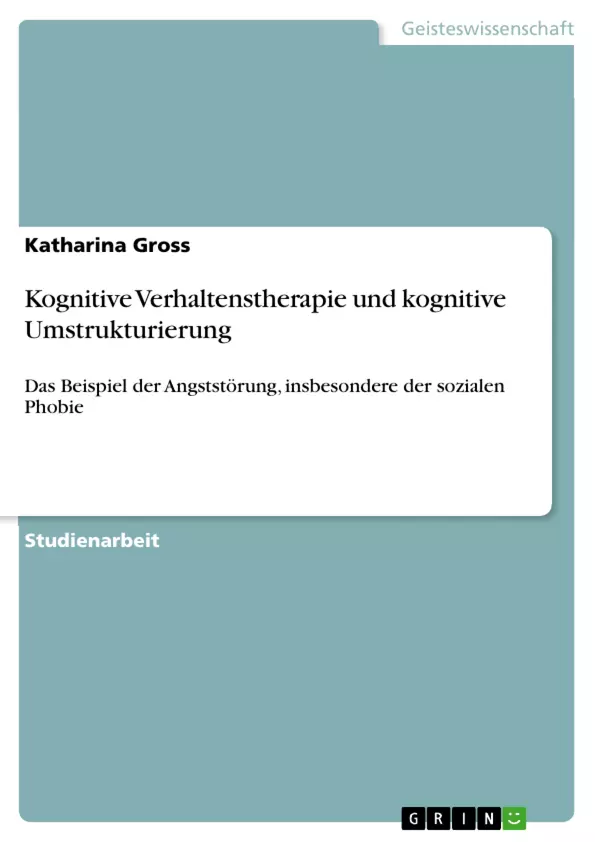Die Arbeit vermittelt als Einstieg in die Thematik vorerst grundlegendes Wissen über Angsterkrankungen. Anschließend wird mit theoretische Erklärungsmodellen gezeigt, wie Angststörungen entstehen können. Dabei stehen die Konditionierung und die kognitiven Theorien im Vordergrund. Um die Probleme eines Angstpatienten adäquat veranschaulichen zu können, erfolgt der Praxis-Transfer der beschriebenen Theorien anhand eines selbst gestalteten fiktiven Fallbeispiels. Hieran knüpft der Lösungsvorschlag in Form der Kognitiven Verhaltenstherapie an. Weil insbesondere die kognitive Umstrukturierung als evidenzbasierte Methode der kognitiven Verhaltenstherapie gilt, wird sie detailliert und praxisbezogen erläutert. Schließlich folgt eine kritische Diskussion, die darauf eingeht, dass es trotz der häufigen Anwendung der kognitiven Verhaltenstherapie, insbesondere der kognitiven Umstrukturierung, durchaus Alternativen oder Ergänzungsoptionen gibt, die je nach Verfassung des Klienten und Patientenanamnese angezeigt sein können. Zuletzt wird in einem Fazit darauf eingegangen, welche Ziele die Arbeit verfolgt und erreicht hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Angststörungen
- 2.1 Grundkenntnisse über Angststörungen
- 2.2 Theoretische Hintergründe der Entstehung von Angststörungen
- 3 Praxis-Transfer
- 3.1 Fiktives Fallbeispiel einer Patientin mit sozialer Phobie
- 3.2 Anwendung der theoretischen Erklärungsansätze für das Fallbeispiel.
- 4 Kognitive Umstrukturierung in der Verhaltenstherapie
- 4.1 Therapieeinstieg mittels ABC-Schema
- 4.2 Vorgehen der kognitiven Umstrukturierung
- 5 Diskussion
- 6 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Angststörungen und dem Transfer theoretischer Ansätze in die Praxis. Sie zielt darauf ab, grundlegendes Wissen über Angsterkrankungen zu vermitteln, die Entstehung von Angststörungen anhand verschiedener theoretischer Erklärungsmodelle zu beleuchten und den Einsatz der Kognitiven Verhaltenstherapie, insbesondere der kognitiven Umstrukturierung, in einem fiktiven Fallbeispiel zu demonstrieren.
- Grundkenntnisse über Angststörungen und deren Verbreitung
- Theoretische Erklärungsmodelle für die Entstehung von Angststörungen
- Praxis-Transfer anhand eines fiktiven Fallbeispiels
- Anwendung der Kognitiven Verhaltenstherapie, insbesondere der kognitiven Umstrukturierung
- Kritische Diskussion der kognitiven Verhaltenstherapie und ihrer Alternativen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Relevanz des Themas Angststörungen und die Problematik, die sie für Betroffene und die Gesellschaft darstellen. Kapitel 2 beschäftigt sich mit den Grundkenntnissen über Angststörungen, einschließlich ihrer Klassifizierung, Symptomatik und Komorbidität. In Kapitel 2.2 werden verschiedene theoretische Erklärungsmodelle für die Entstehung von Angststörungen beleuchtet, darunter die Konditionierungstheorie und die kognitiven Theorien. Kapitel 3 stellt ein fiktives Fallbeispiel einer Patientin mit sozialer Phobie vor und wendet die in Kapitel 2.2 beschriebenen Erklärungsmodelle auf diese Situation an. Kapitel 4 behandelt die Kognitive Verhaltenstherapie und erklärt die Anwendung der kognitiven Umstrukturierung, einer evidenzbasierten Methode, im Detail. Die Diskussion in Kapitel 5 hinterfragt die Anwendung der kognitiven Verhaltenstherapie und diskutiert alternative oder ergänzende Therapieformen. Das Fazit fasst die Ziele und Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Angststörungen, Angsterkrankungen, Konditionierung, Kognitive Verhaltenstherapie, Kognitive Umstrukturierung, Sozialphobie, Fallbeispiel, Praxis-Transfer, Behandlungsmöglichkeiten, Komorbidität, ABC-Schema, Evidenzbasierte Therapie
Häufig gestellte Fragen
Wie entstehen Angststörungen laut kognitiven Theorien?
Angststörungen entstehen oft durch fehlerhafte Bewertungsprozesse und kognitive Verzerrungen, bei denen harmlose Situationen als bedrohlich eingestuft werden.
Was ist kognitive Umstrukturierung?
Es ist eine Methode der Verhaltenstherapie, bei der Patienten lernen, ihre irrationalen Gedanken zu identifizieren, zu hinterfragen und durch realistischere Denkmuster zu ersetzen.
Was erklärt das ABC-Schema in der Therapie?
Das ABC-Schema verdeutlicht den Zusammenhang zwischen einem auslösenden Ereignis (Activating Event), den Bewertungen (Beliefs) und den daraus resultierenden emotionalen Konsequenzen (Consequences).
Was ist ein Beispiel für den Praxis-Transfer bei Sozialphobie?
Anhand eines fiktiven Fallbeispiels zeigt die Arbeit, wie eine Patientin mit sozialer Phobie durch kognitive Verhaltenstherapie ihre Angst vor Bewertung in sozialen Situationen abbauen kann.
Gibt es Alternativen zur kognitiven Verhaltenstherapie?
Die Arbeit diskutiert kritisch, dass je nach Patientenanamnese auch andere Therapieformen oder ergänzende Optionen sinnvoll sein können, obwohl die KVT als besonders evidenzbasiert gilt.
- Quote paper
- Katharina Gross (Author), 2020, Kognitive Verhaltenstherapie und kognitive Umstrukturierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/983894