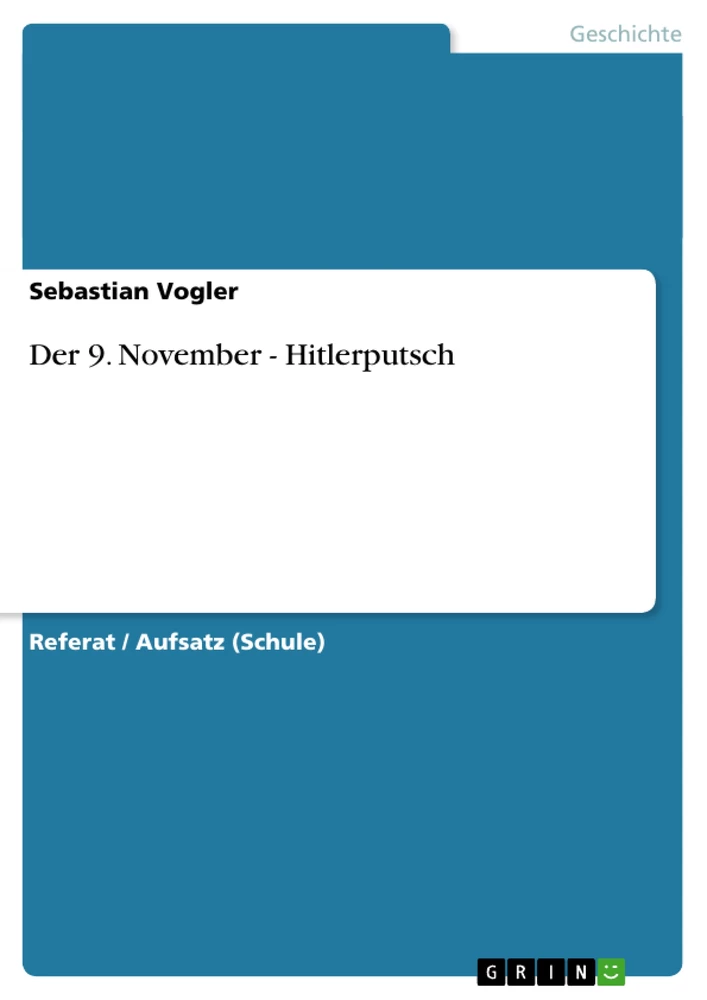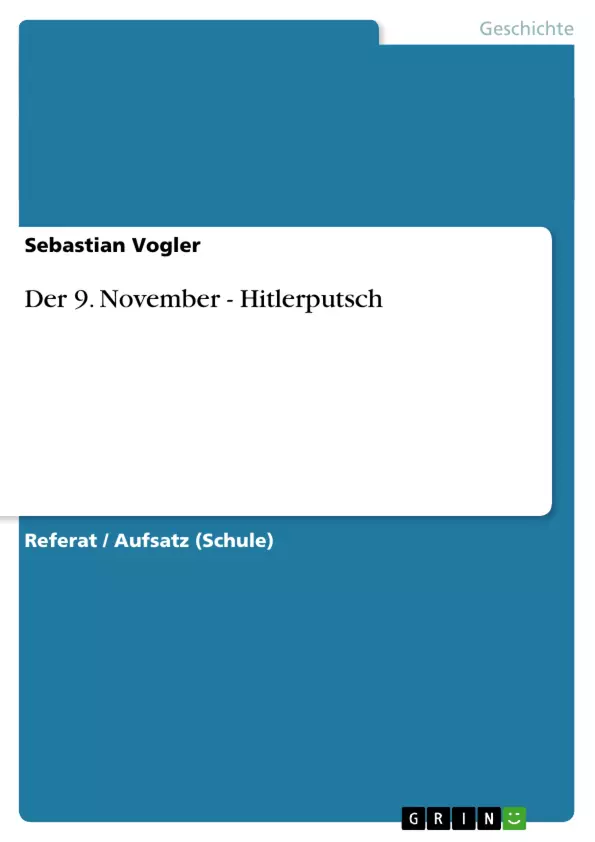Vorgeschichte
Die Jahre von 1918 bis 1923 sahen eine galoppierende Inflation, die bis zum totalen Zusammenbruch der Währung führte, die Besetzung des Ruhrgebiets durch die Franzosen, kommunistische Aufstände in Sachsen und Thüringen sowie rechte Umsturzversuche, die die junge Republik immer wieder in ihrer Existenz bedrohten. Insbesondere Bayern hatte sich nach der Zerschlagung der Räterepublik 1919 zum Agitationsfeld deutschnationaler Gruppierungen entwickelt. Nachdem die Reichsregierung am 26. September den Ruhrkampf abbrach und die wirtschaftliche Situation an einem neuen Tiefpunkt angelangt war, verkündete die bayerische Landesregierung den Ausnahmezustand für das Land, wobei sich der Generalstaatskommissar Gustav Ritter von Kahr an die Spitze der Regierung setzte und in enger Zusammenarbeit mit der bayerischen Reichswehrführung unter General Otto Hermann von Lossow und dem Leiter der Bayerischen Landespolizei, Hans von Seißer, offenen Ungehorsam gegenüber Anweisungen aus Berlin übte.
Während sich der Oberbefehlshaber der Reichswehr, General Hans von Seeckt, sich sofort für einem Einmarsch in Thüringen und Sachsen entschied, verweigerte er ein Eingreifen in Bayern. In einem Schreiben an von Kahr vom 5. November 1923 bot er diesem sogar Unterstützung an und gab mit den folgenden Worten unmißverständlich seine antirepublikanische Einstellung preis: "Die Weimarer Verfassung ist für mich kein noli me tangere (...)".
Die Durchführung bzw. das Ende des Putsches
Der NSDAP war es in Bayern durch geschickte Propaganda 1923 gelungen, die Zahl der Mitglieder von 15000 auf 55000 zu erhöhen. Gleichzeitig hatte sie einflußreiche Persönlichkeiten aus der Wirtschaft für ihre Ziele gewinnen können. Die Entwicklung vom Herbst 1923 kam dann allerdings vor allem den konservativen Kräften zugute, und der Einfluß Hitlers und der NSDAP drohte wieder zu schwinden. Aus diesem Grund plante er eine Propagandaaktion, die als Initialzündung für eine Revolution von rechts dienen sollte. Hitler nutzte eine geplante Kundgebung v.Kahrs vor nationalistisch-bürgerlichem Publikum am 8. November im Münchner Bürgerbräukeller, um sich und seinen Gefolgsleuten unter Waffengewalt Zutritt zu verschaffen und den Ausbruch einer nationalen Revolution zu verkünden. Mit vorgehaltener Pistole erzwang der selbsternannte Revolutionär einen Pakt mit von Kahr, General von Lossow und von Seisser, die allerdings erst nach Eintreffen General Ludendorffs, der sich auf Hitlers Seite schlug, zustimmten, um in derselben Nacht noch mit der Begründung zu widerrufen, sie seien erpreßt worden.
Als Hitler am Morgen des 9. November 1923 davon erfuhr, war ihm die Ausweglosigkeit seiner Lage bewußt. Trotzdem versuchte er mit einer verzweifelten Aktion, doch noch die Wende herbeizuführen: Angelehnt an Mussolinis "Marsch auf Rom" im Jahre 1922, organisierte Hitler den "Marsch zur Feldherrnhalle", der jedoch im Kugelhagel der Landespolizei in der Münchner Innenstadt endete. Vierzehn Aufständische und drei Polizisten wurden getötet. Hitler flüchtete leicht verletzt und völlig verwirrt. Nur Ludendorff marschierte weiter. Die Aktion wurde für die NSDAP zu einem einzigen Desaster. Sie wurde in der Folge verboten. Hitler selbst mußte sich vor Gericht verantworten.
Konsequenzen des Putsches
Daß es Adolf Hitler im Nachhinein doch noch gelang, Kapital aus dem kläglich gescheiterten Unternehmen zu schlagen, war ein "Verdienst" der deutschen Justiz, die ihm einerseits ein Forum für eine propagandistische Ausschlachtung der Ereignisse bot, andererseits jene Milde im Urteilsspruch walten ließ, die gegenüber Angeklagten des rechten Spektrums gang und gäbe war. Unter Betonung des "rein vaterländischen und des edelsten selbstlosen Willens der Angeklagten" wurden am 1. April 1924 lediglich Mindeststrafen ausgesprochen. Hitler und drei seiner Mitangeklagten erhielten fünf Jahre Festungshaft in Landsberg, aus der Hitler aber bereits am 20. Dezember 1924 vorzeitig entlassen wurde. General Ludendorff wird frei gesprochen.
Hitlers Ideologie
Die kurze Haftzeit nutzte Hitler dazu, den ersten Teil von "Mein Kampf" zu verfassen. Das Buch diente mehreren Zwecken: der Legendenbildung über die eigene Jugend und den politischen Werdegang, der Darstellung der künftigen Absichten, insbesondere jedoch der eingehenden Begründung des nationalsozialistischen Kampfes.
Auszüge daraus sollen die in Hitler tief verwurzelte antisemitische Einstellung verdeutlichen, deren Herkunft eine eigene Abhandlung wert wäre:
"Er (der Jude) ist und bleibt der ewige Parasit, ein Schmarotzer, der wie ein schädlicher Bazillus sich immer mehr ausbreitet, sowie nur ein günstiger Nährboden dazu einlädt. Die Wirkung seines Daseins aber gleicht ebenfalls der von Schmarotzern: wo er auftritt, stirbt das Wirtsvolk nach kürzerer oder längerer Zeit ab..."
Häufig gestellte Fragen
Was waren die Ereignisse vor dem Hitler-Putsch?
Die Jahre 1918 bis 1923 waren geprägt von Hyperinflation, der Besetzung des Ruhrgebiets durch Frankreich, kommunistischen Aufständen in Sachsen und Thüringen sowie rechten Putschversuchen, die die Weimarer Republik gefährdeten. Bayern entwickelte sich zu einem Zentrum deutschnationaler Agitation, insbesondere nach der Niederschlagung der Münchner Räterepublik im Jahr 1919.
Wie reagierte die bayerische Landesregierung auf die Krise?
Nach dem Abbruch des Ruhrkampfes durch die Reichsregierung im September 1923 erklärte die bayerische Landesregierung den Ausnahmezustand. Gustav Ritter von Kahr übernahm als Generalstaatskommissar die Führung und widersetzte sich in Zusammenarbeit mit der bayerischen Reichswehrführung unter General Otto Hermann von Lossow und dem Leiter der Bayerischen Landespolizei, Hans von Seißer, Anweisungen aus Berlin.
Wie verhielt sich die Reichswehr zu Bayern?
General Hans von Seeckt, Oberbefehlshaber der Reichswehr, entschied sich für ein Eingreifen in Thüringen und Sachsen, verweigerte aber ein Eingreifen in Bayern. Er bot Kahr sogar Unterstützung an und äußerte seine antirepublikanische Haltung.
Wie kam es zum Hitler-Putsch im November 1923?
Die NSDAP hatte 1923 durch Propaganda ihre Mitgliederzahl in Bayern erheblich gesteigert. Hitler plante eine Propagandaaktion, um eine Revolution von rechts auszulösen. Er nutzte eine Kundgebung von Kahr im Münchner Bürgerbräukeller am 8. November, um unter Waffengewalt eine nationale Revolution zu verkünden. Er erzwang zunächst einen Pakt mit Kahr, Lossow und Seißer, die diesen jedoch später widerriefen.
Was geschah am Tag nach dem Putschversuch?
Am Morgen des 9. November 1923 organisierte Hitler den "Marsch zur Feldherrnhalle", angelehnt an Mussolinis "Marsch auf Rom". Dieser Marsch endete jedoch im Kugelhagel der Landespolizei. Vierzehn Aufständische und drei Polizisten wurden getötet. Hitler flüchtete verletzt. Die NSDAP wurde verboten.
Welche Konsequenzen hatte der Putsch für Hitler und die NSDAP?
Obwohl der Putsch scheiterte, konnte Hitler ihn propagandistisch nutzen. Die deutsche Justiz verurteilte ihn zu einer milden Strafe. Er erhielt fünf Jahre Festungshaft in Landsberg, wurde aber vorzeitig entlassen. General Ludendorff wurde freigesprochen.
Was tat Hitler während seiner Haft?
Hitler nutzte seine Haftzeit, um den ersten Teil von "Mein Kampf" zu verfassen. Das Buch diente der Legendenbildung, der Darstellung künftiger Absichten und der Begründung des nationalsozialistischen Kampfes.
Welche Ideologien vertrat Hitler?
Hitler vertrat tief verwurzelte antisemitische Ansichten, die in "Mein Kampf" deutlich zum Ausdruck kommen. Er bezeichnete Juden als "Parasiten" und "Schmarotzer", die das Wirtsvolk zerstören würden.
- Quote paper
- Sebastian Vogler (Author), 1999, Der 9. November - Hitlerputsch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98425