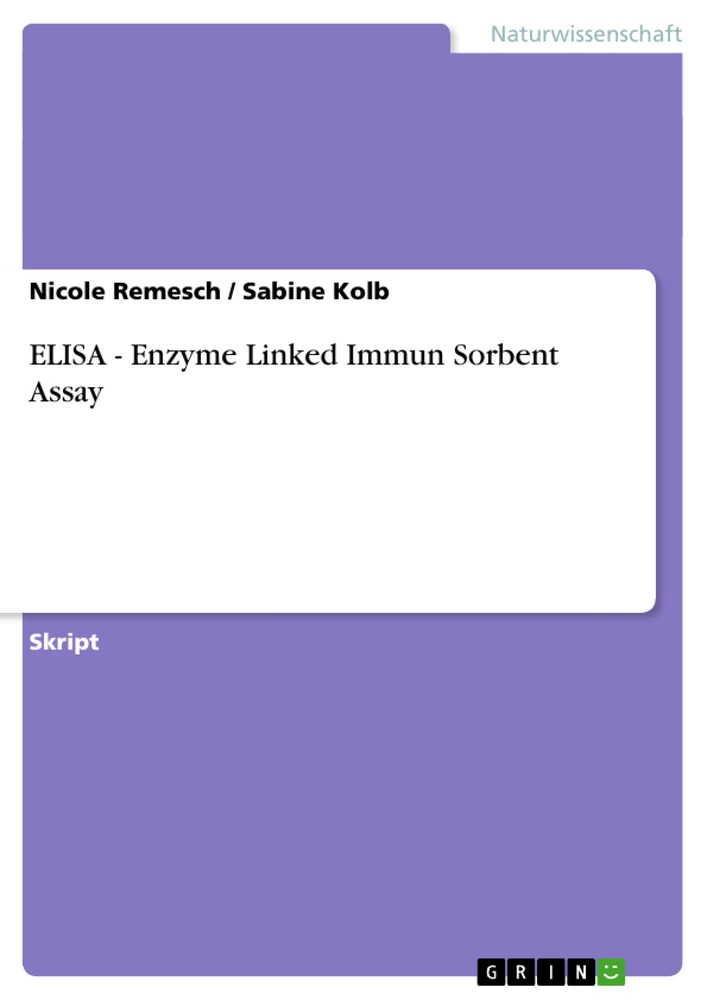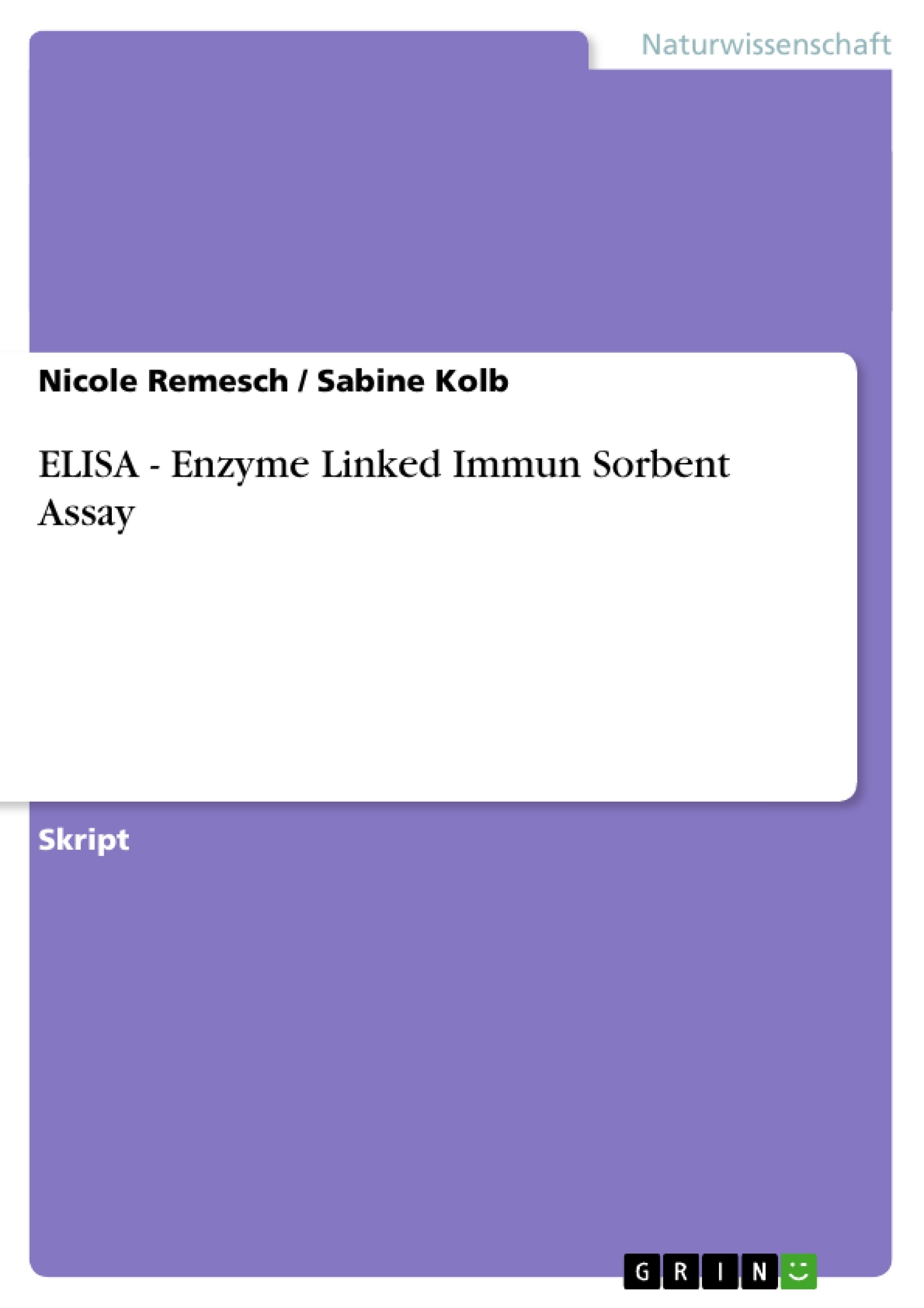INHALTSVERZEICHNIS
1. Prinzip und Aufgabenstellung
1.1. Prinzip
1.2. Aufgabenstellung
2. Materialien
2.1. Reagentien
2.2. Lösungen
2.3. Geräte
3. Methodik
3.1. Inkubieren der Microtiterplatte
3.2. Waschen
3.3. Blockieren
3.4. Waschen
3.5. Primärer Antikörper
3.6. Waschen
3.7. Sekundärer Antikörper
3.8. Waschen
3.9. Färben
4. Durchführung
4.1. 1. Versuch
4.1.1. Inkubieren der Microtiterplatte
4.1.2. Blockieren
4.1.3. Primärer Antikörper
4.1.4. Färben
4.1.5. Anmerkung
4.2. 2. Versuch
4.2.1. Inkubieren der Microtiterplatte
4.2.2. Primärer Antikörper
4.2.3. Anmerkung
4.3. 3. Versuch
4.3.1. Inkubieren der Microtiterplatte
4.3.2. Waschen
4.3.3. Blockieren
4.3.4. Primärer Antikörper
4.3.5. Sekundärer Antikörper
5. Ergebnisse
5.1. 1. Versuch
5.2. 2. Versuch
5.3. 3. Versuch
6. Diskussion
6.1. 1. Versuch
6.2 . 2. Versuch
6.3 . 3. Versuch
7. Literatur
Abkürzungen
Anhang
Abb.: ELISA - Gerät mit Drucker
Ausdru>1. Versuch
Ausdru> 2. Versuch
Ausdru> 3. Versuch:
1. ELISA - Platte
2. ELISA - Platte
1. Prinzip und Aufgabenstellung
1.1. Prinzip
Der ELISA ist ein oft (v.a. in Reihentests) angewandter Immunassay, mit dessen Hilfe die Konzentration eines Antikörpers bzw. Antigens in einer Lösung (z.B. Serum, Urin, Zellkulturüberstand) bestimmt werden kann.
Einer der miteinander reagierenden Stoffe ist dabei mit einem Enzym markiert, das einen kolorimetrischen Nachweis erlaubt (üblicherweise Alkalische Phosphatase oder Peroxidase).
Beim indirekten ELISA werden die Mikrotiterplatten mit Antigen beschichtet und dann die Probe hinzugefügt. Der gebundene Antikörper wird anschließend durch Zugabe eines enzymmarkierten Antikörpers, der spezifisch für den gebundenen Antikörper ist, nachgewiesen.
Dieser enzymmarkierte Antikörper wird als Detektorantikörper bezeichnet.
1.2. Aufgabenstellung
Es wurde versucht, eine von einem Gaststudenten (Assistenten) erarbeitete ELISA - Vorschrift nachzuarbeiten.
Die Versuche sollen die Spezifität der aus Hühnereiern gewonnenen Antikörper überprüfen, sowie den zukünftigen Einsatz des Testverfahrens zur quantitativen Antigenbestimmung etablieren.
Dazu sollte der Test vorher mit Referenz - Antikörpern (IgY x SSA; IgY x RSA) optimiert werden.
2. Materialien
2.1. Reagentien
- Rinderserumalbumin; Boehringer Mannheim GmbH, Nr. 735 078 · Tween 20; Merck
- Casein nach Hammersten; Merck, Nr. 2242 · NaOH 2 M
- Antikörper IgY x RSA, Fraktion 9/5
- Antikörper IgY x SSA, Fraktion 10/5
- Enzymgekoppelter Antikörper Rabbit x Chicken IgG, ALP; Sigma, Nr. 18H4829 · SIGMA FAST NPP Substrat Tabletten Set; Sigma, Nr. N-2770 · Deionat
2.2. Lösungen
- PBS-Puffer 0,1 M pH 7,5 (vom Assistenten übernommen)
- PBS-Puffer 0,05 M pH 7,5 (vom Assistenten übernommen)
- Na2CO3-Puffer 0,05 M pH 9,6 (vom Assistenten übernommen)
(Der Na2CO3-Puffer 0,05 M hatte einen pH von 8,7 und wurde mit NaOH auf 9,6 eingestellt.)
- Schweineserumalbuminlösung 10,7 mg/l (vom Assistenten übernommen)
Standards: Es werden 10 Standards mit den Konzentrationen zwischen 10,7 mg/l SSA und 1,7 mg/l SSA (mit Na2CO3-Puffer verdünnt) hergestellt.
- Rinderserumalbuminlösung 10,4 mg/l
10,4 mg RSA in 100 ml Na2CO3-Puffer lösen und dann 1:10 verdünnen (jeweils Schaumbildung wurde nicht berücksichtigt).
Standards: Es werden 10 Standards mit den Konzentrationen zwischen 10,4 mg/l RSA und 1,4 mg/l RSA (mit Na2CO3-Puffer verdünnt) hergestellt.
- Caseinlösung
10 mg Casein in 10 ml PBS-Puffer 0,05 M lösen (Schaumbldg.).
- Antikörperlösungen
je 10 _l Antikörper in 10 ml PBS-Puffer 0,1 M (Verdünnung: 1: 1000) lösen (Schaumbldg.).
- Antikörperlösungen + Casein
je 10 _l Antikörper in 10 ml PBS-Puffer 0,1 M (Verdünnung: 1: 1000) lösen und 10 mg Casein (1 mg/ml) zugeben (Schaumbldg.).
- Färbelösung
Lösen der pNPP- und Tris-Puffer-Tabletten in 20 ml Deionat.
- Waschlösung
0,025 ml Tween 20 in 50 ml PBS-Puffer 0,05 M lösen (Schaumbldg.).
2.3. Geräte
- Microtiterplatten, Nunc Maxi Sorp 12 x 8 · Reader 400 SF plus, mit 405 nm Filter · Wägeschiffchen
- 200 _l Kolbenhubpipette (verstellbar) + Spitzen
- 30 - 300 _l Kolbenhubpipette, 12 channel + Spitzen · ELISA-Plastikrahmen
- ELISA-Microtiterstreifen · 5 ml Glasreagenzgläser
- Meßkolben 10 ml, 50 ml,100 ml · Vakuumpumpe
- Brutschrank für 30°C und 37°C
3. Methodik
3.1. Inkubieren der Microtiterplatte
Die Microtiterplatte wird mit je 100 µl Standard inkubiert.
Die Platte wird nun für 24 Stunden bei 4°C erschütterungsfrei stehengelassen.
Die spezifischen Antigene binden an das starre Polystyrol.
3.2. Waschen
Lösungen mit einer an eine Vakuumpumpe angeschlossenen Pipettenspitze absaugen, 150 µl Waschlösung in die ,,wells" geben und Flüssigkeit wieder absaugen; Vorgang 5 mal wiederholen.
Bei diesem Vorgang werden die nicht gebundenen Antigene, Antikörper und nicht gebundenes Casein ausgewaschen. Gutes Waschen der ELISA - Platte gibt gute Signale, bei zuviel waschen riskiert man aber das Herunterlösen der bereits gebundenen Stoffe.
3.3. Blockieren
Je 100 µl Caseinlsg einfüllen und 2 Stunden bei 37°C stehenlassen.
Das Casein bindet an die noch freien Stellen der Mikrotiterplatte, dadurch soll eine mögliche Background-Bindung des Antikörpers vermieden oder zumindest niedrig gehalten werden.
3.4. Waschen (siehe 3.2.)
3.5. Primärer Antikörper
Nun werden je well 100 µl des 1. Antikörpers einpipettiert und für 24 Stunden bei 4°C stehengelassen.
Der Antikörper bindet an das Antigen.
3.6. Waschen (siehe 3.2.)
3.7. Sekundärer Antikörper
100 µl des sekundären Antikörpers in alle wells füllen und 2 Stunden bei 37°C stehenlassen.
Der Antikörper, der mit dem Enzym Alkalische Phosphatase markiert ist , bindet an den Antikörper, der bereits an das Antigen gebunden hat.
3.8. Waschen (siehe 3.2.)
3.9. Färben
200 µl der Färbelösung zugeben und in 5 min - Abständen die Extinktionen bei 405 nm messen.
Das Enzym Alkalische Phosphatase spaltet das pNPP in das gelbe Endprodukt p-Nitrophenol. Die Konzentration (Intensität) des entstehenden Farbstoffs l äß t Rückschlüsse auf die ursprüngliche Konzentration des gesuchten Antikörpers zu.
4. Durchführung
4.1.1. Versuch (durchgeführt am 17., 18., 23. und 24. 03. 1999)
4.1.1. Inkubieren der Microtiterplatte
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- In den Reihen A und B wurden die RSA-Standards und in C und D die SSA-Standards aufgetragen (von 2 bis 11 in steigender Konzentration); in den Spalten 1 und 12 wurde Na2CO3-Puffer gefüllt (=Blindwert).
4.1.2. Blockieren
- Die Platte wurde mit der Caseinlsg. bis zum nächsten Arbeitstag bei 4°C stehengelassen. · Vor dem nächsten Schritt wurde die Platte, nach Rat des Assistenten, eine halbe Stunde in den 37°C Brutschrank gestellt.
4.1.3. Primärer Antikörper
- Bei den Reihen A und B wurde der Antikörper gegen Rind eingefüllt, bei C und D der Antikörper gegen Schwein.
4.1.4 Färben
- Die Extinktionen wurden nach ca. einer halben Stunde gemessen.
4.1.5. Anmerkung
- Beim ersten Versuch wurde für das Einpipettieren von Lösungen ausschließlich die 200 _l Kolbenhubpipette verwendet.
4.2. 2. Versuch (durchgeführt am 09., 10. und 11. 03. 1999)
4.2.1. Inkubieren der Mikrotiterplatte
- Durch den Einsatz des NUNC - Modul - Systems, das lediglich Streifen á 8 wells (von A nach H) ermöglicht, wurde eine andere Auftragung gewählt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- In den Spalten 1 und 2 wurden die RSA-Standards und in 3 und 4 die SSA-Standards aufgetragen (von G bis B in steigender Konzentration; da aber nur 8 wells zur Verfügung standen, haben wir in den Spalten 1 und 3 die Standards mit den Konzentrationen von 1.0,
3.0, 5.0, 7.0, 9.0, 10.0 mg/l, und in den Spalten 2 und 4 die Standards mit den Konzentrationen von 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0 mg/l gegeben); in den Reihen A und H wurde Na2CO3-Puffer gefüllt (=Blindwert).
4.2.2. Primärer Antikörper
- Bei den Spalten 1 und 2 wurde der Antikörper gegen Rind eingefüllt, bei 3 und 4 der Antikörper gegen Schwein.
4.2.3. Anmerkung
- Ab diesem Versuch wurde für das Einpipettieren von Lösungen die 12-Kanal- Kolbenhubpipette verwendet; bei jedem Waschvorgang wurde die Platte auf dem Schüttler geschüttelt und nach jedem Waschvorgang wurde die Waschlsg. zuerst ausgesaugt und anschließend auf einem Küchenrollepapier ausgeklopft.
4.3.3.Versuch (durchgeführt am 23., 24. und 25. 03. 1999)
4.3.1. Inkubieren der Mikrotiterplatten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.3.2. Waschen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
ELISA 1,2: Spalten 1, 2, 7, 8: Leeren, 150 µl Waschlsg. zugeben, 3 min einweichen lassen, Flüssigkeit aussaugen; Vorgang 3 mal wiederholen und dann Flüssigkeit ausschütteln.
Spalten 3 - 6: Leeren, 2 x 150 µl Deionat, 1 x 150µl Waschlsg., 2 x 150 µl Deionat und 1 x 150 µl 0,05 M PBS-Puffer zugeben, und jeweils wieder Flüssigkeit aussaugen.
4.3.3. Blockieren
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
ELISA 1,2: Spalten 1, 3, 5, 7: 100 µl Casein zugeben und 1 Stunde bei 37°C stehen lassen.
Spalten 2, 4, 6, 8: 100 µl Casein zugeben und 2 Stunde bei 37°C stehen lassen.
4.3.4. Primärer Antikörper
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
ELISA 1: Spalten 1, 2,5,6: 100 µl des Antikörpers gegen Rind + Casein einpipettieren und für 2 Stunden bei 30°C stehenlassen.
Spalten 3, 4,7,8: 100 µl des Antikörpers gegen Schwein + Casein einpipettieren und für 2 Stunden bei 30°C stehenlassen.
ELISA 2: Spalten 1, 2,5,6: 100 µl des Antikörpers gegen Rind + Casein einpipettieren und für 24 Stunden bei 4°C stehenlassen.
Spalten 3, 4,7,8: 100 µl des Antikörpers gegen Schwein + Casein einpipettieren und für 24 Stunden bei 4°C stehenlassen.
4.3.5. Sekundärer Antikörper
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
ELISA 1: Spalten 1 - 8: 100 µl des Antikörpers gegen Huhn + Casein einpipettieren und für 2 ¼ Stunden bei 30°C stehenlassen.
ELISA 2: Spalten 1 - 8: 100 µl des Antikörpers gegen Huhn + Casein einpipettieren und für 2 Stunden bei 37°C stehenlassen.
5. Ergebnisse
5.1. 1.Versuch
Es konnte keine Auswertung gemacht werden, da einige Werte, sowie ein Teil der Blindwerte, zu hoch waren.
Die Probenextinktionen zeigten keinen Zusammenhang zu den Konzentrationen.
5.2. 2. Versuch
Es konnte keine brauchbare Auswertung gemacht werden, da die meisten Blindwerte höher als die Standards waren, und manche verdünntere Standards höhere Werte aufwiesen, als die konzentrierteren.
Die Blindwerte stiegen im Verlauf der Messung auf mind. das 10-fache der Anfangsextinktionen (d.h. der 1. Messung). Die Probenextinktionen stiegen willkürlich und in keinem Zusammenhang zu den Konzentrationen, und blieben größtenteils unter den Extinktionen der Blindwerte.
5.3. 3. Versuch
Auch hier waren die meisten Werte beider ELISAs zu hoch.
Die Extinktionen der Blindwerte stiegen auf ca. das 10-fache der Anfangsextinktionen, dabei blieben ihre Werte aber unter den Werten der Standards.
6. Diskussion
5.1. 1. Versuch
Da der Test keine Ergebnisse brachte, führten wir ihn noch einmal durch.
5.2. 2. Versuch
Grund für dieses Ergebnis könnte das Auswaschen des Caseins sein und das Anlagern der Antikörper an die Oberfläche der ELISA - Platte. Aufgrund dieser Vermutung haben wir beim nächsten Versuch unter anderem zwei verschiedene Waschtechniken ausprobiert. Wir verglichen einen Vorgang bei dem dreimal mit Waschlösung gewaschen wurde und 3 minütlicher Einwirkzeit, mit einem Vorgang bei dem sechsmal mit verschiedenen Lösungen gewaschen wurde und keine Einwirkzeit angewandt wurde.
Dadurch verglichen wir eine intensivere Methode mit einer sanfteren Methode.
Ein weiterer Grund könnte die Dissoziation des Caseins aufgrund der längeren Inkubationszeit bei 37°C sein. Deshalb wählten wir zusätzlich eine kürzere Inkubationszeit.
Da wir in der Literatur verschiedene Inkubationszeiten für den primären Antikörper und den sekundären Antikörper fanden, versuchten wir einen Unterschied zwischen den einzelnen Arten festzustellen.
5.3.3. Versuch
Bei der ELISA - Platte 1 waren alle Standards zu hoch, bei der ELISA - Platte 2 nur ein Teil. Die Ursache könnte in den unterschiedlichen Inkubationsarten mit dem 1. Antikörper und dem 2. Antikörper liegen. Bei der E. 2 haben wir festgestellt, daß es Unterschiede zwischen der beiden Wascharten gibt. Die auf die 2. Art gewaschenen (Spalten 3 - 6) waren bis auf 2 außerhalb des Meßbereiches, die auf die 1. Art gewaschenen zeigten zwar Werte, welche aber wiederum keinen Zusammenhang zu den Konzentrationen zeigten. Die unterschiedlichen Arten des Blockierens zeigten keinen Einfluß auf die Ergebnisse.
7. Literatur
KEMENY, D. M.: ELISA - Anwendung des Enzyme Linked Immunsorbent Assay im biologisch/medizinischen Labor, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1994, ISBN 3-437-11493- X, pp. 24,78,79,104,105
REHM, Hubert: Der Experimentator Proteinbiochemie, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1997, 2. Auflage, ISBN 3-437-25750-1, p. 150
Arbeitsvorschrift des Assistenten
Abkürzungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anhang
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument ist eine umfassende Beschreibung eines ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) Experiments. Es enthält detaillierte Informationen zu Prinzipien, Materialien, Methoden, Durchführung, Ergebnissen und Diskussionen verschiedener Versuche. Außerdem sind ein Inhaltsverzeichnis, eine Liste von Abkürzungen und ein Literaturverzeichnis enthalten.
Was ist das Prinzip eines ELISA-Tests?
Der ELISA ist ein Immunassay, der zur Bestimmung der Konzentration eines Antikörpers oder Antigens in einer Lösung verwendet wird. Dabei wird einer der beteiligten Stoffe mit einem Enzym markiert, das einen kolorimetrischen Nachweis ermöglicht.
Welche Materialien werden für den ELISA-Test benötigt?
Zu den benötigten Materialien gehören Reagenzien (z.B. Rinderserumalbumin, Tween 20, Casein), Lösungen (verschiedene Puffer, Standards, Antikörperlösungen) und Geräte (Microtiterplatten, Reader, Pipetten, Brutschrank).
Wie wird der ELISA-Test durchgeführt?
Der Test umfasst mehrere Schritte: Inkubation der Microtiterplatte mit Antigen, Waschen, Blockieren mit Casein, Zugabe des primären Antikörpers, Waschen, Zugabe des sekundären Antikörpers (enzymmarkiert), Waschen und Färben zur Messung der Extinktion.
Welche Probleme traten bei der Durchführung der Versuche auf?
Die Versuche zeigten Probleme wie zu hohe Werte, inkonsistente Ergebnisse, steigende Blindwerte und fehlenden Zusammenhang zwischen Probenextinktionen und Konzentrationen.
Welche möglichen Ursachen wurden für die Probleme diskutiert?
Mögliche Ursachen umfassen das Auswaschen des Caseins, Anlagerung der Antikörper an die Oberfläche der ELISA-Platte, Dissoziation des Caseins aufgrund der Inkubationszeit und Unterschiede in den Waschtechniken.
Welche Referenzen werden im Dokument genannt?
Das Dokument verweist auf die Publikationen von KEMENY, D. M. und REHM, Hubert, sowie auf die Arbeitsvorschrift des Assistenten.
Was sind die gelisteten Abkürzungen?
Die Abkürzungen werden im Anhang einzeln aufgelistet und beinhalten u.a.: ELISA, IgY, RSA, SSA, ALP, NPP, PBS.
Was zeigt das angehängte Bild?
Das angehängte Bild zeigt ein ELISA-Gerät mit Drucker.
- Quote paper
- Nicole Remesch (Author), Sabine Kolb (Author), 1999, ELISA - Enzyme Linked Immun Sorbent Assay, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98480