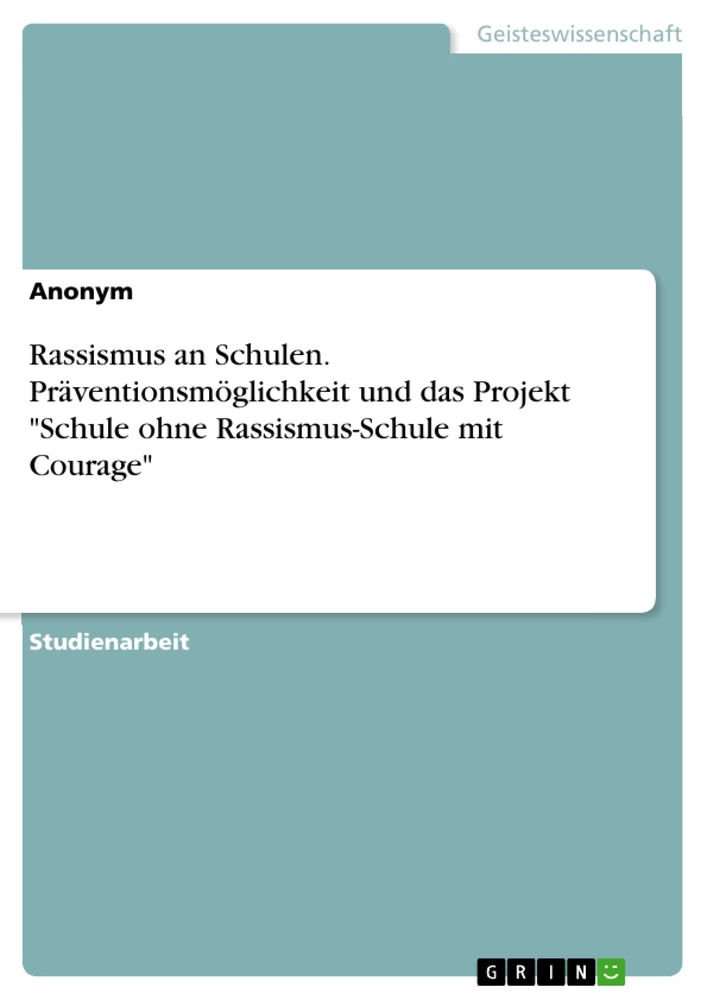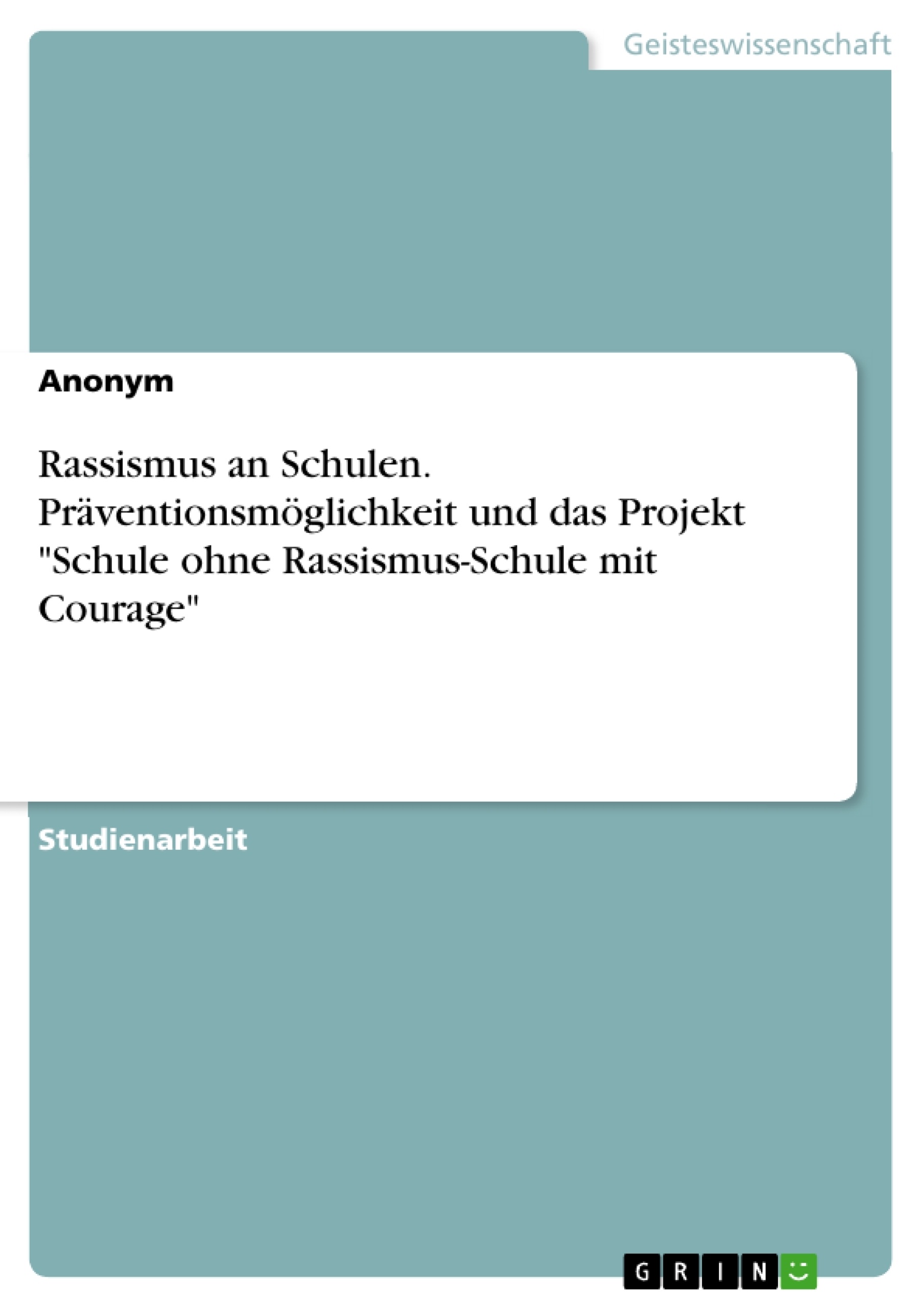Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Rassismus an Schulen und den Präventionsmöglichkeiten von Rassismus an Schulen in Verknüpfung mit dem Projekt "Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage". Auf dieser Grundlage wird die Frage behandelt, wie wirksam das Projekt zur Beseitigung von Rassismus an Schulen ist. Zunächst werden im Hauptteil Begriffe erläutert, die einen kleinen Einblick in die theoretischen Grundlagen zum Thema Diskriminierung und Rassismus im Kontext "Schule" geben. Daurauf folgend wird ein Konzept und Präventionsmöglichkeiten an deutschen Schulen erklärt. Zum Schluss wird das Projekt "Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage" vorgestellt und die Wirksamkeit untersucht.
Jeder ist von Rassismus geprägt und viele leiden auch darunter. Einige leiden offensichtlicher ans andere, wobei die andere Hälfte dies gar nicht merkt, es geschieht unbewusst. Fereidooni unterscheidet zwischen institutionellem und individuellem Rassismus.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundbegriffe
- Rassismus- Form der Diskriminierung
- Rassismus im Kontext „Schule“
- Präventionsmöglichkeit von Rassismus an Schulen
- Projekt: „Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage“
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Rassismus an Schulen und die Präventionsmöglichkeiten von Rassismus im Kontext des Projekts „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Die Arbeit analysiert, inwiefern das Projekt zur Beseitigung von Rassismus an Schulen wirksam ist.
- Begriffsbestimmung von Rassismus und Diskriminierung
- Rassismus im Bildungsbereich
- Präventionsmöglichkeiten von Rassismus an Schulen
- Das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“
- Wirksamkeit des Projekts zur Bekämpfung von Rassismus
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung befasst sich mit der Bedeutung von Menschenwürde und Gleichheit im Kontext des Grundgesetzes, stellt jedoch gleichzeitig fest, dass Diskriminierung und Ungleichbehandlung in der Realität weit verbreitet sind. Der Text führt Rassismus als eine Form der Diskriminierung ein und hebt die Notwendigkeit von Präventionsmaßnahmen an Schulen hervor.
Grundbegriffe
2.1. Rassismus- Form der Diskriminierung
Dieser Abschnitt erläutert den Begriff der Diskriminierung und ihre verschiedenen Formen, darunter Rassismus. Die Ausführungen beleuchten, wie Diskriminierung auf der Grundlage von verschiedenen Merkmalen wie Rasse, Herkunft oder Religion erfolgt und beleuchten die Folgen für Menschen mit Migrationshintergrund.
2.2. Rassismus im Kontext „Schule“
Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Phänomen des Rassismus im Kontext der Bildungseinrichtung Schule. Er betont die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit rassistischen Weltbildern und die Bedeutung von Präventionsmaßnahmen, die den Schüler/innen die Möglichkeit bieten, kritisch zu hinterfragen.
Präventionsmöglichkeit von Rassismus an Schulen
Dieser Abschnitt beleuchtet verschiedene Präventionsmöglichkeiten, um Rassismus an Schulen zu begegnen. Die Ausführungen fokussieren auf Konzepte und Maßnahmen, die Schüler/innen für Diskriminierung und rassistische Weltbilder sensibilisieren und ihnen helfen, diese kritisch zu hinterfragen.
Projekt: „Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage“
Dieser Abschnitt stellt das Projekt „Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage“ vor und beleuchtet seine Ziele und Ansätze zur Bekämpfung von Rassismus an Schulen. Der Abschnitt hinterfragt die Wirksamkeit des Projekts in Bezug auf die tatsächliche Umsetzung der Ziele und die Beseitigung von Rassismus.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Rassismus, Diskriminierung, Bildung, Schule, Prävention, Projekt, „Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage“. Die Arbeit befasst sich mit der Untersuchung von rassistischen Strukturen und Verhaltensweisen an Schulen und den Möglichkeiten zur Prävention von Rassismus durch das Projekt „Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage“.
Häufig gestellte Fragen
Wie äußert sich Rassismus im Kontext der Schule?
Rassismus an Schulen zeigt sich sowohl individuell durch Beleidigungen oder Ausgrenzung als auch institutionell durch Benachteiligung im Bildungssystem aufgrund der Herkunft oder des Namens.
Was ist der Unterschied zwischen individuellem und institutionellem Rassismus?
Individueller Rassismus geht von einzelnen Personen aus (Vorurteile, Gewalt). Institutioneller Rassismus beschreibt Strukturen in Organisationen, die bestimmte Gruppen systematisch benachteiligen, oft ohne dass dies den Akteuren bewusst ist.
Was ist das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“?
Es ist ein Netzwerk von Schulen, bei dem sich mindestens 70 % der Schulmitglieder verpflichten, aktiv gegen jede Form von Diskriminierung und Mobbing vorzugehen und regelmäßig Projekte dazu durchzuführen.
Wie wirksam ist dieses Projekt zur Beseitigung von Rassismus?
Die Wirksamkeit hängt stark von der tatsächlichen Umsetzung im Schulalltag ab. Das Siegel allein löst das Problem nicht, aber es schafft eine wichtige Basis für Sensibilisierung und Zivilcourage.
Welche Präventionsmöglichkeiten gibt es für Lehrkräfte?
Lehrkräfte können durch die Förderung von Medienkompetenz, die kritische Auseinandersetzung mit rassistischen Weltbildern im Unterricht und die Schaffung eines offenen Diskussionsklimas präventiv wirken.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Rassismus an Schulen. Präventionsmöglichkeit und das Projekt "Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/984868